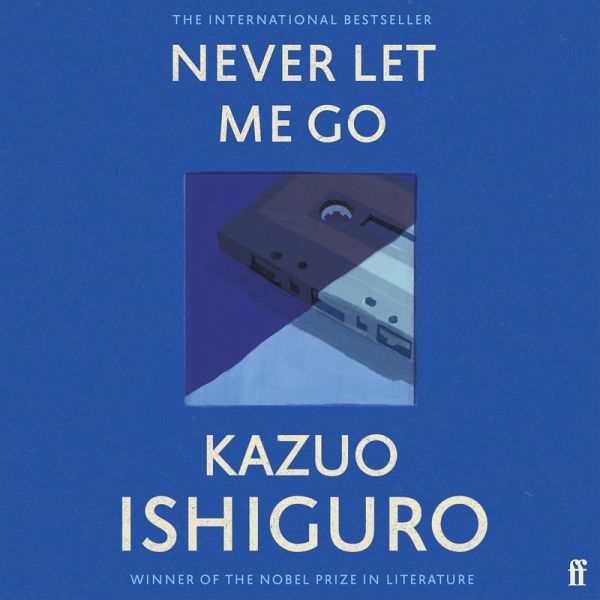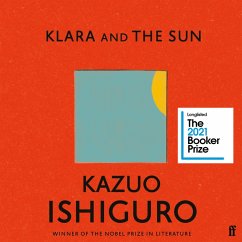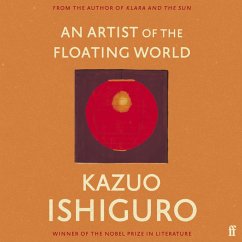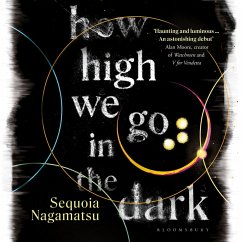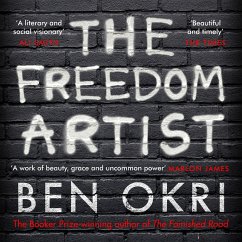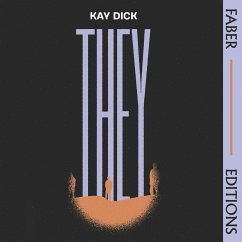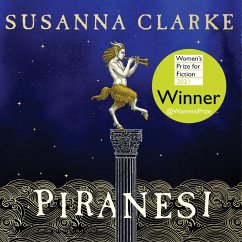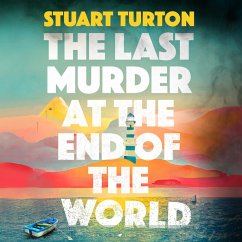Kazuo Ishiguro
Hörbuch-Download MP3
Never Let Me Go (MP3-Download)
20th anniversary edition Ungekürzte Lesung. 566 Min.
Sprecher: Fox, Kerry

PAYBACK Punkte
13 °P sammeln!





In one of the most acclaimed novels of recent years, Kazuo Ishiguro imagines the lives of a group of students growing up in a darkly skewed version of contemporary England. Narrated by Kathy, now thirty-one, Never Let Me Go dramatizes her attempts to come to terms with her childhood at the seemingly idyllic Hailsham School and with the fate that has always awaited her and her closest friends in the wider world. A story of love, friendship and memory, Never Let Me Go is charged throughout with a sense of the fragility of life.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
KAZUO ISHIGURO was born in Nagasaki, Japan, in 1954 and moved to Britain at the age of five. His works of fiction have earned him many honours around the world, including the Nobel Prize in Literature and the Booker Prize. His work has been translated into over fifty languages and The Remains of the Day and Never Let Me Go have both been made into acclaimed films. He received a knighthood in 2018 for Services to Literature. He also holds the decorations of Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres from France and the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star from Japan. His latest novel, Klara and the Sun, was a Sunday Times Number One bestseller in both hardcover and paperback. Ishiguro also works occasionally as a screenwriter. His screenplay for the 2022 film Living received Academy Award (Oscar) and BAFTA nominations. Cinema adaptation of Klara and the Sun and A Pale View of the Hills are due for release in 2025., (Shorter/Catalogue version) Kazuo Ishiguro was born in Nagasaki, Japan, in 1954 and moved to Britain at the age of five. His works of fiction have earned him many honours around the world, including the Nobel Prize in Literature and the Booker Prize, and have been translated into over fifty languages. His most recent novel, Klara and the Sun was a number one Sunday Times bestseller in both hardback and paperback.

© Jeff Cottenden
Produktdetails
- Verlag: Faber & Faber
- Erscheinungstermin: 6. Juni 2013
- Sprache: Englisch
- ISBN-13: 9780571308637
- Artikelnr.: 68156776
Masterly... A novel with piercing questions about humanity and humaneness. Sunday Times
Broschiertes Buch
Dieses Buch erzählt die Lebensgeschichte von Kathy H. und ihrer Freunde Ruth und Tommy. In Drei Teilen erzählt Kathy H. ihre Lebensgeschichte. Von ihrer Kindheit in einer Art Internat Namen Hailsham, von ihrer kurzen Jungend in den Cottages und ihrem Leben als Spender und Betreuer.
Im …
Mehr
Dieses Buch erzählt die Lebensgeschichte von Kathy H. und ihrer Freunde Ruth und Tommy. In Drei Teilen erzählt Kathy H. ihre Lebensgeschichte. Von ihrer Kindheit in einer Art Internat Namen Hailsham, von ihrer kurzen Jungend in den Cottages und ihrem Leben als Spender und Betreuer.
Im ersten Teil, der Kindheit, entfaltet sich eine einerseits heile Welt wie in einem Hanni und Nanni Internat, andererseits schwebt da dieses Damoklesschwert „spenden“ über den Kindern, denn noch bevor sie überhaupt in die mittleren Jahre kommen, werden ihnen nach und nach die lebenswichtigen Organen entnommen.
Die Kinder waren noch nie in der wahren Welt, sie sind ihr Leben lang in Hailsham interniert, in ihrer eigenen, kleinen, „heilen“ Welt. Für das Leben nach Hailsham gibt es Fächer wie Gesellschaftskunde in welchem Fähigkeiten in Rollenspielen eingeübt werden, die man als normaler Mensch einfach so mitbekommt und erlebt. Die Lehrer werden Aufseher genannt, was sie wohl auch in gewisser weise sind. Dieses Hailsham ist Internat und Gefängnis zugleich. Die Lehrer scheinen mit ihrer Rolle auch nicht glücklich zu sein. Da wäre miss Lucy, die wütend wird, wenn die Kinder Fragen über das Spenden stellen. Die Aufseher verlieren sich in mysteriösen Andeutungen wie "Es geschieht aus gutem Grund. Aus einem sehr wichtigen Grund. (S. 55)" Dann ist da die seltsame Madame, die die schönsten Kunstwerke abholt und sich dabei jedoch vor den Kindern ekelt, wie vor Spinnen (S. 48 ). Warum wird in Hailsham so viel Wert auf Kreativität gelegt und so wenig auf Naturwissenschaften und logisches Denken? Nie sind die Kinder allein, immer in Gruppen.
Eine interessante Mischung aus heiler Internatswelt, seltsamer Internierung und Abschottung vor der Außenwelt und einem großen Geheimnis, das immer nur angedeutet wird. Beklemmend und doch wieder heile Welt, surreal und doch wieder nicht.
Der Autor entwirft eine geschickte Utopie, wie Menschen zu Dingen werden, das akzeptieren, sich in ihre Rolle einfinden und stolz darauf sind. Das ganze Menschenbild oder besser Spenderbild, das in diesem Buch gezeigt wird ist menschenunwürdig. Ein Spender stirbt nicht, er schließt ab. Die Cottages machen den Eindruck einer Auswilderung. Wie bei wilden Tieren. Ab und an mal vorsichtige Ausflüge ins Umlang um die neue Welt zu erkunden, nachdem man sein Leben im Zoo / Hailsham verbracht haben. Man lernt menschliche Verhaltensweisen unreflektiert aus dem Fernsehen, schaut aber nie Nachrichten und interessiert sich nicht dafür, was in der Welt wirklich passiert.
Diese Menschen lernen nie Probleme zu klären. Probleme schwären vor sich hin, werden vermieden, verschwiegen und irgendwann muss es dann zum Ausbruch und Zusammenbruch kommen, was wohl auch beabsichtig ist, die Cottages sollen die Jugendlichen, die vorher zusammenhielten und in der Masse und in ihrer Verbundenheit eine Gefahr wären, entzweien. Sie flüchten in den einzigen ihnen möglichen Beruf als Betreuer, in welchem sie Spender auf dem Weg des Sterbens begleiten. Sie sehen Jahrelang das Leid um sich herum, haben keinen um darüber zu sprechen und das macht sie kaputt. Sie sind psychisch letztendlich so am Ende, dass sie einfach nur spenden und sterben wollen. Ein extrem perfides Kontrollsystem.
Probleme hatte ich mit der Datierung der Geschichte, sie spielt in den 1970er – 1990er Jahren. Aber damals war es noch nicht möglich Menschen zu klonen, mir wäre eine Datierung in die Zukunft logischer erschienen. Wer hat diese Kinder geboren?
Fazit: Dieses Buch liest sich flüssig und spricht auf emotionale und poetische Weise ethische Dilemmas an, die das Klonen mit sich bringen wird/kann. Das Buch hat aber vielleicht gerade wegen seiner Emotionalität einige logische Lücken und Probleme, die nicht gelöst werden, wie die Datierung der Geschichte. Dennoch extrem lesenswert.
Weniger
Antworten 3 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für