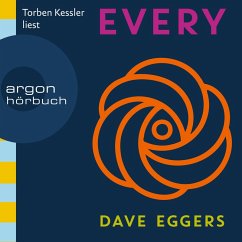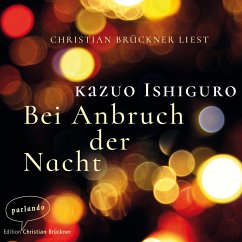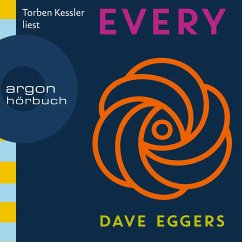Noch wach? (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 698 Min.






Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Produktdetails
- Verlag: argon
- Erscheinungstermin: 19. April 2023
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783732420544
- Artikelnr.: 67808074
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Da redet jemand über leere Worthülsen und Inhaltsleere, nur um dann selbst zig Zitate zu verwenden und inhaltlich genauso wenig in Sachen Kritik zu sagen. Eine Rezension, die null Aufschluss über das Buch gibt.
am 24.04.2023
Das Buch ist schlechteste Literatur-Hausmannskost der ganz eigen-wiligen Art im Denglish-Style. An einer Stelle redet der Autor davon, dass er auf den Video-Chats immer so ein rundes, dickes Gesicht hätte. Das ist bei dieser hohlwangig lang gezogenen Version besonders absurd. Der Autor wird sich bestimmt die Aufnahmen bei seiner Buchvorstellung im Berliner Ensemble anschauen. Dort sieht man seine spannende, integrierte Nase in Seitenansicht. Wir werden das in seinem nächsten Buch vernehmen, ich bin sicher.
Ich lese soeben das Buch "Wie man schlecht schreibt" und kann sagen, dass hier nahezu alles zutrifft. Die Formulierungen sind seicht tiefer gelegt, durchsetzt von Englisch-Kaskaden, der Mix-up eines Slangs, den man schwer versteht. Die Architektur der Sätze ist brüchig, fahrig und wenig selbstbewusst. Man wähnt sich im Kampf von Don Quichotte gegen die Windmühlen von Elon Musk und anderen, wirklich bedeutenden Menschen.
Der Autor gibt m.E. dem (berechtigten) Angriff auf männliche, sexuelle Ausbeutung von Abhängigen wenig Substanz und rutscht am eigenen Überlegenheitsanspruch nach unten. Man macht sich automatisch Gedanken, ob es auch Ausbeuten von männlichen Freundschaften bei erheblichem Altersunterschied gibt und fragt sich, wie er es mit der Beziehung zu seinem Freund so hielt.
Antworten finde ich weit mehr in den Büchern von Esther Vilar, das Meiste ist bereits lange zurückliegend gesagt worden, ein echtes Problem unterschiedlicher Macht-Attraktions-Relationen, für die es keine universellen Antworten gibt.