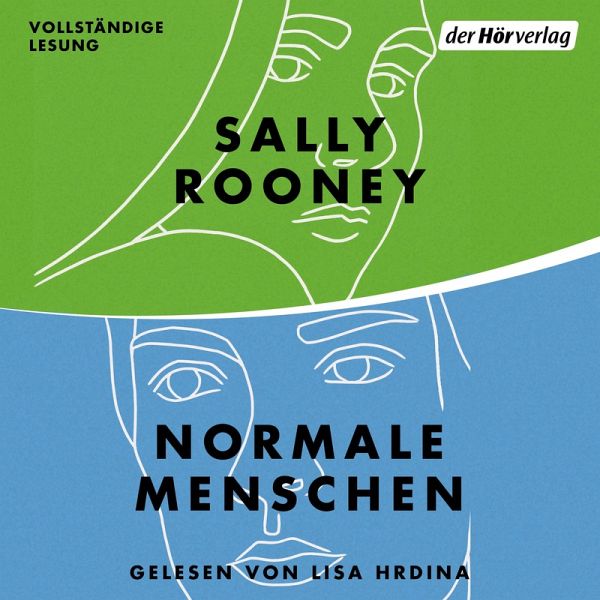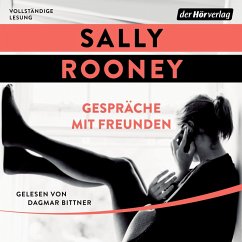Sally Rooney
Hörbuch-Download MP3
Normale Menschen (MP3-Download)
Roman Ungekürzte Lesung. 507 Min.
Sprecher: Hrdina, Lisa / Übersetzer: Beck, Zoë

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!





Eine Geschichte über Faszination und Freundschaft, über Sex, Macht und Liebe – von Literatur-Shootingstar Sally Rooney Connell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf, aber das ist auch schon ihre einzige Gemeinsamkeit. Connell ist der Star im Footballteam, Marianne die komische Außenseiterin. Doch als die beiden zum ersten Mal miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später, an der Universität in Dublin, werden sie, obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder magnetisch, unwiderstehlich voneinander ange...
Eine Geschichte über Faszination und Freundschaft, über Sex, Macht und Liebe – von Literatur-Shootingstar Sally Rooney Connell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf, aber das ist auch schon ihre einzige Gemeinsamkeit. Connell ist der Star im Footballteam, Marianne die komische Außenseiterin. Doch als die beiden zum ersten Mal miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später, an der Universität in Dublin, werden sie, obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder magnetisch, unwiderstehlich voneinander angezogen. Lisa Hrdinas Lesung erzählt authentisch und wahrhaftig, was es heute heißt, jung und verliebt zu sein. Ungekürzte Lesung mit Lisa Hrdina 8h 27min
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Sally Rooney wurde 1991 geboren, ist in Castlebar, County Mayo, aufgewachsen und lebt in Dublin. Ihre frühen Arbeiten sind erschienen in The New Yorker, Granta, The White Review, The Dublin Review, The Stinging Fly, Kevin Barrys Stonecutter und der Anthologie Winter Pages. Sie studierte am Trinity College Dublin, zunächst Politik, machte dann ihren Master in Literatur. Sie war dort 2013 die Nr. 1 bei den European University Debating Championships. Rooneys Debütroman »Gespräche mit Freunden« war Book of the Year in Sunday Times, Guardian, Observer, Daily Telegraph und Evening Standard. Der Roman kam auf die Shortlist des Sunday Independent Newcomer of the Year Award 2017, des International Dylan Thomas Prize und des Rathbones Folio Prize 2018. Rooney war die Gewinnerin des Sunday Times/Peters Fraser & Dunlop Young Writer of the Year Award 2017, den u.a. auch Zadie Smith und Sarah Waters gewannen. Rooney ist inzwischen Redakteurin des irischen Literaturmagazins The Stinging Fly. Ihr zweiter Roman »Normale Menschen« wurde für den Man Booker Prize 2018 nominiert und gewann u.a. den Costa Novel Award, den An Post Irish Novel of the Year Award und den British Book Award (Novel of the Year und Book of the Year).
Produktdetails
- Verlag: Der Hörverlag
- Gesamtlaufzeit: 508 Min.
- Erscheinungstermin: 17. August 2020
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783844540109
- Artikelnr.: 59422621
Perlentaucher-Notiz zur FAS-Rezension
Auch der zweite Roman von Sally Rooney, in dem es um die Liebe zweier College-Studenten geht, über Klassengrenzen hinweg, und ein Leben im intellektuellen Rausch, hat Rezensentin Miryam Schellbach begeistert: Die Verliebten sind über die Verhältnisse zwar vollkommen aufgeklärt, wie sie mit hochgeistigen Dialogen auch immer wieder kundtun, dem Aufeinanderprallen ihrer beiden Welten aber dennoch schonungslos ausgeliefert, erzählt die amüsierte Kritikerin. Für sie gelingt es Rooney in Perfektion, Literatur zu schreiben, die den Nerv der Zeit trifft: "Serialität, Dialogbasiertheit, ein ironischer Aufruf von Bekanntem" und schematische Figuren sorgen für eine leichte Lektüre, die dennoch insgeheim eine solche zeitdiagnostische Schärfe transportiert, dass sie im Gedächtnis bleibt, lobt Schellbach.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Süffig, klug und absolut klischeefrei« Ijoma Mangold / DIE ZEIT
Broschiertes Buch
„Normale Menschen“ ist ein Roman von Sally Rooney. Da mich der Klappentext sehr angesprochen hat, war ich wirklich neugierig auf das Buch.
In der Geschichte geht es um Marianne und Connell, die in einer Kleinstadt im Westen Irlands aufwachsen und über Jahre hinweg eine …
Mehr
„Normale Menschen“ ist ein Roman von Sally Rooney. Da mich der Klappentext sehr angesprochen hat, war ich wirklich neugierig auf das Buch.
In der Geschichte geht es um Marianne und Connell, die in einer Kleinstadt im Westen Irlands aufwachsen und über Jahre hinweg eine On-Off-Beziehung führen. Beide Charaktere wirkten auf mich sehr distanziert, ich fand die Beziehung der beiden eher toxisch und konnte ihre Handlungsweisen manchmal überhaupt nicht nachvollziehen.
Sehr gut gefallen hat mir, dass viele ernste Themen im Buch angesprochen wurden. Diese wurden sehr gut und interessant beschrieben. Leider hatte die Geschichte selbst nicht wirklich einen Spannungsbogen und manche Stellen waren mir etwas zu langatmig.
Der Schreibstil der Autorin ist gewöhnungsbedürftig. Es gibt keine Kennzeichnung der wörtlichen Rede und man muss so sehr genau lesen, wann jemand spricht oder nicht. Dadurch hatte ich anfangs Schwierigkeiten, überhaupt in die Geschichte zu kommen. Auch war mir der Schreibstil etwas zu emotionslos, monoton und sachlich gehalten. Ich hatte überhaupt keine Chance, eine Verbindung zu den Charakteren herzustellen. Alles wirkte sehr distanziert und eintönig.
„Normale Menschen“ von Sally Rooney konnte mich leider nicht komplett überzeugen. Insgesamt hat es mir an Tiefe gefehlt und ich fand die Geschichte sehr deprimierend.
Bewertung: 2,5/5 ⭐️
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Connell und Marianne wachsen zusammen in einer Kleinstad im Westen von Irland auf. Aber das ist auch schon das einzige was sie gemeinsam haben. Connell ist sehr beliebt in der Schule und Marianne eher eine Aussenseiterin ohne Freunde. Doch eines Tages verändert ein Gespräch zwischen ihnen …
Mehr
Connell und Marianne wachsen zusammen in einer Kleinstad im Westen von Irland auf. Aber das ist auch schon das einzige was sie gemeinsam haben. Connell ist sehr beliebt in der Schule und Marianne eher eine Aussenseiterin ohne Freunde. Doch eines Tages verändert ein Gespräch zwischen ihnen ihr Verhältnis zueinander. Nur Connell möchte nicht das andere von seiner Zuneigung zu ihr erfahren. An der Uni treffen beide sich wieder: doch da ist dann plötzlich Marianne die Beliebte an der Schule und Connell der Außenseiter...
Das Besondere an der Geschichte von Connell und Marianne ist wohl, dass sie etwas Tiefes verbindet, was keiner von beiden so recht auszusprechen vermag und sie sich immer wieder begegnen ohne voneinander los zu kommen. Es ist eine Geschichte von zwei ganz normalen Menschen, die jeweils ihr Päckchen zu tragen haben, ohne dabei besonders hervor zu stechen.
Mir hat besonders die Erzählweise der Geschichte gefallen und das es hier um die Anziehung zweier Menschen geht, die tief miteinander verbunden sind und dennoch nie richtig zusammen kommen können. Als Leser weiß man manchmal selber nicht was für die beiden das Beste ist, ob sie doch endlich zusammen oder voneinader los kommen sollten.
Die Autorin hat einen sehr detaillierten Schreibstil ohne dabei je ins Belanglose zu rutschen. Ich hab beim Lesen gar nicht gemerkt wie schnell die Kapitel weg gelesen waren.
Jeder der an authenthischen Charakteren und (Liebes)Geschichten ohne große Romanze, aber mit ernsthaften und aus dem Leben gegriffenen Themen Interesse hat, sollte sich das Buch "Normale Menschen" unbedingt ansehen
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Gegen Gefühle kann man nichts tun und was daraus wird, dazu gehören zwei
Da ist Marianne, reiches Elternhaus, aber in der Schule immer außen vor und dann gibt’s da Connell, der Sportstar der Schule, eingebunden und überall beliebt und seine Mutter ist Putzfrau bei …
Mehr
Gegen Gefühle kann man nichts tun und was daraus wird, dazu gehören zwei
Da ist Marianne, reiches Elternhaus, aber in der Schule immer außen vor und dann gibt’s da Connell, der Sportstar der Schule, eingebunden und überall beliebt und seine Mutter ist Putzfrau bei Mariannes Familie. Zwei total verschiedene Leben und trotzdem, man nimmt sich wahr, aber zeigen darf man das natürlich nicht. Schließlich wird man doch ein Paar, zumindest zeitweise, mal mehr, mal weniger. Marianne und Connell machen es sich nicht leicht, vielleicht kann man auch sagen, sie haben es nicht leicht. Da ist die Gesellschaft, in der sie leben und der selbst aufgebaute Druck, die Spielregeln bedienen zu müssen, die sie als Paar meinen, nicht erfüllen zu können und dann ist da natürlich die Gegebenheit, Erwachsenwerden ist gar nicht so leicht, zu zweit vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es hat mich einfach mitgenommen auf eine Reise, die Leben heißt, Leben zu zweit oder eben auch nicht. Und ein Ende findet so etwas nie.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Als Connell klingelt, macht Marianne die Tür auf. Sie trägt immer noch ihre Schuluniform, aber ohne den Sweater, also nur Bluse und Rock, und sie hat keine Schuhe an, nur Strümpfe.
Oh, hey, sagt er.
Komm rein.
Sie dreht sich um und geht den Flur runter. Er folgt ihr, …
Mehr
„Als Connell klingelt, macht Marianne die Tür auf. Sie trägt immer noch ihre Schuluniform, aber ohne den Sweater, also nur Bluse und Rock, und sie hat keine Schuhe an, nur Strümpfe.
Oh, hey, sagt er.
Komm rein.
Sie dreht sich um und geht den Flur runter. Er folgt ihr, schließt hinter sich die Tür.“
Marianne und Connell besuchten die gleiche Schule in einer irischen Kleinstadt und das Trinity College in Dublin, beide sind sehr intelligent und verliebt ineinander. Doch nicht nur im Hinblick auf ihre soziale Herkunft sind sie grundverschieden. Auch ihre Beziehungen zu anderen Jugendlichen in der Schule und auf dem College sind unterschiedlich. Connell hat nur während der Schulzeit viele Freunde. Marianne ist in ihrer Schulzeit eine Einzelgängerin und oft dem Mobbing ausgesetzt. Auf dem College wendet sich das Blatt für beide.
Sally Rooney erzählt in ihrem Roman „Normale Menschen“ die Geschichte von Connell und Marianne und ihrer On-Off-Beziehung. Die Autorin hat einen sehr schönen und detaillierten Schreibstil. Auf den ersten hundert Seiten möchte man jedoch manchmal das Buch zur Seite legen. Es passiert inhaltlich nicht sehr viel. Am Ende bleibt mir nur folgendes zu sagen: Es ist ein sprachlich fantastisch geschriebenes Buch, es fällt leicht, sich in die einzelnen Situationen hineinzuversetzen, jedoch entstand am Ende nichts Bleibendes. Man macht das Buch zu und das wars. Schade
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Normale Menschen“ von Sally Rooney ist ein wundervoller Roman über das Erwachsenwerden und die Bedeutung von Freundschaft. Die Autorin schafft es die Protagonisten ehrlich, unverfälscht und mit Ecken und Kanten darzustellen, so bekommt der Leser den Eindruck von echten …
Mehr
„Normale Menschen“ von Sally Rooney ist ein wundervoller Roman über das Erwachsenwerden und die Bedeutung von Freundschaft. Die Autorin schafft es die Protagonisten ehrlich, unverfälscht und mit Ecken und Kanten darzustellen, so bekommt der Leser den Eindruck von echten Menschen zu lesen. Der Titel ist darum äußerst treffend. Wer eine klassische Liebesgeschichte erwartet ist hier falsch, geht es doch um so viel mehr. Neben Themen wie Freundschaft, Liebe, Macht und Abhängigkeit, gibt es auch immer wieder philosophische Gedanken. Auch zeitliche Sprünge machen die Geschichte interessant. Besonders mochte ich den Schreibstil welcher sehr viel Wert auf Details legt, literarisch wertig erscheint und sich dennoch leicht und flüssig lesen lässt. Der Roman eignet sich für junge Menschen, wie auch für Erwachsene, für Frauen wie für Männer. Ich habe mich auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt und kann „Normale Menschen“ deshalb nur weiterempfehlen!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Im zweiten Roman von Sally Rooney „Normale Menschen“ geht es um die intensive On/Off-Liebesgeschichte von dem ungleichen Paar Marianne und Connell.
Beide leben in derselben Kleinstadt in Irland. Wachsen allerdings in sehr verschiedenen Verhältnissen auf. Marianne kommt aus einer …
Mehr
Im zweiten Roman von Sally Rooney „Normale Menschen“ geht es um die intensive On/Off-Liebesgeschichte von dem ungleichen Paar Marianne und Connell.
Beide leben in derselben Kleinstadt in Irland. Wachsen allerdings in sehr verschiedenen Verhältnissen auf. Marianne kommt aus einer wohlhabenden, aber wenig liebevollen Familie. In der Schule ist sie eine seltsame Außenseiterin, wird von ihren Mitschülern gemobbt und findet keinen Anschluss. Connell hingegen, ist sehr beliebt in der Schule, lebt aber in eher bescheideneren Verhältnissen bei seiner jungen alleinerziehenden Mutter.
Als sie gemeinsam an die Universität wechseln ändern sich die Verhältnisse, plötzlich ist Marianne die schöne, beliebte Studentin, die es leicht hat und Connell wird zum Außenseiter.
Was bleibt sind trotz der großen Machtgefälle und des nicht enden wollenden Beziehungschaos, eine nicht immer einfache, aber innige Freundschaft.
Die Geschichte wird über mehrere Jahre in verschiedenen Zeitsprüngen erzählt. Man erlebt sie abwechselnd aus Marianne‘s bzw. Connell‘s Perspektive.
Am Anfang fand ich das Buch etwas fade, im mittleren Teil nahm es dann an Fahrt auf, was sich aber für mich am Ende wieder etwas verloren hat. Die Autorin verläuft sich etwas in dem auf und ab der asymmetrischen Beziehung der Protagonisten. Stattdessen hätte sie meines Erachtens die wirklich spannenderen Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Gewalt in Familien und Beziehungen oder psychische Probleme stärker ausarbeiten können. Diese Themen reißt sie nur an, dadurch bleiben alle Figuren insgesamt in ihrer Entwicklung eingeschränkt.
Die Darstellung der Gefühlswelten wirken allerdings nicht überzogen. Nur die Beweggründe und Kommunikationsprobleme hätten für mich einfach besser herausgearbeitet werden können.
Ich glaube ein paar mehr Seiten hätten einfach der Geschichte besser getan um sie genauer zu beleuchten und auszuarbeiten. Die Autorin hat einen einfachen, schnörkellosen Schreibstil, der sich leicht und flüssig liest, ohne dabei allerdings herauszustechen.
Allerdings muss man sich sicherlich an das wirklich ungewöhnlichste Element in diesem Buch gewöhnen. Sämtliche Dialoge fließen einfach im Text ein, das heißt sie werden nicht mit Anführungseichen oder anderweitig gekennzeichnet.
Abschließend ist der Roman „Normale Menschen“ sicherlich ein moderner Liebesroman ohne ins kitschige abzugleiten, bleibt aber einfach zu oberflächlich um mich zu berühren.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Normale Menschen ist – obwohl mehrfach ausgezeichnet und angepriesen – ein gewöhnungsbedürftiges und kein normales Buch. Schon die Schreibweise: Viel wörtliche Rede, aber ohne Kennzeichnung, d.h. man muss immer ein wenig raten, ob gerade tatsächlich jemand (wer?) zu …
Mehr
Normale Menschen ist – obwohl mehrfach ausgezeichnet und angepriesen – ein gewöhnungsbedürftiges und kein normales Buch. Schon die Schreibweise: Viel wörtliche Rede, aber ohne Kennzeichnung, d.h. man muss immer ein wenig raten, ob gerade tatsächlich jemand (wer?) zu jemandem (wem?) etwas sagt, oder das geschriebene nur erzählt oder gedacht wird. Auch die Zeitsprünge im Erzählverlauf sind gewöhnungsbedürftig und anstrengend: Jedes Kapitel beginnt zwar mit einer klaren Datumsangabe, z.B. Mai 2011, zwei Monate später (manchmal auch: fünf Minuten später), trotzdem ist es kein kontinuierliches Erzählen und es finden sich innerhalb der einzelnen Kapitel mehrfache Rückblicke und Überblenden. Kunstvoll gestrickt ist das sicherlich, aber zum Lesen anstrengend.
Dann die Erzählung: Es werden die ersten Jahre zwischen dem Schulabschluss und dem ersten Studienabschluss aus Sicht von zwei Personen erzählt und ja, es zielt darauf, sie in diesen Jahren zu vermeintlich „normalen“ Menschen wachsen zu lassen. Aber ist es wirklich normal, dass sie als Halbwaise in einem reichen aber gewalttätigen Haushalt lebt, in der Schule absolute Außenseiterin ist und im Studium zur Partymaus wird - er offensichtlich sehr arm mit seiner alleinerziehenden Mutter gerade so über die Runden kommt, in der Schulzeit in seinem Freundeskreis integriert ist und sich dann im Studium in Depressionen und Einsamkeit verliert? Ist es normal, dass beide Personen sich als hochbegabt herausstellen, während der ersten Semester kaum zu lernen scheinen und trotzdem sehr begehrte Stipendien ergattern? Ist es normal, dass das einzige was erzählt wird ein Nacheinander von Party, Drogen, Sex und (sexualisierte) Gewalt ist und sich das Ganze dann wieder und wieder wiederholt? Mehr passiert wirklich nicht und auch das Ende, die weitere Entwicklung bleibt völlig offen.
Insgesamt also eher ein deprimierendes Buch, man hofft und wünscht allen jungen Erwachsenen, dass ihr Erwachsenwerden nicht so verläuft, sondern viel mehr Bestätigung, Anerkennung und Wertschätzung enthält.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für