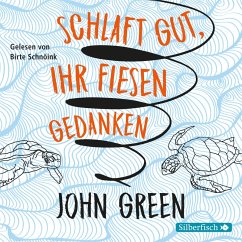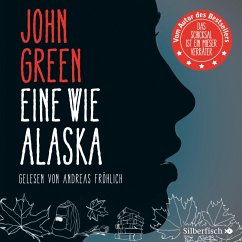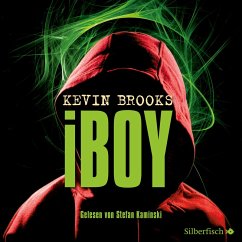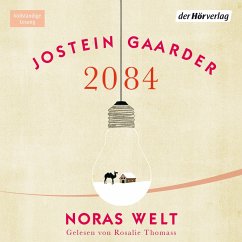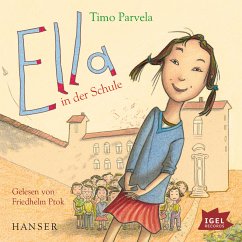Rolf Lappert
Hörbuch-Download MP3
Pampa Blues (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 286 Min.
Sprecher: Stadlober, Robert

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!





Der 16-jährige Ben sitzt in dem verschlafenen Nest Wingroden fest. Vielleicht wäre er schon längst weg - wenn er sich nicht um seinen Großvater kümmern müsste. Immerhin will sein Freund Maslow Wingroden zu einer Touristenattraktion machen. Seine jüngste Idee: gestrandete Ufos. Als die junge Lena mit ihrer Kamera für eine Reportage aufkreuzt, scheint der Plan zu funktionieren. Doch Lena ist gar keine Journalistin - und Ben ist verliebt. Als Lena plötzlich verschwindet, macht er sich Hals über Kopf auf die Suche nach ihr ...
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Rolf Lappert, 1958 in Zürich geboren, lebt in der Schweiz. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker, war Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeitete viele Jahre als Drehbuchautor. Sein Roman Nach Hause schwimmen wurde mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Mit Pampa Blues wurde 2012 sein erstes Jugendbuch veröffentlicht.
Produktdetails
- Verlag: Silberfisch
- Altersempfehlung: ab 12 Jahre
- Erscheinungstermin: 22. Februar 2012
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783844905991
- Artikelnr.: 35275009
 buecher-magazin.deBen hat es satt. Als Teenager gestrandet in einem öden Kaff, gefesselt an seinen pflege-bedürftigen Opa Karl, vernachlässigt von seiner ständig tourenden Musiker-Mutter, scheint ihm seine Jugend unwiderruflich zu entgleiten. Sein Sozialleben ist auf eine schrullige, bierselige Männergesellschaft beschränkt. Bis sein idealistischer Freund Maslow plant, den Flecken Wingroden durch eine fingierte Ufo-Sichtung wieder auf die Landkarte des wahren Lebens zu bringen. Eine junge Journalistin, die bei ihnen strandet, kommt da gerade recht.
buecher-magazin.deBen hat es satt. Als Teenager gestrandet in einem öden Kaff, gefesselt an seinen pflege-bedürftigen Opa Karl, vernachlässigt von seiner ständig tourenden Musiker-Mutter, scheint ihm seine Jugend unwiderruflich zu entgleiten. Sein Sozialleben ist auf eine schrullige, bierselige Männergesellschaft beschränkt. Bis sein idealistischer Freund Maslow plant, den Flecken Wingroden durch eine fingierte Ufo-Sichtung wieder auf die Landkarte des wahren Lebens zu bringen. Eine junge Journalistin, die bei ihnen strandet, kommt da gerade recht.Lapperts Versuchsanordnung ist alles andere als neu, vor allem der internationale Film („Gilbert Grape“) hat Ähnliches bereits vorzüglich ausgeleuchtet. Doch ist es auch eine Konstellation, die – leicht variiert – immer wieder Spaß macht und auch hier für vergnügliche Stunden sorgt. Hinzu kommt, dass Bens Erwachen aus dem seelischen Winterschlaf ziemlich gut gelungen ist. Robert Stadlober brennt nicht eben ein sprachliches Feuerwerk ab. Sein zurückhaltender, leicht genervter Tonfall passt aber durchaus zum desillusionierten Ich-Erzähler und lässt viel akustischen Raum für die spätere Verwandlung.
© BÜCHERmagazin, Dirk Speckmann (ds)
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Nach der Lektüre von "Pampa Blues" stellt Rezensent Tobias Rüther fest, dass Rolf Lappert auch als Jugendbuchautor reüssiert. Allerdings ist sich der Kritiker gar nicht so sicher, dass dieses Buch ausschließlich an Jugendliche gerichtet ist, denn die Geschichte um den sechzehnjährigen Ben, der ganz auf sich allein gestellt in der norddeutschen Provinz seinen Großvater pflegt und schließlich versucht, mit der älteren Lena der Ödnis zu entfliehen, erscheint Rüther zunächst als kluge Geschichte über Demenz. Darüber hinaus liest der Rezensent hier eine etwas zu detailreich und nostalgisch ausgeführte, aber dennoch eindringliche Schilderung über das Leben in einem sterbenden Dorf.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Dieses Buch ist ein ganz großes kleines literarisches Kunstwerk. Das heißt aber nicht, dass hier nur Leser angesprochen werden sollen, die anspruchsvolle Texte suchen. Ganz im Gegenteil, es wäre wunderbar, wenn sich viele junge Leser in Ben, dessen Geschichte hier erzählt wird, mit ihren geheimsten Sehnsüchten wiederfinden könnten. Ben lebt in der Provinz, und das meint in einem total verschlafenen Nest am Ende der Welt. Dieses Schicksal wünscht man jungen Leuten nicht unbedingt, und zu allem Überfluss lebt er dort mit seinem schwer dementen Großvater zusammen, der versorgt und umsorgt werden muss. Aber Ben ist ein junger Mann zum Verlieben - junge Mädchen sollten ihn als Vorbild für die zukünftigen Väter ihrer Kinder wählen -, denn er
Mehr anzeigen
meistert seine Aufgabe mit liebender Großmut, und wer von den Jungs, die man so kennt, hat schon diese Qualität zu bieten? Vielleicht mehr, als man denkt, man muss dies nur an ihnen entdecken können, und genau das gelingt dem Autor dieses einzigartig menschlich erwärmenden Buches. Man darf sich nicht täuschen lassen, wenn im Klappentext von Ufos die Rede ist, und schon gar nicht davon, dass es um die Monotonie des Alltags in einem Dorf geht, das alles ist lediglich Kulisse. In Wahrheit geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die Wahrheit des Lebens, und das in einer Sprache, dass man jeden Satz gerne mehrmals lesen möchte und dass man Ben und seine Freunde sehr gerne persönlich kennen lernen würde, um mit ihnen zusammen Ufos zu bauen und zu beobachten und sich dabei köstlich zu amüsieren über die Gutgläubigkeit anderer, die man glücklich machen kann, und ein wenig daran verdienen kann - zum Leben braucht man schließlich auch Geld. Leben ist eben niemals trostlos, wenn man es in seine Hände nimmt und es selbst im Nirgendwo so gestaltet, dass es zum großen Glück werden kann. Gabriele Hoffmann (Leanders Leseladen, Heidelberg)
Schließen
"Die Coming-of-Age-Story eines Halbwaisen, der sich aus der Einöde in ein abenteuerliches Leben sehnt. ... Die anfängliche Trübsinnigkeit wird niemals vollständig überwunden, sie lässt jedoch Raum für Hoffnungen und Neuanfänge - so wie ein guter Blues sein sollte." Simon Broll, Spiegel Online, 13.02.12 "Lapperts Ben erzählt mit einer pointensicheren Lakonie und großer Zärtlichkeit. Ein mitreissender Roman mit Unterströmungen, einem reichen Geflecht an Motiven, die dem Text trotz wundersamem Happy End Abgründigkeit und Offenheit lassen." Christine Lötscher, Tages-Anzeiger, 13.02.12 "Rolf Lappert gelingt es, den lakonischen Realismus in eine leichte Schräglage zu bringen, nicht nur durch märchenhafte Zufälle, sondern auch durch den
Mehr anzeigen
anrührenden Grossvater, die kauzigen Dorfbewohner und eine Liebesgeschichte, die Ben aus seiner inneren Lähmung erlöst. Am meisten jedoch durch eine Sprache, in der es Sätze gibt wie diese: Ihre Zunge berührt meine Lippen. Nicht lange. Ein paar Sekunden. Tausend Jahre. Viel zu kurz." Sieglinde Geisel, Neue Zürcher Zeitung, 07.03.12 "Ein wunderschöner Jugendroman. ... Der Blues, den die Pampa in dem Buch entwickelt, hat seine eigene Resonanz - ja, seinen eigenen Drive. Diese Provinz vibriert." Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung, 04.04.12 "Wiederholt wurden Lapperts Romane mit John Irvings Erzählstil verglichen. Auch hier bietet der Autor eine Fülle skurriler Episoden; ihm gelingt das Porträt eines Heranwachsenden zwischen Laisser-faire und Sehnsucht und eine Liebesgeschichte, die diesen ermutigt, seinen eigenen Weg zu gehen." Hans ten Doornkaat, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 05.02.12 "Lesenswert." Björn Wirth, Frankfurter Rundschau, 13.03.12 "Dem Autor gelingt es, die Geschichte immer in der Schwebe zu halten, irgendwo zwischen Trauer, Galgenhumor, Melancholie und plötzlichen Hoffnungsschimmern." Hartmut el Kurdi, Die Zeit, 06.06.2012 "Ein Entwicklungsroman der besonderen Art." Hilde Elisabeth Menzel, Süddeutsche Zeitung, 14.12.12
Schließen
Broschiertes Buch
In dem Buch geht es um Ben. Er wohnt in einem Kaff am Arsch der Welt und dümpelt dort so vor sich hin, versorgt nebenbei den debilen Großvater und macht eine Ausbildung. Ein Tag ist wie der andere, bis ein Mädchen auftaucht und Bens Leben völlig auf den Kopf stellt. Dann setzt …
Mehr
In dem Buch geht es um Ben. Er wohnt in einem Kaff am Arsch der Welt und dümpelt dort so vor sich hin, versorgt nebenbei den debilen Großvater und macht eine Ausbildung. Ein Tag ist wie der andere, bis ein Mädchen auftaucht und Bens Leben völlig auf den Kopf stellt. Dann setzt der Besitzer der Pension eine geheimnisvolle Idee in die Tat um, welche Touristen anlocken soll und nun ist im Dorf der Teufel los.<br />Das Buch hat mir super gefallen. Die Story ist lustig und zieht einen ins Geschehen. Man kann sich das Kaff mit den eigenartigen Leuten dort richtig gut vorstellen. Wie Ben immer wieder über sein Leben nachdenkt und insgeheim seine Mutter verflucht ist sehr gut nachvollziehbar. Ein richtig gutes Buch, dass jeder gelesen haben sollte!
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für