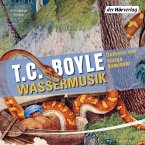Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

In ihrem neuen Roman "Quasikristalle" zerlegt Eva Menasse eine Frau in erstaunliche Einzelteile
Um den Titel eines Romans zu erklären, muss man meistens nicht besonders weit ausholen. In diesem Fall aber schon, in diesem Fall ist der Titel wichtig, und deshalb geht es zunächst ins spanische Granada.
Wer dort schon einmal die Alhambra besucht hat, dieses Meisterwerk, den Inbegriff islamischer Kunst, wird sie nicht mehr vergessen können, die Mosaike, die man dort sieht. Fünf Kachelvarianten verwendeten die arabischen Künstler, als sie im 13. Jahrhundert die Mosaike legten. Das aber erkennt man bei erster Betrachtung kaum, so harmonisch ist das Bild, das sie zusammengefügt miteinander ergeben. Seit einiger Zeit weiß die Wissenschaft, dass ein ähnliches Phänomen auch in der Natur zu finden ist: Durch ein Elektronenmikroskop erblickte ein israelischer Chemiker vor einigen Jahren eine Struktur, die harmonisch wirkte wie ein Kristall, jedoch keiner sein konnte, da dessen typische Struktur nicht zu sehen war. In Kristallen reihen sich in absoluter Perfektion Atome aneinander, deren Muster sich mit exakter Regelmäßigkeit wiederholt. Nicht so bei dem Stoff unter dem Elektronenmikroskop: Hier gab es keine Wiederholung eines Atommusters, dennoch eine große Harmonie.
Ganz ähnlich also, und damit noch mal kurz zurück nach Granada, wie bei den Mosaiken der Alhambra. Der Forscher nannte seine Entdeckung "Quasikristalle", 2011 wurde ihm dafür der Chemie-Nobelpreis verliehen. Und "Quasikristalle" heißt auch der neue Roman von Eva Menasse. Man sollte den Hintergrund dieses Titels im Kopf behalten, wenn man ihn aufschlägt und nicht mehr aufhören kann zu lesen, weil man das nächste Mosaiksteinchen aufheben will.
Die Frau, um die der Roman kreist, heißt Xane Molin. Wir lernen sie als 14 Jahre alte Schülerin kennen, barfuß, braungebrannt und unbekümmert im Haus und Garten ihrer besten Freundin Judith herumtollend, bei der sie die letzten Ferientage dieses Sommers verbringt - ein dramatisches Ereignis wird den schönen Tagen ein jähes Ende bereiten. Als Nächstes begegnet uns Xane als blutjunge Studentin wieder, sie feiert Partys, bezieht in Wien ihre erste eigene Wohnung, aus der sie irgendwann ihren Verlobten rausschmeißt. Sie geht nach Berlin, heiratet, ist nun Professorengattin, Patchworkmutter und Besitzerin einer aufstrebenden Werbeagentur. Einige Jahre später, mit Ende dreißig, will sie mit Hilfe der Medizin ein Kind bekommen, bevor es endgültig zu spät dafür ist. Sie wird Mutter eines Sohnes, er wächst zu einem Teenager heran. Schließlich, die Kinder sind längst aus dem Haus und haben inzwischen eigene, treffen wir sie als alte Frau wieder, die nach dem Tod ihres Mannes ihrem Leben noch einmal eine neue Richtung geben will. So weit die Kurzversion.
Die Augen der anderen
Tatsächlich breitet Eva Menasse Xane Molins ganzes Leben vor uns aus, und das könnte schrecklich langweilig sein. Ist es aber nicht, denn die Autorin erzählt aus vielen Perspektiven und lässt die Menschen zu Wort kommen, denen Xane in den unterschiedlichen Phasen ihres Lebens begegnet ist. Durch deren Augen lernen wir Xane kennen: durch die Augen eines Angestellten in ihrer Werbeagentur etwa, dem Xane als Chefin gerade die Kündigung nahegelegt hat; durch die Augen der pubertierenden Stieftochter Viola, die überzeugt ist, dass Xane ihren Mann betrügt, eine Affäre hat.
Die Ärztin wiederum, eine Spezialistin für künstliche Befruchtung, zu der Xane wegen ihres unerfüllten Kinderwunsches geht, mag ihre Patientin gern, weil sie ihre Emotionen unter Kontrolle hält. Ganz anders sieht das der Bürgerkriegsflüchtling Nelson, der in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof als Zeuge aussagen soll und der sich, nachdem er ihr zufällig in Berlin begegnet, in Xane verliebt. Sie sei eine Frau, denkt er nach ihrem ersten Treffen, die "beim zweiten und dritten Blick schöner wurde, so dass man sich über den eigenen ersten, den flüchtigen, beinahe zu ärgern begann". Auch der Vermieter von Xanes Wiener Wohnung hat eine Meinung über sein "Molinchen", obwohl er sie nur von kurzen Gesprächen beim Unkrautjäten und von Beobachtungen im Treppenhaus kennt. Er sagt: "Wiedersehen möchte man sie eigentlich nicht mehr."
Eva Menasse wirft nur Schlaglichter auf diese Leute, deren Weg Xane im Laufe ihres Lebens kreuzt. Dennoch treten die Konturen ihres Tun und Denkens dabei so scharf hervor, dass man versteht, warum jeder von ihnen etwas anderes in ihr zu erkennen glaubt und worin die unterschiedlichen Empfindungen und Erwartungen begründet liegen. Sicherlich, die Urteile, die sie fällen, mögen für sich genommen einseitig sein. Falsch aber sind sie nicht. Die Wahrheit, zumindest ein Stück von ihr, schwingt immer mit. Oft kommt sie witzig und federleicht daher, dann wach und bitter.
Und so weiß man nach jeder Episode, die Eva Menasse in einzelne Kapitel gliedert, ein bisschen mehr. Wie Mosaiksteine, die für sich genommen sehr verschieden sind, fügen sich die Beobachtungen zu einem Bild, einem Quasikristall zusammen: daher der Titel. Immer deutlicher wird diese Frau namens Xane Molin in ihm sichtbar. Mit all den liebenswerten Seiten, die sie hat, und mit mindestens genauso vielen Macken. Xane ist sich keineswegs bewusst, dass sie die hat. Wie so viele Menschen verwechselt sie den eigenen Blick auf sich und die Welt mit dem der anderen.
Was wir von uns wissen
Eva Menasse stellt große Fragen in diesem Buch: Was bedeutet man anderen Menschen? Was wissen wir wirklich über uns selbst und was vom anderen? Wie stehen Außendarstellung und Selbstwahrnehmung zueinander? Welches Bild macht sich der andere von uns und wie verändert das seine Reaktion? Welche Begegnungen bleiben haften und verändern uns? Warum mögen uns manche Menschen und warum andere nicht? Aus einer flüchtigen Bekanntschaft kann Freundschaft werden, vielleicht auch Liebe; genauso kann aus einem guten Freund ein Fremder werden, den man irgendwann aus den Augen verliert. Die Erinnerung bleibt jedoch haften. Bewusst oder unbewusst bestimmt sie jede neue Begegnung mit. Und was ist das überhaupt, eine Begegnung?
Wie sehr die eigene Realität und die des anderen auseinanderklaffen können, zeigt am besten die Episode, in der Xane eine Bekannte aus Jugendtagen wiedertrifft. Es ist purer Zufall, Xane, beruflich schon ganz weit oben angekommen, ist auf einer Vernissage, als vor ihr auf der Toilette plötzlich Sally steht, die kleine Schwester von Judith, die Xane lange nicht gesehen hat.
Damals, als sie die letzten Tage des Sommers bei Judith verbrachte, war Sally in ihren Augen nur die nervende kleine Schwester. Jetzt jobbt Sally in Berlin auf Abendveranstaltungen als Kellnerin, ist alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter, von der sie Xane aber nichts erzählt. Denn Xane überfällt Sally mit einer Begeisterung und Hilfsbereitschaft, die auf die Jüngere erdrückend wirkt.
Für Xane, die ihrer Heimatstadt Wien nachtrauert, ist Sally die lang ersehnte beste Freundin. Für Sally hingegen ist Xane eine Spießerin, die nur um sich selbst kreist, die Freundschaften an- und ausknipst, je nachdem, ob sie sich gerade dunkel fühlt oder hell. Sally entfernt sich deshalb wieder von ihr. Jahre später wird sie mit einer anderen Freundin Xanes zusammensitzen und über sie lästern.
Xane Molin ist in gewisser Weise blind für ihre Umgebung. Anders gesagt: Sie sieht nur das, was sie sehen kann, so sehr ist sie in sich gefangen. Hat man das einmal erkannt, stellt man ganz unwillkürlich auch die eigene Wahrnehmung in Frage. Es geht in dem Roman um Xane Molin, letztendlich aber auch um jeden selbst.
KAREN KRÜGER
Eva Menasse: "Quasikristalle". Kiepenheuer & Witsch, 432 Seiten, 19,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH