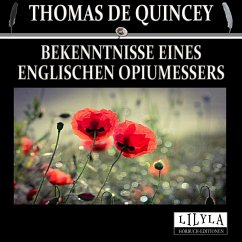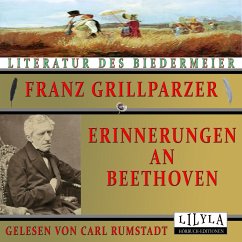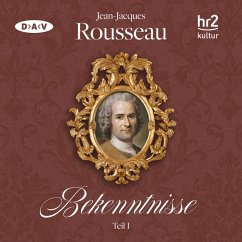Roppongi (MP3-Download)
Requiem für einen Vater Ungekürzte Lesung. 282 Min.
Sprecher: Winkler, Josef
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
17,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!
"Auch Raudis zweitbeste Freundin, die Leichenbestatterin Stimniker mit den überlangen roten über die Kuppe hinausgewachsenen Fingernägeln, soll einmal bei Kuchen und Kaffee in der Feistritzer Dorfkonditorei, als der Holzkuckuck lauthals seinen Kopf als anrüchiges Dorfvögelchen aus der Kuckucksuhr reckte und alle Tortenesser ihre Köpfe zum Kuckucksuhrwinkel verdrehten, gedroht haben: ,Wenn er noch einmal über uns etwas schreibt, dann zeig ich ihn an!'" Josef Winklers Themenwelt kreist um ländliche Kindheit, Erinnerungen an geliebte und ungeliebte Personen, deren Obsessionen, die eigene ...
"Auch Raudis zweitbeste Freundin, die Leichenbestatterin Stimniker mit den überlangen roten über die Kuppe hinausgewachsenen Fingernägeln, soll einmal bei Kuchen und Kaffee in der Feistritzer Dorfkonditorei, als der Holzkuckuck lauthals seinen Kopf als anrüchiges Dorfvögelchen aus der Kuckucksuhr reckte und alle Tortenesser ihre Köpfe zum Kuckucksuhrwinkel verdrehten, gedroht haben: ,Wenn er noch einmal über uns etwas schreibt, dann zeig ich ihn an!'" Josef Winklers Themenwelt kreist um ländliche Kindheit, Erinnerungen an geliebte und ungeliebte Personen, deren Obsessionen, die eigene Wahrnehmung und Beobachtung der Welt und natürlich - den Tod.. hr2-Hörbuchbestenliste mit Dhrupad-Musik von Dr. Ritwik Sanyal
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.