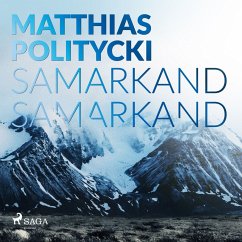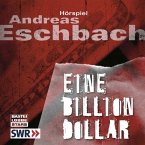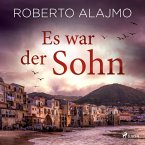Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Unser Mann in Usbekistan: Matthias Polityckis Roman "Samarkand, Samarkand" beschwört eine orientalische Apokalypse des Jahres 2027
Samarkand, die alte Handelsmetropole an der Seidenstraße, die Tamerlan im vierzehnten Jahrhundert zur Hauptstadt seines Reichs machte, birgt Kunstschätze und Architekturdenkmäler, die zum Weltkulturerbe zählen: Gur-Emir, das Mausoleum der Timuriden, die Nekropole Shah-i-Sinda oder die Bibi-Chanym-Moschee. Als Matthias Politycki Samarkand 1987 zum ersten Mal besuchte, empfand er das Märchen aus Tausendundeiner Nacht eher als Albtraum. Hässliche, "unorientalisch unbunte" Plattenbauten und Industrieruinen überwucherten die sagenhaften Kacheln, Kuppeln und Minarette. Spitzel und Zivilpolizisten, Straßensperren und Schießereien machten die sowjetische Tristesse noch ungemütlicher, und selbst die traditionelle Gastfreundschaft war getränkt mit unverhohlener Verachtung.
Matthias Politycki hat sich immer wieder, zuletzt in seinem Kuba-Roman "Der Herr der Hörner", von archaischen Mythen, grausamen Ritualen und dem abblätternden Talmiglanz der Exotik faszinieren lassen. Aber in dem brodelnden Pulverfass zwischen Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan entdeckte er schon damals, lange vor dem 11. September, die Konfliktlinien einer neuen Weltordnung. Die Begegnung mit den Erben von Dschingis Khan und Tamerlan - grausame Warlords und korrupte Apparatschiks, aber auch weise Schamanen und Wanderderwische, Schaschlikbrater und erzählkundige Hirten - stellte nicht nur sein abendländisch geordnetes Weltbild in Frage, sondern auch die Grundlagen seines Schreibens. Die avantgardistisch-experimentelle Prosa, mit der er 1987 die literarische Bühne betreten hatte ("Aus Fälle/Zerlegung des Regenbogens"), erschien ihm als müßige Spielerei: Wen interessiert die Farbe der Vokale, wenn die Gegenwart grau und die Zukunft schwarz ist?
Die "Perle der Seidenstraße" ist heute von Touristen überlaufen, aber immer noch ein Pulverfass. Großmächte, Gotteskrieger, autoritäre Alleinherrscher und Clanchefs, Drogenschmuggler und Waffenhändler rangeln um Bodenschätze, Militärbasen, strategische Interessen, tragen religiöse und ethnische Konflikte aus und streichen kriminelle Extraprofite ein. In dem Roman, den Politycki sechsundzwanzig Jahre nach dem ersten Entwurf jetzt (ganz anders als ursprünglich geplant) doch noch vollendet hat, hat der Dritte Weltkrieg bereits begonnen. Das Setting erinnert an Christian Krachts apokalyptische Schweiz-Dystopie "Ich werde hier sein im Sonnenschein und Schatten".
Man schreibt das Jahr 2027. Deutschland ist Schauplatz erbitterter Kämpfe zwischen mittelasiatischen Dschihadisten und dem letzten Aufgebot des freien Westens. Die Goldene Horde der "Faust Gottes" steht bereits am Rhein; im Osten hat die Panslawische Allianz eine neue Mauer gegen den Mongolensturm errichtet. "Deutschländer", Truppen mit türkischem Migrationshintergrund, verteidigen unter Führung von Bundeskanzler Yalçin erbittert ihre Wahlheimat; in "Freien Festen" wie Landshut oder Wandsbek halten sich noch einige versprengte Ureinwohner. Einer von ihnen ist der Erzähler: Alexander Kaufner, der noch in der Nationalen Volksarmee der DDR ausgebildete Einzelkämpfer und Gebirgsjäger.
Kaufner wird von seinem Führungsoffizier mit einem heiklen Befehl nach Samarkand geschickt: Er soll das Grab Tamerlans und seine magische Marmormurmel aufspüren und zerstören, um so das "geheime Kraftzentrum der Faust Gottes auszuschalten". Der Auftrag ist eine mission impossible, ein abenteuerliches Himmelfahrtskommando wie in Joseph Conrads Reise ins "Herz der Finsternis" oder "Apocalypse Now". Die Freiheit Deutschlands, das ahnt auch Kaufner bald, wird weder am Hindukusch verteidigt noch im Serafschan-Gebirge. Fern der Heimat, alles andere als fest und frei, verliert der "Agent des Freien Westens" (und auch Politycki) sein Ziel immer mehr aus den Augen. Der letzte Deutsche ist furchtlos, neugierig und zäh, aber doch eine eher tragikomische Figur irgendwo zwischen Indiana Jones, Dan Browns kunsthistorischem Schnitzeljäger Robert Langdon und Kara Ben Nemsi. Kaufners Hadschi Halef Omar heißt übrigens Odina, aber der stolze Sohn der Berge ist kein treuer Diener und Führer, sondern ein Strichjunge und Verräter.
"Samarkand, Samarkand" ist so etwas wie ein Karl-May-Roman aus den Schluchten hinter dem Balkan. Kaufner, der ängstliche Abenteurer, ist ein Greenhorn auf fremden Pfaden, aber auch überzeugter Europäer. Er teilt mit Politycki das Alter und so manche Überzeugung, aber er ist vom fröhlichen Übermut des "Weiberromans" so weit entfernt wie vom ironischen Voyeurismus des Kreuzfahrt-Bordautors aus "In 180 Tagen um die Welt"; am nächsten steht ihm wohl der Banker, der im dionysischen Voodoozauber Kubas lustvoll seine zivilisatorische Contenance und Identität verlor.
Kaufner bleibt ein Fremder, ein Tourist und manchmal nur ein Don Quichotte. Er wandert durch Landschaften von rauher Schönheit und klettert über steile Eselspfade hinauf zu vergessenen Felsengräbern. Er begegnet Sufis und heiligen Männern, Ziegenhirten, Haschischessern, Halbstarken mit Kalaschnikows und Designerturnschuhen und sinistren Warlords wie General Feisulla, dem barbarischen Führer des Geheimbunds der Schwarzen Hammel, oder Januzak, dem "Sultan des Westens", der ihm zur Begrüßung erst mal in die Hand spuckt. Sein Schutzengel ist Shochi, die dreizehnjährige Tochter seiner Gastgeber, ein usbekisches Käthchen, das ihren Ritter mit unbeirrbarer Hingabe und traumwandlerischer Hellsicht begleitet.
Das "Gesetz der Berge" kennt keine Indizienbeweise. Der Erzähler staunt, befremdet, beglückt und zunehmend auch verrückt, aber er verweigert jede Erklärung. "Die Zeit war reif, den Himmel zusammenzufalten", aber der Berg lacht ihn nur aus. Erleuchtung und Wahnsinn, Grausamkeit und Poesie, Paradies und Hölle, Fata Morgana und Wirklichkeit liegen in "Samarkand Samarkand" nah beieinander, und manchmal leider auch existentielle Prüfungen und das verquaste Hemingway-Pathos männlicher Selbstbehauptung: "Kein Mensch, kein Tier, das Gott nicht am Schopfe hielte! Auch dich hält er fest und führt dich so lange, bis er dich erschlägt, begreif's ... Männer auf verlorenem Posten sind immer noch Männer. Je wirrer die Zeiten, desto gerader der Weg." So verirrt und verliert sich Kaufner, der Selbstmordattentäter der Freiheit, auf den Saumpfaden rund um Samarkand, bis er am Ende auf dem letzten Gipfel seinen Meister und vielleicht auch den Tod findet.
Ursprünglich wollte Politycki als fünftes Buch ein Foto des usbekischen Fotografen Max Penson einrücken, das er 2009 in Samarkand fand. Es zeigt einen alten Bergbewohner, in dessen gellendem Gelächter er Wahnsinn, Schmerzensschrei und Triumphgeheul wiederfand, den ganzen "Urschrecken" Europas vor Hunnen, Tataren und Mongolen. Politycki verzichtete dann auf Anraten des Verlags auf einen Abdruck; sein Roman endet daher so offen wie abrupt. Als politische Parabel ist er vielleicht gescheitert. Aber als Beschreibung europäischer Grenzerfahrungen zwischen dem "Leeren Berg" und dem "Tal, in dem nichts ist", kann er es jederzeit mit ähnlichen Projekten von Michael Roes bis Christoph Ransmayr aufnehmen. "Samarkand, Samarkand" ist eine wortgewaltige, orientalisch bunte Reise- und Abenteuererzählung, die bis zum Herzen der Finsternis vordringt.
MARTIN HALTER
Matthias Politycki: "Samarkand, Samarkand". Roman.
Verlag Hoffmann & Campe, Hamburg 2013. 399 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH