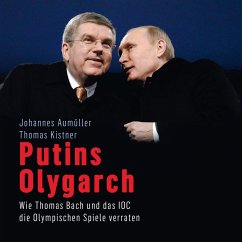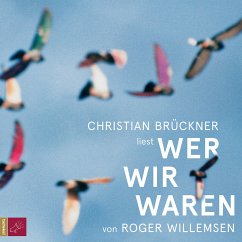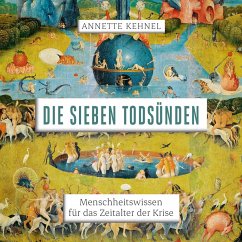Sensibel (MP3-Download)
Über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren Ungekürzte Lesung. 357 Min.
Sprecher: Dressler, Sonngard
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
12,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
Mehr denn je sind wir damit beschäftigt, das Limit des Zumutbaren neu zu justieren. Wo liegt die Grenze des Sagbaren? Ab wann ist eine Berührung eine Belästigung? Svenja Flaßpöhler tritt einen Schritt zurück und beleuchtet den Glutkern des Konflikts: die zunehmende Sensibilisierung des Selbst und der Gesellschaft. "Sensibel" ist ein hochaktuelles, philosophisches und gleichzeitig unterhaltsames Hörbuch, das die Sensibilität dialektisch durchleuchtet und zu dem Schluss kommt: Die Resilienz ist die Schwester der Sensibilität. Die Zukunft meistern können sie nur gemeinsam.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.