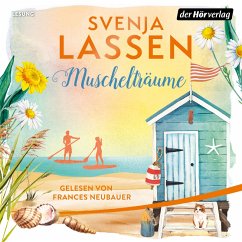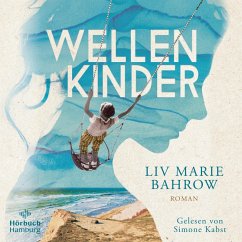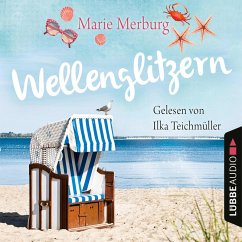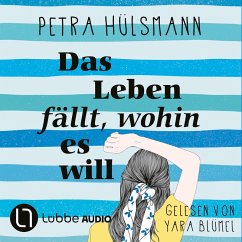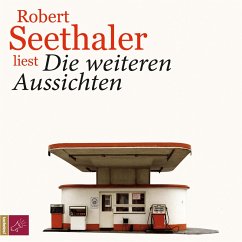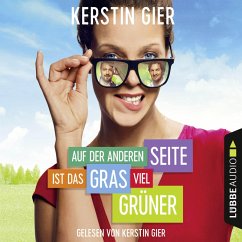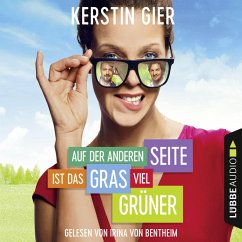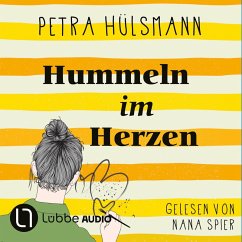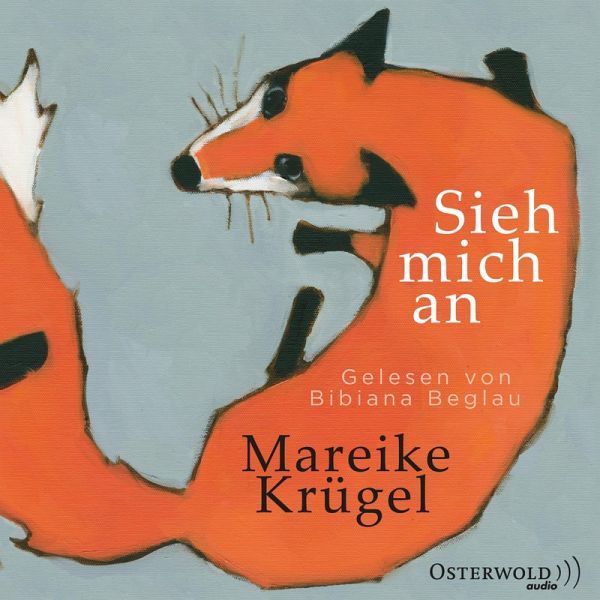
Sieh mich an (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 494 Min.
Sprecher: Beglau, Bibiana

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!
Man kann doch nicht einfach so verschwinden, wenn alles unklar ist. Das denkt Katharina, seit sie vor Kurzem das Etwas in ihrer Brust entdeckt hat. Niemand weiß davon, und das ist auch gut so. Denn an diesem Wochenende soll ein letztes Mal alles wie immer sein. Und so entrollt sich das Chaos eines ganz normalen Freitags vor ihr. Während sie aber einen abgetrennten Daumen versorgt, ihren brennenden Trockner löscht und sich auf den emotional nicht unbedenklichen Besuch eines Studienfreundes vorbereitet, beginnt ihr Vorsatz zu bröckeln, und sie stellt sich große Fragen: Ist alles so geworden...
Man kann doch nicht einfach so verschwinden, wenn alles unklar ist. Das denkt Katharina, seit sie vor Kurzem das Etwas in ihrer Brust entdeckt hat. Niemand weiß davon, und das ist auch gut so. Denn an diesem Wochenende soll ein letztes Mal alles wie immer sein. Und so entrollt sich das Chaos eines ganz normalen Freitags vor ihr. Während sie aber einen abgetrennten Daumen versorgt, ihren brennenden Trockner löscht und sich auf den emotional nicht unbedenklichen Besuch eines Studienfreundes vorbereitet, beginnt ihr Vorsatz zu bröckeln, und sie stellt sich große Fragen: Ist alles so geworden, wie sie wollte? Ihre Musik, ihre Kinder, die Ehe mit dem in letzter Zeit viel zu abwesenden Costas? Erst als der Tag fast zu Ende ist, beschließt sie, ihr Geheimnis zu teilen– mit jemandem, den sie tatsächlich liebt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.




 buecher-magazin.deNachdem Katharina ein "Etwas" in ihrer Brust ertastet hat, ist für sie nichts mehr wie vorher. Trotzdem geht um sie herum der ganz normale Alltagswahnsinn weiter: Katharina muss die Blutspuren ihrer elfjährigen Tochter aus dem Schulteppich entfernen, den abgetrennten Daumen ihres Nachbarn suchen und sich auf den emotional brenzligen Besuch eines Studienfreundes vorbereiten. Währenddessen zieht sie innerlich Bilanz und betrachtet ihr Leben aus der umgekehrten Perspektive, vom Ende her: die verschenkte Karriere als Wissenschaftlerin, ihre große Liebe, die jetzt in der Eheroutine zu ersticken droht, die Kinder. Und ihre Unfähigkeit, von sich selbst zu sprechen, mit der endlich Schluss sein muss. Mareike Krügel greift treffsicher hinein in den atemlosen Alltag der berufstätigen Mütter um die 40, wo zermürbende Routine und die großen Fragen des Lebens aufeinanderprallen. Das ist witzig und berührend, wenn auch etwas zu dick aufgetragen. Das Ganze liest Bibiana Beglau sehr artikuliert, ohne auch nur eine Silbe zu verschlucken. Für diesen tragisch-komischen Roman ist das etwas zu viel des Guten und nimmt der Geschichte etwas von ihrer Leichtigkeit.
buecher-magazin.deNachdem Katharina ein "Etwas" in ihrer Brust ertastet hat, ist für sie nichts mehr wie vorher. Trotzdem geht um sie herum der ganz normale Alltagswahnsinn weiter: Katharina muss die Blutspuren ihrer elfjährigen Tochter aus dem Schulteppich entfernen, den abgetrennten Daumen ihres Nachbarn suchen und sich auf den emotional brenzligen Besuch eines Studienfreundes vorbereiten. Währenddessen zieht sie innerlich Bilanz und betrachtet ihr Leben aus der umgekehrten Perspektive, vom Ende her: die verschenkte Karriere als Wissenschaftlerin, ihre große Liebe, die jetzt in der Eheroutine zu ersticken droht, die Kinder. Und ihre Unfähigkeit, von sich selbst zu sprechen, mit der endlich Schluss sein muss. Mareike Krügel greift treffsicher hinein in den atemlosen Alltag der berufstätigen Mütter um die 40, wo zermürbende Routine und die großen Fragen des Lebens aufeinanderprallen. Das ist witzig und berührend, wenn auch etwas zu dick aufgetragen. Das Ganze liest Bibiana Beglau sehr artikuliert, ohne auch nur eine Silbe zu verschlucken. Für diesen tragisch-komischen Roman ist das etwas zu viel des Guten und nimmt der Geschichte etwas von ihrer Leichtigkeit.