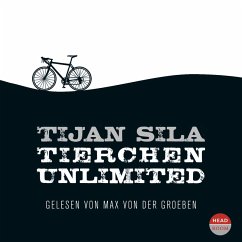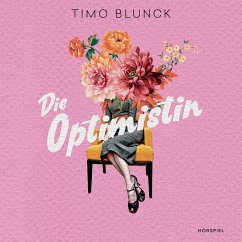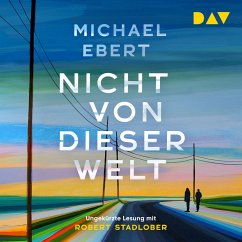So etwas wie Glück (MP3-Download)
Geschichten über die Liebe Ungekürzte Lesung. 486 Min.
Sprecher: Feifel, Martin / Übersetzer: Robben, Bernhard

PAYBACK Punkte
11 °P sammeln!
Die ganze Verletzlichkeit des Lebens in nur einem Moment. Was macht eine gute Beziehung aus? Was ist Liebe - und was nicht? John Burnsides Geschichten tauchen in das Leben von Männern und Frauen ein, die - in einer Ehe gefangen, gebeutelt von falschen Erwartungen, dem Alkohol verfallen - alles andere als ideale Paare verkörpern. Untreu, einsam, krank, begegnet man seinen Heldinnen und Helden bevorzugt nachts auf leeren Straßen. Von so etwas wie Glück können sie nur träumen, ihre Gefühle bleiben meist sprachlos. Und doch könnten sie unsere Nachbarn sein. Burnside ist einer der besten Ge...
Die ganze Verletzlichkeit des Lebens in nur einem Moment. Was macht eine gute Beziehung aus? Was ist Liebe - und was nicht? John Burnsides Geschichten tauchen in das Leben von Männern und Frauen ein, die - in einer Ehe gefangen, gebeutelt von falschen Erwartungen, dem Alkohol verfallen - alles andere als ideale Paare verkörpern. Untreu, einsam, krank, begegnet man seinen Heldinnen und Helden bevorzugt nachts auf leeren Straßen. Von so etwas wie Glück können sie nur träumen, ihre Gefühle bleiben meist sprachlos. Und doch könnten sie unsere Nachbarn sein. Burnside ist einer der besten Gegenwartslyriker und zugleich bemerkenswerter Essayist und Romancier. Mit dem vorliegenden Band lässt er sich nun erstmals in deutscher Sprache auch als Autor von Kurzgeschichten kennenlernen. Jede der zwölf Erzählungen der von ihm eigens zusammengestellten Auswahl zeigt die ganze Verletzlichkeit eines Lebens in nur einem Moment - und besitzt dennoch das Gewicht und die Dichte eines großen Romans.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.