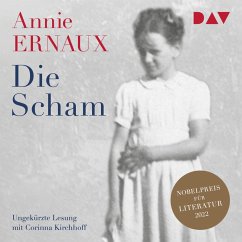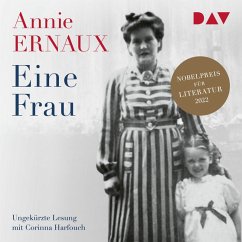Deniz Ohde
Hörbuch-Download MP3
Streulicht (MP3-Download)
Roman Ungekürzte Lesung. 524 Min.
Sprecher: Beyer, Marit

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!





Industrieschnee markiert die Grenzen des Orts, eine feine Säure liegt in der Luft, und hinter der Werksbrücke rauschen die Fertigungshallen, wo der Vater tagein, tagaus Aluminiumbleche beizt. Hier ist die Ich-Erzählerin aufgewachsen, hierher kommt sie zurück, als ihre Kindheitsfreunde heiraten. Und während sie die alten Wege geht, erinnert sie sich: an den Vater und den erblindeten Großvater, die kaum sprachen, die keine Veränderungen wollten und nichts wegwerfen konnten, bis nicht nur der Hausrat, sondern auch die verdrängten Erinnerungen hervorquollen. An die Mutter, dere...
Industrieschnee markiert die Grenzen des Orts, eine feine Säure liegt in der Luft, und hinter der Werksbrücke rauschen die Fertigungshallen, wo der Vater tagein, tagaus Aluminiumbleche beizt. Hier ist die Ich-Erzählerin aufgewachsen, hierher kommt sie zurück, als ihre Kindheitsfreunde heiraten. Und während sie die alten Wege geht, erinnert sie sich: an den Vater und den erblindeten Großvater, die kaum sprachen, die keine Veränderungen wollten und nichts wegwerfen konnten, bis nicht nur der Hausrat, sondern auch die verdrängten Erinnerungen hervorquollen. An die Mutter, deren Freiheitsdrang in der Enge einer westdeutschen Arbeiterwohnung erstickte, bis sie in einem kurzen Aufbegehren die Koffer packte und die Tochter beim trinkenden Vater ließ. An den frühen Schulabbruch und die Anstrengung, im zweiten Anlauf Versäumtes nachzuholen, an die Scham und die Angst – zuerst davor, nicht zu bestehen, dann davor, als Aufsteigerin auf ihren Platz zurückverwiesen zu werden.
Wahrhaftig und einfühlsam erkundet Deniz Ohde in ihrem Debütroman die feinen Unterschiede in unserer Gesellschaft. Satz für Satz spürt sie den Sollbruchstellen im Leben der Erzählerin nach, den Zuschreibungen und Erwartungen an sie als Arbeiterkind, der Kluft zwischen Bildungsversprechen und erfahrener Ungleichheit, der verinnerlichten Abwertung und dem Versuch, sich davon zu befreien.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Deniz Ohde, geboren 1988 in Frankfurt am Main, studierte Germanistik in Leipzig, wo sie heute auch lebt. Für ihren Debütroman Streulicht, der 2020 auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, wurde sie mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung und dem aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet.
Produktdetails
- Verlag: BONNEVOICE Hörbuchverlag
- Gesamtlaufzeit: 524 Min.
- Erscheinungstermin: 13. Oktober 2020
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 4064066709396
- Artikelnr.: 60165980
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensentin Sinem Kilic liest Deniz Ohdes Geschichte nicht als Betroffenheits- oder Bildungsroman, der die Herkunft der Protagonistin denunziert, auch wenn die Enge und Aussichtslosigkeit einer bildungsfernen, von Rassismen geprägten Kindheit und Jugend am Rand eines westdeutschen Industrieparks in den späten 90ern für Kilic in den Erinnerungen der Figur spürbar wird. Wie der Heldin schließlich über eine eigene Sprache der Ausbruch aus dem Milieu gelingt, zeigt die Autorin laut Kilic in überzeugenden "Nahaufnahmen". Für Kilic ein empfehlenswertes deutsches Gegenstück zu Eribon oder Ernaux.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»[Streulicht] erinnert an französische Autoren wie Didier Eribon, Édouard Louis und Annie Ernaux, die sich allesamt aus dem sozialen Abseits herausgeschrieben haben. Nun liegt mit Deniz Ohdes Streulicht auch ein überzeugendes Gegenstück deutscher Literatur vor, das in seiner schnörkellosen Sprache mit dem Bildungsversprechen von Chancengleichheit abrechnet, ohne dabei plakative identitätspolitische Statements oder ein 'J'accuse' gebrauchen zu müssen.« Sinem Kilic DIE ZEIT 20201126
Gebundenes Buch
Ich bin bei diesem Buch hin- und hergerissen. Die Lebensgeschichte der Protagonistin, die in einer bildungsfernen Arbeiterfamilie aufwächst, in der der Vater Alkoholiker ist und von fortwährender Sammelwut beherrscht wird, ist grandios beschrieben. Deniz Ohde, von deren eigenen Erfahrungen …
Mehr
Ich bin bei diesem Buch hin- und hergerissen. Die Lebensgeschichte der Protagonistin, die in einer bildungsfernen Arbeiterfamilie aufwächst, in der der Vater Alkoholiker ist und von fortwährender Sammelwut beherrscht wird, ist grandios beschrieben. Deniz Ohde, von deren eigenen Erfahrungen sicherlich viel in dieses Buch eingeflossen ist, schildert so überzeugend dieses Milieu, dass man kaum glauben kann, dass dies ein fiktiver Roman ist. Der Vater, ‚vom selben Schlag‘ wie der Großvater, der im selben Haus lebt, kennt nur Pflichten – ‚das Wort Wunsch war verboten‘ ebenso wie Gefühle, die zu den Frauen gehörten. Ihre Mutter ist Türkin, ebenso bildungsfern wie der Vater, aber dem Leben, dem Schönen, dem Neuen viel mehr zugetan, doch ohne die Möglichkeit, sich dem zuzuwenden.
Und trotzdem schafft es die Ich-Erzählerin, die unter latenter Diskriminierung und auch dadurch an schon fast krankhaften Minderwertigkeitskomplexen leidet, im 2. Anlauf das Abitur zu bestehen und an einer Universität, fern von daheim, zu studieren. Doch ihre Herkunft, durch die sie ‚doppelt gestraft‘ ist, verfolgt sie weiter.
Wie schon geschrieben: Es ist beeindruckend dargestellt. Aber leider nur grau in grau. In dem ganzen Buch gibt es im Leben der Hauptfigur absolut nirgendwo auch nur irgendwo einen Lichtblick. Menschen sollen an Problemen wachsen, ok, vielleicht nicht an allen, aber doch an manchen. Aber diese junge Frau wächst nicht, sie kämpft sich durch und bleibt so klein wie am Anfang. Je weiter ich mit dem Lesen kam, umso öfter habe ich mich gefragt, was sie überhaupt am Leben hält. Ihre Herkunft ist es sicherlich nicht und ihr neues Leben – na ja.
So ist dieses Buch eine wirklich gut geschriebene Geschichte mit völlig deprimierenden Inhalt. Ein wenig Licht, vielleicht auch nur Streulicht, hätte ihr mehr als gut getan!
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
liebevoller Unterschichtenroman
Der Autorin gelingt es in diesem Roman, die Jugend in einem äußerlich denkbar schlechten Familie zu beschreiben. Zwar ist der Vater Messi und Alkoholiker, der in seinen Suchtanfällen die Tochter nicht ins Wohnzimmer lässt und auch die Mutter, …
Mehr
liebevoller Unterschichtenroman
Der Autorin gelingt es in diesem Roman, die Jugend in einem äußerlich denkbar schlechten Familie zu beschreiben. Zwar ist der Vater Messi und Alkoholiker, der in seinen Suchtanfällen die Tochter nicht ins Wohnzimmer lässt und auch die Mutter, die auf dem anatolischen Land ungeliebt von ihren Eltern aufgewachsen ist, aber deutsch gelernt hat, steht nicht für intellektuelles Milieu, aber immerhin befreite sich die Mutter von der religiösen Sitte, kein Schweinefleisch zu essen.
Beim Lesen entsteht der Eindruck, wenn das Jugendamt erfahren hätte, dass in der Wohnung kein Platz zum gemeinsamen Essen war und jeder in seinem Zimmer gegessen hat, den Eltern wohl möglich die Erziehung der Tochter abgenommen worden wäre, dann wird dabei jedoch auch deutlich, dass die Eltern nicht ohne Liebe das Aufwachsen der Tochter begleiten.
Bizarr wirkt es schon, wenn der Vater dem Lehrer beim Elternsprechtag nicht korrigiert, dass er nicht die Tochter von der Freundin Sophia ist. Sophia, die die Ich-Erzählerin mit aufs Gymnasium zieht, ist mit ihrem gemeinsamen Freund Pikka ein weiterer Haltepunkt.
Wenn Kritiker wie Denis Scheck vom scheitern reden, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Die Ich-Erzählerin muss zwar tatsächlich vor der Oberstufe das Gymnasium, auf dem sie kaum aufgefallen ist wegen schlechter Leistungen verlassen, doch nach anderthalb Jahren RTLII-Schauens entschließt sie sich die Abendschule zu besuchen. Mit Zeit Abonnement und der Förderung einer guten Lehrerin wechselt sie auf ein entferntes Gymnasium und macht Abitur mit Einserschnitt.
Zwischendurch stirbt noch der Großvater und die Mutter, vermutlich weil sie zu spät zum Arzt geht. Leider erfahren wir nicht, in welcher Klasse die Tochter da war. Auch der Stadtteil neben dem Industriepark lädt nicht zum Bleiben ein. Selbst die Frau, die sich 1996 in der Christmette in die Luft sprengte, hat es im Frankfurter Stadtteil Sindlingen tatsächlich gegeben.
Das Buch endet mit dem Studium fernab der Heimat, wo sie schnell einen Freund kennenlernt. Eigentlich hätte mir besser gefallen, wenn das Buch mit dem Abitur beendet gewesen wäre. Wir lesen, dass die Motivation ein wenig nachgelassen hat, und es endet mit den tröstenden Worten des Vater, der bezogen auf das Studium sagt: „Wenn’s nichts wird, kommst wieder heim.“
Allenfalls kleinere Ungenauigkeiten, deswegen 5 Sterne.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
„Streulicht“ gehörte zu den Nominierten zum Deutschen Buchpreis 2020. Es ist das Debüt von Deniz Ohde und erzählt von einer Kindheit und Jugend, die von Vorurteilen und Rassismus geprägt war. Der Vater ist Fabrikarbeiter, die Mutter verlässt ihn für eine …
Mehr
„Streulicht“ gehörte zu den Nominierten zum Deutschen Buchpreis 2020. Es ist das Debüt von Deniz Ohde und erzählt von einer Kindheit und Jugend, die von Vorurteilen und Rassismus geprägt war. Der Vater ist Fabrikarbeiter, die Mutter verlässt ihn für eine Weile. Zurück bleibt nicht nur er, nein, auch die Tochter. Dass er Alkoholiker ist, kommt erschwerend hinzu. Mit im Haushalt lebt auch der fast blinde Großvater. Wie viele Menschen der Generation können diese beiden nichts wegwerfen. Sie hängen nicht nur an Dingen, auch ihre Gedanken an die Vergangenheit überlagern jene aus der Gegenwart.
Die Hauptperson in dem Buch schreibt in der Ich-Form. Ihre Mutter kam vor vielen Jahren aus der Türkei und verliebte sich in den deutschen Arbeiter. Sie hatte nichts mit dem Islam zu tun auch ihre Tochter nicht. Jedoch wurde die immer wieder sowohl von Lehrern als auch von Mitschülern über ihr Aussehen und den „komischen“ Namen befragt. Ein Lehrer verwehrte ihr den Zugang zum Gymnasium, indem er ihre Arbeiten schlechter bewertete als sie tatsächlich waren.
Mit viel Überredungskunst von Außen und Gedanken nach dem Motto: „Euch zeige ich es“, besuchte sie schließlich eine Abendschule. Sie wollte das Abitur auf diese Weise nachmachen. Hier gab es nur „verkrachte Existenzen“ und sie fühlte sich angenommen. Dass sie ein glänzendes Zeugnis erhielt, das muss kaum erwähnt werden.
Das Buch gefiel mir gut. Es ist eins der gefälligsten Werke, die ich aus der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2020 las. Die Autorin schreibt gefällig und nachvollziehbar. Die hier genannten Vorurteile gibt es tatsächlich und auf welche Weise schlechte Lehrer das Leben der ihnen Anvertrauten schwer machen können, das erlebten wir bei unserem Enkel. Wer einen Rucksack sein Eigen nennt, auf dem groß das Emblem der „Welt“ prangt, die ist also intelligent? (Ein Beispiel für die Beurteilung des Äußeren) Vier Sterne gebe ich und empfehle, das Buch zu lesen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Wunderschöne Sprache, intensive Erinnerungen. Eindrucksvoll wie Ohde Standesdünkel, Klassismus und Rassismus vorführt.
Staubgeboren
In diesem Buch passiert scheinbar nicht viel. Und doch so viel, denn hier werden die Weichen gelegt, wie ein junger Mensch später die Welt …
Mehr
Wunderschöne Sprache, intensive Erinnerungen. Eindrucksvoll wie Ohde Standesdünkel, Klassismus und Rassismus vorführt.
Staubgeboren
In diesem Buch passiert scheinbar nicht viel. Und doch so viel, denn hier werden die Weichen gelegt, wie ein junger Mensch später die Welt wahrnimmt und – leider noch viel wesentlicher in unserer Welt – wie dieser von der Welt wahrgenommen wird. Diese Weichen liegen im Streulicht, vieles kann so gehen oder so. Aber es gibt ein Muster und Wahrscheinlichkeiten, nach denen die Freundin Sophie wohl einen anderen Lebensweg haben wird als das Mädchen mit dem geheimen türkischen Namen, obwohl sie den nur selten nennt. Eindrucksvoll ist an diesem Buch wie Ohde Standesdünkel, Klassismus und Rassismus vorführt.
„Es war keine Identität, die sich herausbildete, sondern eher wurde sie mir entzogen, verschwand im Keller der Schule, zwischen den bis in die Sechziger zurückreichenden Akten, weil ich die Einzige aus meinem Jahrgang war, die nicht auf eine höhere Schule wechselte und deren Akte deshalb nirgendwo hingeschickt werden musste. Sie lag oben auf einem staubigen Schrank, nachts kalt beleuchtet von den Laternen des Schulhofs.“
Kürzlich habe ich mal einen treffenden Gedanken gelesen: Wie langweilig es doch ist, immer und wieder davon zu lesen, wie sich mittelalte Männer in Büchern wehmütig an ihre eigene Jugend erinnern und sie verklären. Wie völlig entgegengesetzt das ist, wenn sich die Ohdes Protagonistin an ihre Jugend erinnert. Hier ist nichts verklärend. Wehmütig wurde mir dennoch ums Herz, weil Ohde uns ganz nah an ihre Protagonistin heranlässt.
„Ich war nicht schaumgeboren, sondern staubgeboren; rußgeboren, geboren aus dem Kochsalz in der Luft, das sich auf die Autodächer legte. Geboren aus dem sauren Gestank der Müllverbrennungsanlage, aus den Flusswiesen und den Bäumen zwischen den Strommasten, aus dem dunklen Wasser, das an die Wackersteine schlug, einem Film aus Stickstoff und Nitrat, nicht Gischt.“
Dies alles fasst Ohde in eine sehr poetische Sprache. Weil es ihre Protagonistin ist, deren Stimme wir hören, wird umso deutlicher, um wie viel Potential so viele Menschen in diesem Land durch die Strukturen gebracht werden.
CN / Content Note: Alkoholismus, Messie-Syndrom, Rassismus, schwierige Kindheit, körperliche Bestrafung der Mutter in deren Kindheit, Rassismus, Krebstod
Rassismus schlägt der Protagonistin erst in zweiter Linie entgegen, weil die türkischen Wurzeln der Mutter durch den deutschen Namen meist übertüncht werden. Doch immer wieder so Sätze der Freundin seit Kindheitstagen. Aber auch so wird oft das Gefühl vermittelt, dass sie nicht wirklich dazu gehört, schon wegen der einfachen Herkunft der Eltern. Der Vater ertränkt seine Verletzungen von früher im Alkohol, hortet Dinge an bis zum Messitum.
„Wenigstens ging er nur auf die Möbel los. Sie schätzte sich glücklich. Man konnte nicht davon ausgehen, dass es in der Welt etwas Besseres gab, man konnte es nicht einfach so einfordern. Das habe ich von ihr gelernt.“
So fein beobachtet wie schmerzhaft fand ich, wenn sich die Protagonistin mit ihren Freund:innen aus Kindheitstage vergleicht, obwohl, vielleicht mache ich das viel mehr beim Lesen selbst. Die Hochzeit der beiden bildet dann auch den Rahmen für die Erzählung. Die letzten 20, 30 Seiten versandeten für mich ein wenig vom Bogen. Das Buch als Ganzes habe ich sehr gerne gelesen.
Fazit
Sprachlich gelungen, intensive Erinnerungen. Deniz Ohde ist damit für mich sehr verdient auf der Short List des Deutschen Buchpreises gelandet. Ich empfehle das Buch sehr gerne allen, die Gefallen an ruhiger, poetischer Literatur finden. 4,5 von 5 Sternen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Am Rande des Industrieparks, der Säure in die Luft pustet und klebrigen Schnee produziert, wächst die Ich-Erzählerin auf. Mit ihren Freunden Pikka und Sophie besucht sie das Gymnasium, glaubt dort so sein zu können wie diese, doch hinter der Tür der elterlichen Wohnung ist …
Mehr
Am Rande des Industrieparks, der Säure in die Luft pustet und klebrigen Schnee produziert, wächst die Ich-Erzählerin auf. Mit ihren Freunden Pikka und Sophie besucht sie das Gymnasium, glaubt dort so sein zu können wie diese, doch hinter der Tür der elterlichen Wohnung ist vieles anders. Vater wie Großvater trinken zu viel, wollen keine Veränderung und herrschen ruppig über den Haushalt. Die Mutter, die einst aus der Türkei in ein vermeintlich besseres Leben geflüchtet war, akzeptiert dies stumm, bis es nicht mehr geht. Kein Umfeld für eine vielversprechende Zukunft und so kommt es auch: die Versetzung gescheitert, das Gymnasium Vergangenheit. Warum noch kämpfen, wenn der Ausgang doch ohnehin schon gewiss ist?
In Deniz Ohdes Debütroman verarbeitet die Autorin gleich zwei Erfahrungen, die sowohl unsere Gesellschaft wie auch das Bildungswesen prägen: Als Arbeiterkind fehlt ihr der Zugang zum notwendigen Habitus, der Voraussetzung für den Bildungserfolg ist, als Tochter einer türkisch-stämmigen Mutter verleugnet sie zunächst den offenkundigen ausländischen Namen, der sie ebenfalls stigmatisiert und in eine Schublade steckt, auf der sicher nicht Bildungsaufsteiger steht. Sie hat nie gelernt, für sich zu sprechen, Widerstand gegen erfahrenes Unrecht zu leisten und muss so den schweren Weg nehmen.
Gewalt kennt viele Formen. Die Erzählerin erlebt sie auf vielfältige Weise: verbal, psychisch, physisch. Angst und Sprachlosigkeit sind die Folgen, die sie über viele Jahre lähmen und ihr jedes Selbstvertrauen rauben. So trist die Umgebung in der Nähe des grauen und lärmenden Industrieparks, der nur noch von den unzähligen Flugzeugen übertrumpft wird, so traurig auch das Elternhaus in jeder Hinsicht. Sie lernt früh, unsichtbar und unhörbar zu werden, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Mutter keine Verbündete, kämpft diese noch mit der eigenen Befreiung, die ihr mit der Flucht aus der Heimat vermeintlich schon gelungen war, nur um sie in eine neue, andere Gefangenschaft zu bringen.
Symbolisch zwei Szenen für einerseits die Leere, in der sie schwebt, und andererseits die vermeintlichen Freunde, die an ihrer Seite stehen. Bei einem Aufsatz zum Thema Identität fällt ihr nichts ein. Sie weiß nicht, wer sie eigentlich ist, was sie ausmacht, ebenso wenig wo sie hin will. Trotz hervorragender Zensuren traut ihr die Freundin Sophie, mit bildungsbürgerlichem Hintergrund, reit- und Ballettstunden gesegnet, nicht zu, das Abitur zu schaffen. Obwohl sie ihr Wissen unter Beweis stellt, bleiben immer Zweifel, wird dies als nur zufällig oder vorläufig anerkannt. Sie passt nicht in das Bild und immer wieder finden sich fadenscheinige Gründe, sie wieder beiseite zu schieben.
Es ist kein Roman von Emanzipierung; bei der Rückkehr in die elterliche Wohnung wird sie trotz inzwischen vorhandenem Studienabschluss wieder zu dem unscheinbaren Mädchen, das nichts kann und nichts zählt. Tief haben sich die Erfahrungen aus dem Kindesalter eingeschnitten und Narben verursacht, die sich nicht kaschieren lassen. Ein atmosphärisch düsterer Roman, der ohne plakative Gewaltexzesse doch verdeutlicht, wie grausam ein Leben in Deutschland verlaufen kann. Inhaltlich sicherlich ein würdiger Kandidat für den diesjährigen Deutschen Buchpreis.
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch Großartiges Buch und Brennglas für das ungleiche Bildungssystem in Deutschland und die strukturell verankerten Diskriminierungsmechanismen in der Schule. Gut anzudocken an die französischen Soziologen, wie Annie Ernaux oder Didier Eribon. Toll! Ein Muss für alle Lehrende!
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Durchs Raster gefallen
Als literarischer Senkrechtstarter erweist sich der kürzlich erschienene Debütroman «Streulicht», mit dem Deniz Ohde erstmals an das Licht einer breiteren Öffentlichkeit getreten ist. Prompt wurde er nämlich für den Preis der Frankfurter …
Mehr
Durchs Raster gefallen
Als literarischer Senkrechtstarter erweist sich der kürzlich erschienene Debütroman «Streulicht», mit dem Deniz Ohde erstmals an das Licht einer breiteren Öffentlichkeit getreten ist. Prompt wurde er nämlich für den Preis der Frankfurter Buchmesse nominiert und landete schließlich sogar auf der Shortlist. Es handelt sich um einen klassischen Bildungsroman, dessen Besonderheit darin liegt, dass seine der Autorin in einigen Punkten autobiografisch ähnelnde Ich-Erzählerin durchs Raster gefallen ist. «Wenn’s nichts wird, kommst wieder heim» lautet denn auch resignativ der letzte Satz. Coming-of-Age also ganz ohne Fortune!
Die namenlose Protagonistin erzählt als Erwachsene anlässlich eines Besuchs an der Stätte ihrer Jugend ihre Lebensgeschichte. Sie wird als Kind einer türkischen Putzfrau und eines deutschen Fabrikarbeiters in Frankfurt am Main geboren, ganz in der Nähe des Industrieparks Hoechst. Ihre Aufstiegschancen aus den prekären Verhältnissen im bildungsfernen Elternhaus sind gering. Sie ist schüchtern bis hin zur Verstocktheit und wird zudem von diffusen Ängsten beherrscht. Obwohl sie Deutsche ist, wie ihre Mutter immer wieder betont, leidet sie unter dem Stigma, Tochter einer Türkin aus dem hintersten Anatolien zu sein, aus einem armseligen Dorf am Schwarzen Meer. Sie rasiert sich also die Monobraue, um nicht als Türkin zu gelten, und gibt immer nur ihren zweiten, den deutschen Vornamen an, wird aber trotzdem schon früh von den anderen Kindern gehänselt. «Frau A-?» fragt im Buch ein Chef die Heldin beim Empfang zu einem Bewerbungsgespräch, ihre Namenlosigkeit wird eisern durchgehalten im Roman. Ihr Vater ist lebenslang in der chemischen Fabrik als einfacher Arbeiter mit immer der gleichen, stupiden Tätigkeit beschäftigt. Ein äußerst eintöniges, trostloses Arbeitsleben also, das er mit viel Alkohol und stoischer Ruhe erträgt. Wie schon der Großvater ist er ein typischer Messi, der sich von nichts trennen kann, dessen Wohnung immer mehr vermüllt, deutliches Anzeichen für eine pathologische Entscheidungs-Schwäche.
Kein Wunder, dass die Tochter als unterprivilegiertes «Kellerkind» in dem Glauben, weniger wert zu sein als alle anderen, in der Schule häufig scheitert. Sie wird überall ausgegrenzt und hat außer Sophia und Mikka keine Freunde. Gleichwohl kämpft sie sich tapfer auf dem Umweg über die Abendschule bis zum Abitur durch, erreicht einen hervorragenden Notenschnitt und beginnt zu studieren. Auf der Uni lernt sie dann einen Kommilitonen kennen, der erste Freund der inzwischen über Zwanzigjährigen. Mit dem sie dann sogar im Bett landet, erst- und einmalig aber, muss vermutet werden. Mehr erfährt man nämlich nicht in dieser radikal sexfreien Geschichte. Sie ist und bleibt eine verklemmte junge Frau, deren Fremdheitsgefühl manifest zu sein scheint. Beim Erzählen aus ihrem Leben verliert sich die Protagonistin in endlosen Betrachtungen der trostlosen Umgebung und der chaotischen elterlichen Wohnung.
Diffus, wie es schon der Buchtitel andeutet, von der geraden Bahn abgelenkt also, ist nicht nur das Licht an dem vom ewigen Industrie-Smog geplagten Handlungsort, diffus ist auch die Erzählweise dieses Romans. Der Lebensweg seiner von äußeren Negativ-Zuweisungen geschädigten Protagonistin wird nämlich in allzu vielen sprunghaften Rückblenden erzählt. Wobei besonders die dauernden Wiederholungen immer der gleichen Szenarien und schmerzenden Gefühle den Leser schnell ermüden. Die von Hoffnungslosigkeit und Entmutigung gebeutelte, bindungslose Außenseiterin wirkt als Figur wenig überzeugend, was gleichermaßen für die Figurenrede gilt. Eine unterprivilegierte Herkunft ist auch das Thema von Nicolas Mathieu, dessen Roman «Wie später ihre Kinder» die daraus resultierende soziale Schieflage allerdings vehement anprangert. Was bei Deniz Ohde nur als hilflose Frage im Raum stehen bleibt: «Wie konnte dieses Kind durchs Raster fallen?», darauf gibt ihr französischer Kollege eine klare Antwort.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Das mehrfach preisgekrönte Buch erzählt von einem jungen Menschen, der mit einem klaren Ziel vor Augen seinem Ursprungsmilieu entwächst und sich positiv entwickelt. Es kann Mut machen und vielleicht liegt darin der eigentliche Beitrag dieses für meinen Geschmack zu larmoyanten …
Mehr
Das mehrfach preisgekrönte Buch erzählt von einem jungen Menschen, der mit einem klaren Ziel vor Augen seinem Ursprungsmilieu entwächst und sich positiv entwickelt. Es kann Mut machen und vielleicht liegt darin der eigentliche Beitrag dieses für meinen Geschmack zu larmoyanten und über weite Strecken von Passivität und Opferhaltung geprägten Romans.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für