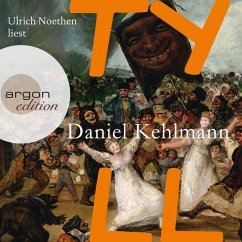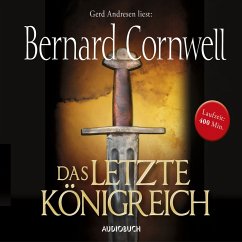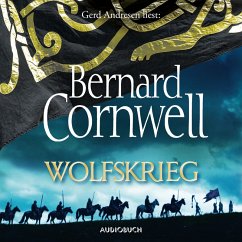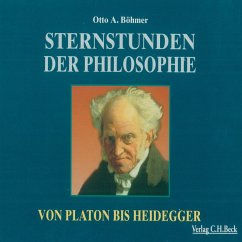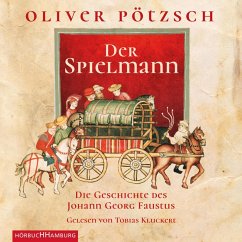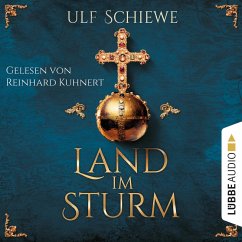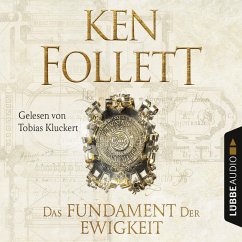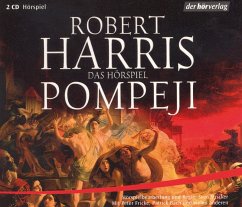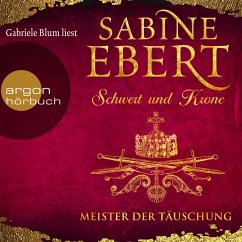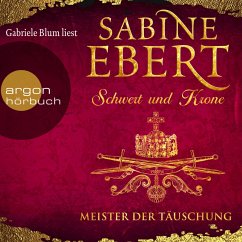Daniel Kehlmann
Hörbuch-Download MP3
Tyll (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 217 Min.
Sprecher: Wameling, Gerd; Groth, Sylvester; Rudolph, Lars; Wöhler, Gustav Peter

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!





Tyll Ulenspiegel - Vagant und Schausteller, Entertainer und Provokateur - wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts in einem Dorf geboren, in dem sein Vater, ein Müller, als Magier und Welterforscher schon bald mit der Kirche in Konflikt gerät. Tyll muss fliehen, die Bäckerstochter Nele begleitet ihn. Auf seinen Wegen durch das vom Dreißigjährigen Krieg verheerte Land begegnen sie vielen kleinen Leuten und einigen der sogenannten Großen: Gelehrten, Ärzten, Henkern und Jongleuren, einem exilierten Königspaar, und nicht zuletzt einem Weltweisen, dessen größtes Geheimnis darin besteht, dass e...
Tyll Ulenspiegel - Vagant und Schausteller, Entertainer und Provokateur - wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts in einem Dorf geboren, in dem sein Vater, ein Müller, als Magier und Welterforscher schon bald mit der Kirche in Konflikt gerät. Tyll muss fliehen, die Bäckerstochter Nele begleitet ihn. Auf seinen Wegen durch das vom Dreißigjährigen Krieg verheerte Land begegnen sie vielen kleinen Leuten und einigen der sogenannten Großen: Gelehrten, Ärzten, Henkern und Jongleuren, einem exilierten Königspaar, und nicht zuletzt einem Weltweisen, dessen größtes Geheimnis darin besteht, dass er seine aufsehenerregenden Versuchsergebnisse erschwindelt und erfunden hat ...
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, wurde für sein Werk unter anderem mit dem Candide-Preis, dem Per-Olov-Enquist-Preis, dem Kleist-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Sein Roman Die Vermessung der Weltist eines der erfolgreichsten deutschen Bücher des 21. Jahrhunderts, auch der Roman Tyllstand monatelang auf den Bestsellerlisten und gelangte auf die Shortlist des International Booker Prize. Lichtspiel machte international Furore, v. a. in den USA. Daniel Kehlmann lebt in Berlin und New York.

Produktdetails
- Verlag: argon
- Gesamtlaufzeit: 217 Min.
- Erscheinungstermin: 22. August 2018
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783732493852
- Artikelnr.: 53522253
 buecher-magazin.deWir befinden uns mitten im Dreißigjährigen Krieg, in einer Zeit, in der manche noch Hexen verbrennen und andere schon beginnen, die Geschehnisse der Welt naturwissenschaftlich zu erfassen. Eine Epoche des Umbruchs also, in welcher der vielleicht begabteste Erzähler seiner Generation, Daniel Kehlmann, seinen neuen, titelgebenden Helden Tyll spuken lässt. Anspielend auf den mittelalterlichen Schelm Till Eulenspiegel, weiß auch dieser Protagonist uns mit allen Mitteln der Fantasie zu verführen. Ob auf Marktplätzen oder in Fürstenhäusern - wo immer der Gaukler aus Perspektiven unterschiedlicher Zeitgenossen gesehen wird, erweist sich die Realität bald schon als trügerisch und brüchig. Allen voran die fingierte und allzu unzuverlässige Autobiografie eines dicken, abenteuerlustigen Grafen lässt die Vermutung im Leser aufkommen, dass Tyll möglicherweise schon längst ein Gespenst geworden sein könnte. Spannend, wendungsreich und ästhetisch formvollendet bezeugt Kehlmann, dieser grandiose neue Nabokov, wieder einmal, was Literatur zu leisten vermag: Sie entrückt uns auf magische Weise der Wirklichkeit, sodass wir diese am Ende klarer und besser verstehen können.
buecher-magazin.deWir befinden uns mitten im Dreißigjährigen Krieg, in einer Zeit, in der manche noch Hexen verbrennen und andere schon beginnen, die Geschehnisse der Welt naturwissenschaftlich zu erfassen. Eine Epoche des Umbruchs also, in welcher der vielleicht begabteste Erzähler seiner Generation, Daniel Kehlmann, seinen neuen, titelgebenden Helden Tyll spuken lässt. Anspielend auf den mittelalterlichen Schelm Till Eulenspiegel, weiß auch dieser Protagonist uns mit allen Mitteln der Fantasie zu verführen. Ob auf Marktplätzen oder in Fürstenhäusern - wo immer der Gaukler aus Perspektiven unterschiedlicher Zeitgenossen gesehen wird, erweist sich die Realität bald schon als trügerisch und brüchig. Allen voran die fingierte und allzu unzuverlässige Autobiografie eines dicken, abenteuerlustigen Grafen lässt die Vermutung im Leser aufkommen, dass Tyll möglicherweise schon längst ein Gespenst geworden sein könnte. Spannend, wendungsreich und ästhetisch formvollendet bezeugt Kehlmann, dieser grandiose neue Nabokov, wieder einmal, was Literatur zu leisten vermag: Sie entrückt uns auf magische Weise der Wirklichkeit, sodass wir diese am Ende klarer und besser verstehen können.© BÜCHERmagazin, Björn Hayer
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
"Literaturliteratur" nennt Rezensent Dirk Knipphals Daniel Kehlmanns neuen Roman und meint das absolut anerkennend, ohne Hintergedanken, denn mit diesem Buch, indem mehr als ein Geschichts- und Künstlerroman steckt, treibt Kehlmann dem Leser alle Bedenken an seinem mitunter kühl "überbrillianten" Scheiben aus. Brilliant bleibt er aber, in gerade dem rechten Maß, freut sich Knipphals, zum Beispiel, wenn er Till Eulenspiegel, Vorbild seiner Figur "Tyll" in die Zeit kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg versetzt, wenn er dessen Lebensgeschichte im ersten Teil des Buches erzählt, damit Erwartungen weckt, dann jedoch einen genialischen Schwenk wagt, den König Friedrich V., bei dem Tyll als Hofnarr angestellt ist, ins Visier nimmt, sein Erzählen in dem Zusammenhang episodisch wird, wobei einige Episoden zwar ein wenig zu stark ihre literarischen Leitbilder offenbaren, der Großteil jedoch erstaunlich ist: erstaunlich spannend, erstaunlich anschaulich und erstaunlich tiefgängig, tiefgängig bis zum Kern der Kunst, dem, wie Kehlmann in seinem Roman den Leser herausarbeiten, ja er-denken lässt, immer etwas brutales, "traumatisches" anhaftet, denn auch die Kunst ist durch die Geschichte gegangen oder nebenher? Und Geschichte wird von denen gemacht, die einmal überlebt haben, so der hingerissene und nachdenkliche Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Und jetzt darf ich einen echten Triumph der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur anzeigen. Sprachtrunken, bildersatt und verzaubert habe ich den neuen Roman von Daniel Kehlmann zugeklappt: So ein Wunderbuch begegnet einem nicht jedes Jahr! Eindrücklich wie nie gelingt es Kehlmann, rund um den aus dem Spätmittelalter in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges verpflanzten Tyll Ulenspiegel einen Mummenschanz um Macht, Machtmissbrauch und den Hochseiltanz unserer Existenz zu inszenieren, der es in sich hat. Hinreißend! Dennis Scheck ARD "Druckfrisch"
Gebundenes Buch
Till Eulenspiegel- wer hat den Bronzefuß nicht angefasst bei einem Besuch in Mölln? Soll das Reiben doch Glück bringen und einen wiederkommen lassen- irgendwann im Leben!
Dieser Tyll ist allerdings ganz und gar nicht unbeweglich und abwartend. Seine Füße tänzeln …
Mehr
Till Eulenspiegel- wer hat den Bronzefuß nicht angefasst bei einem Besuch in Mölln? Soll das Reiben doch Glück bringen und einen wiederkommen lassen- irgendwann im Leben!
Dieser Tyll ist allerdings ganz und gar nicht unbeweglich und abwartend. Seine Füße tänzeln durch die brennenden und wunden Landschaften mitten im Dreißigjährigen Krieg.
Tyll ist der Sohn des Müllers, der eigentlich gar kein Müller sein will und der sich lieber mit der Magie und Erforschung der Mondlaufbahn beschäftigt. Während ihm seine Formeln und sein Wissensdurst zum Verhängnis werden, schenkt seine Naivität Tyll die Freiheit, die Narrenfreiheit. Dieser zieht von Marktplatz zu Marktplatz, ein Freier ohne Rechte, aber auch ohne Pflichten.
In diesem langen Krieg gibt es keine blühenden Landschaften mehr. Das Volk leidet Hunger, der Klerus bestraft Andersdenkende und der Adel nimmt sich das Wenige, das noch da ist. Den Königen kommt das Land abhanden und dem Volk der rechte Glaube. Tyll macht Karriere und hält dem Hof den Spiegel vor, der des Kaisers neue Kleider zeigt: „Das alles sei wahr, sogar das Erfundene sei wahr.“
Daniel Kehlmann lässt Goyas Gaukler auf dem Buchumschlag lebendig werden und das Mittelalter aufleben mit seinen finsteren Gassen, dem Aberglauben und der Gottesfürchtigkeit. Alpträume, Hunger und Angst verschonen auch den „Winterkönig“ nicht und lassen ihn einsam und ohne Würde sterben.
Lug und Trug, Gewalt und Macht sind Spielbälle des Glücks und machen vor niemandem Halt.
Tyll ist das Band, das die Erzählstränge verbindet und trägt. Hin und wieder scheint er kurz abhandengekommen zu sein, bis er den Faden wiederaufnimmt und sich einbringt.
Der Leser muss kein Geschichtsgelehrter sein und die historischen Zusammenhänge ableiten, um sie im Kontext zu verstehen. Denn Daniel Kehlmann zitiert aus der Geschichte und so manche Begebenheit lässt er nur wahr erscheinen.
Oder etwa nicht?
Weniger
Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Licht und Schatten im Mittelalterschinken des berühmten Autors
Die Kritiker sind sich nicht einig über dieses Buch, das durchaus souveräne Stellen hat, etwa die Beschreibung der Henkersmahlzeit für Tylls Vater. Ebenso gefällt mir die Geschichte des Winterkönigs, …
Mehr
Licht und Schatten im Mittelalterschinken des berühmten Autors
Die Kritiker sind sich nicht einig über dieses Buch, das durchaus souveräne Stellen hat, etwa die Beschreibung der Henkersmahlzeit für Tylls Vater. Ebenso gefällt mir die Geschichte des Winterkönigs, wobei Heidelberger Lokalkolorit mitspielt, und auch die Gespräche seiner Frau Liz bei den Friedensverhandlungen in Osnabrück.
Der Westfälische Friede ist ein Durchbruch zur modernen Diplomatie: „Man muss immer erst aushandeln, worüber man eigentlich verhandeln wird, bevor man verhandelt.“ (S.455)
Ich befürworte ebenfalls das umstrittene erste Kapitel (Diskussion im Schweizer Literaturclub) mit dem schönen ersten Satz: „Der Krieg war bisher nicht zu uns gekommen.“ Es gibt Einblicke in die Denkweise dieser Zeit.
Mir missfällt aber die ausführliche und langweilige Darstellung des Prozesses gegen Tylls Vater, drei Beschreibungen von magischen Quadraten sind zwei zu viel. Auch wenn Tyll ein Schalk war, die Drachengeschichten mussten nun wirklich nicht sein. Wenn das Kapitel „Im Schacht“ uns den Krieg näher bringen sollte, so hätte ich mir lieber eine Schlachtbeschreibung, etwa vom Tode Gustav Adolfs, gewünscht.
Kehlmann beleuchtet verschiedene Schlaglichter des Dreißigjährigen Krieges, die durch Tyll Ulenspiegel verbunden werden. Das kann man wohl so machen. Dennoch habe ich gerne den Wikipedia-Artikel zum „Winterkönig“ gelesen, um zu wissen, was wirklich passiert ist. Auch habe ich bei Hermann Bote nachgelesen, was wirklich von Tyll stammt.
Lobend und als Kritik meiner Überschrift sei erwähnt, dass das Buch mit 473 Seiten kein echter „Schinken“ ist. Licht und Schatten ist übrigens auch ein Buchkapitel, in dem steht was unsterblich macht (nämlich bei Kirchner veröffentlicht zu werden. Heute liest ihn keiner mehr. Ist die Person real oder erfunden?) Ich kann gut verstehen, dass auch Tyll nicht sterben will. Kehlmann schreibt schön und gut lesbar, 2,5 Tage habe ich nur für dieses Buch benötigt. 3 Sterne.
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Hörbuch-Download MP3
Noethen ist der Größte!
Interessiert an deutscher Geschichte? An skurrilen, humorvollen aber auch grausamen Episoden? Dann mitten hinein ins Mittelalter!
Daniel Kehlmann entführt uns in die raue Zeit des 30jährigen Krieges.
Tyll, die Hauptfiger, sowie eine Handvoll …
Mehr
Noethen ist der Größte!
Interessiert an deutscher Geschichte? An skurrilen, humorvollen aber auch grausamen Episoden? Dann mitten hinein ins Mittelalter!
Daniel Kehlmann entführt uns in die raue Zeit des 30jährigen Krieges.
Tyll, die Hauptfiger, sowie eine Handvoll weiterer, zum Teil historischer Charaktere, sind hineingeworfen in ein zerstörtes Land, seine Einwohner sind verletzt oder grausam, verhaftet im Hexenglauben und überall lauert zumindest latent Gefahr.
Der Autor kombiniert geschickt die verschiedenen Handlungsstränge und Zeitebenen. Großartig, wie sich mosaikartig die Vita des Tyll Ulenspiegel über 30, 40 Jahre hinweg offenbart. Dazwischen immer wieder eingeschoben die Schicksale der Nebenfiguren, wie der bösartige Gaukler, die ehrgeizige Winterkönigin oder die Hexenjäger.
Beworben wird das Buch mit "Zeit für Narren", dass dabei auch der letzte deutsche Drache stirbt, steht für eine weitere, phantasievolle Ebene des Romans.
Nach der "Vermessung der Welt" thematisiert Kehlmann ein weiteres historisches Sujet, das nicht stur an der Historie klebt, sondern diese als sorgfältig recherchierte Folie zur Erzählung einer packenden Geschichte dient. Dabei erweckt er die Protagonisten - ob historische Gestalten oder seiner Phantasie entsprungen - so zum Leben, dass man sich in jede der handelnden Personen hineinversetzen kann; nicht zuletzt das Verdienst des kongenialen Vorlesers.
Der versierte Hörbuchsprecher Ulrich Noethen, den ich bereits als Vorleser der englischen Krimi-Reihe um den Psychologen Joe O'Loughlin kenne und schätze, übertrifft sich hier selbst: Wie er die verschiedenen Dialekte, Akzente und Attitüden der handelnden Personen vermittelt ist grandios. Wie auch als Schauspieler schlüpft er überzeugend in die jeweilige Rolle. Das bietet klaren Mehrwert zum Selbst lesen.
Das Werk um den Narren Till Eulenspiegel (Tyll) der sich wie ein Fisch im Wasser im verheerten Deutschland des 30jährigen Krieges bewegt - etwa in Gesellschaft von brutalen Landsknechten oder als sarkastischer Begleiter des Winterkönigs von Prag - dürfte ein Meilenstein der deutschen Gegenwartsliteratur sein. Grandios!
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Vergegenwärtigung des Vergangenen
Nach vier Jahren ist mit «Tyll» wieder ein Roman von Daniel Kehlmann erschienen, der das Zeug dazu hat, an den großen Erfolg seines Bestsellers «Die Vermessung der Welt» anzuknüpfen, und auch hier wird Realität und …
Mehr
Vergegenwärtigung des Vergangenen
Nach vier Jahren ist mit «Tyll» wieder ein Roman von Daniel Kehlmann erschienen, der das Zeug dazu hat, an den großen Erfolg seines Bestsellers «Die Vermessung der Welt» anzuknüpfen, und auch hier wird Realität und Fiktion zu einer unterhaltsamen Geschichte verknüpft. Der Trick dabei, die Eulenspiegelei also, ist eine lässliche Schummelei des Autors: Die legendäre Figur tauchte erstmals gegen Ende des Mittelalters auf, der Roman hingegen weist dem berühmten Schelm gut hundert Jahre später eine Rolle mitten im Dreißigjährigen Krieg zu. Und um den geht es letztendlich auch in diesem historischen Roman.
Kehlmann erzählt seine Geschichte in acht Episoden, beginnend mit einem bösen Streich, bei dem Tyll Ulenspiegel den einfältigen, bisher vom Krieg noch verschonten Bewohnern einer Stadt als Schauspieler, Seiltänzer und Bauchredner das Geld aus den Taschen zieht und die euphorisierte Menge am Ende zu einem kollektiven Schuhwerfen anstiftet. Lachend über das damit angerichtete Chaos zieht der notorische Spötter mit seinem Eselskarren und den zwei Begleiterinnen weiter. Tyll stammt aus einer Müllerfamilie, erfahren wir in der Rückblende des nächsten Kapitels, sein autodidaktisch gelehrter Vater beschäftigt sich mit allerlei Zauber, mit Astrologie und Experimenten, bis er als Hexer denunziert und von einem melancholischen Henker «einfühlsam» zu Tode gebracht wird. Als junger Bengel flüchtet der heimatlos gewordene Tyll daraufhin mit der Bäckertochter Nele in die Welt hinaus, in ein durch den barbarischen Krieg verheertes Land. Sie treffen auf den bösartigen Gaukler Pirmin, der sie mitnimmt und ihnen zwar vieles beibringt, sie aber auch sehr schlecht behandelt, - bis Nele ihm schließlich ein finales Pilzgericht kocht: Einige Hände voll Pfifferlinge, gemischt mit etwas Fliegenpilz und Knollenblätterpilz. Jeden der Giftpilze allein kann man herausschmecken, weiß Nele, mit beiden zusammen aber verliert sich der verräterische Beigeschmack völlig.
Die Figur des Tyll bildet eine lose Klammer um das Geschehen im Roman, das sich kapitelweise allmählich von den Bedrängnissen der kleinen Leute hin zu den oft nicht weniger gebeutelten Majestäten entwickelt. In kürzeren und längeren Episoden wird da beispielsweise von der Schlacht von Zusmarshausen berichtet, ein in seiner Brutalität heute kaum noch vorstellbares Gemetzel, oder von den Prager «Winterkönigen», Friedrich V mit seiner schönen Gemahlin Liz, Elisabeth Stuart, Enkelin der berühmten Maria. Die tragische Geschichte dieses böhmischen Königs wird als einer der Auslöser des verheerenden Glaubenskrieges angesehen. Aber auch der faszinierenden Person des berühmten Jesuiten und Universalgelehrten Athanasius Kircher ist zum Beispiel ein Kapitel gewidmet. Als, Jahrzehnte später, im letzten Kapitel, die inzwischen verwitwete und völlig verarmte Liz, die unbeirrt weiterhin kurfürstliche Rechte für ihren Sohn geltend macht, aus ihrem Exil nach Westfalen reist, zu den Friedensverhandlungen, trifft sie dort auf Tyll, Hofnarr des Kaisers. Sie bietet ihm an, mit ihr nach England zu kommen, «Um der alten Zeiten willen», wie sie sagt. «Du weißt so gut wie ich, dass der Kaiser sich früher oder später über dich ärgert. Dann bist du wieder auf der Straße. Du hast es besser bei mir.» Er erwidert: «Aber weißt du, was besser ist? Noch besser als friedlich sterben?» «Sag es mir.» «Nicht sterben, kleine Liz. Das ist viel besser.» Dem Autor gelingt hier ein versöhnliches Ende ohne jeden Kitsch, Chapeau!
Zur Unsterblichkeit dieser legendären Figur dürfte Kehlmann seinerseits einen nicht unwesentlichen Beitrag leisten mit seinem kreativ erdachten und grandios erzählten Roman, der ebenso unterhaltsam ist wie bereichernd, sein bester bisher. Eine gelungene Vergegenwärtigung des Vergangenen, sprachlich brillant, herrlich leichtfüßig erzählt, dabei – gottlob – jedwedes Zeitidiom meidend, mit feiner Ironie angereichert zudem, - eine unbedingt empfehlenswerte Lektüre!
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Ein Meisterwerk der Sprache! Ich bin nicht unbedingt ein Kehlmann - Fan ( mal ja, mal nein :-)), aber in diesem Buch übertrifft er sich selbst um einiges!
Die Thematik des Dreißigjährigen Krieges hat mich nicht wirklich angesprochen und auch die teils überwältigenden …
Mehr
Ein Meisterwerk der Sprache! Ich bin nicht unbedingt ein Kehlmann - Fan ( mal ja, mal nein :-)), aber in diesem Buch übertrifft er sich selbst um einiges!
Die Thematik des Dreißigjährigen Krieges hat mich nicht wirklich angesprochen und auch die teils überwältigenden Kritiken ließen mich nicht sofort zugreifen... Es war die ständige Präsenz des Buches in Buchhandlungen und Medien, sowie das fast schon magische Cover, auf dem sich alles in verstörendem Reigen zu bewegen scheint, was mich dann doch so neugierig machte, dass ich mir zumindest das Hörbuch holte.
Und, es war die richtige Entscheidung: Ulrich Noethen liest - wie von ihm gewohnt - mit einer Intonation, welche im Zusammenklang mit der Sprache Kehlmanns eine derartig fesselnde, in den Bann ziehende Wirkung auf mich als Hörer ausübt, dass in mir Bilder aufsteigen, die an eigenes Erleben grenzen.
Mein Fazit: Echtes Kopfkino mit Suchtfaktor
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch Der weise Narr
Derbe Späße a la Simplicissimus um die bekannte Figur des weisen Narren Ulenspiegel in grausamer Zeit.
- Vielleicht brauchen wir heute wieder einen solchen Narren...
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Ich liebe Daniel Kehlmann. "Die Vermessung der Welt" zählt zu meinen Lieblingsbüchern, weil es Wissen, Witz und Menschlichkeit so klug verbindet. Deshalb war meine Vorfreude auf "Tyll" riesig. Und ja, der Roman hat mich beeindruckt – aber nicht so, wie ich das …
Mehr
Ich liebe Daniel Kehlmann. "Die Vermessung der Welt" zählt zu meinen Lieblingsbüchern, weil es Wissen, Witz und Menschlichkeit so klug verbindet. Deshalb war meine Vorfreude auf "Tyll" riesig. Und ja, der Roman hat mich beeindruckt – aber nicht so, wie ich das erwartet hatte.
Kehlmann verlegt die Figur des Narren Ulenspiegel mitten in den Dreißigjährigen Krieg und zeigt eine Welt voller Elend, Aberglauben und Willkür. Die Sprache ist präzise, oft von einer leisen Ironie getragen, und manche Szenen sind schlicht brillant.
Und doch: Ich bin da nicht ganz hineingekommen. Die episodische Struktur – mal hier, mal dort, mal Jahre dazwischen – liess mich oft wieder neu ansetzen. Ich vermisste einen emotionalen Faden, eine Figur, an der ich wirklich hängenbleiben konnte. Tyll selbst bleibt ein Rätsel, der ist mehr Symbol als Mensch. Das ist sicherlich gewollt, aber mir hat manchmal das Herz im Text gefehlt.
Trotzdem ist Tyll ein starkes Buch. Nur ist es diesmal ein Roman, den ich mehr bewundere als liebe. Handwerklich graßartig, sprachlich virtuos, aber innerlich blieb ich ein Stück weit draußen vor der Bühne, während der Narr sein schönes Spiel trieb.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Es geht Kehlmann ganz offensichtlich nicht um die historische Aufarbeitung des langen Kriegs und auch die Figur des Eulenspiegels ist hier zeitlich nicht richtig eingeordnet. Es scheint eher um die Betrachtung des langen Krieges zu gehen, eines Glaubenskrieges, der verheerende Auswirkungen auf die …
Mehr
Es geht Kehlmann ganz offensichtlich nicht um die historische Aufarbeitung des langen Kriegs und auch die Figur des Eulenspiegels ist hier zeitlich nicht richtig eingeordnet. Es scheint eher um die Betrachtung des langen Krieges zu gehen, eines Glaubenskrieges, der verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung hat. Der Verlag hat für die Gestaltung des Einbands auf ein Gemälde von Goya zurückgegriffen, das die Wirren dieser Zeit gut einfängt.
Ich habe diesen Roman sehr gerne gelesen, da ich finde, dass er meisterlich zeigt, wie eine Gesellschaft durch lange Kriegsjahre, Unsicher- und Perspektivlosigkeit aus den Fugen geraten und manipulierbar werden kann.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch Habe noch nicht reingeschaut, Buch soll verschenkt werden .Grüße Eckhard Meisel
Eine Bewertung, die keine ist. Fragt sich nur, warum sie überhaupt verfasst wurde,
Andere Kunden interessierten sich für