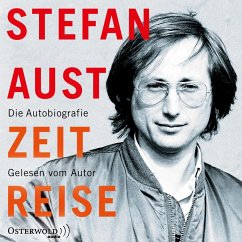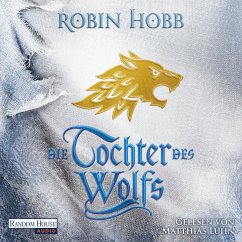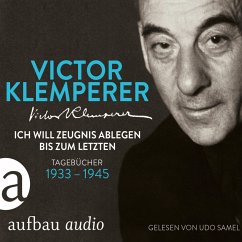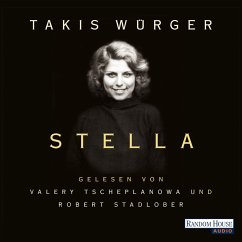Untergetaucht (MP3-Download)
Eine junge Frau überlebt in Berlin 1940 - 1945 Gekürzte Lesung. 494 Min.
Sprecher: Krebitz, Nicolette / Redaktion: Verlag, Argon
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
21,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
11 °P sammeln!
Über fünfzig Jahre danach erzählt Marie Jalowicz Simon erstmals ihre ganze Geschichte. 77 Tonbänder entstehen - sie sind die Grundlage dieses einzigartigen Zeitdokuments. Offen und schonungslos schildert Marie, was es heißt, sich Tag für Tag im nationalsozialistischen Berlin durchzuschlagen: Sie braucht falsche Papiere, sichere Verstecke und sie braucht Menschen, die ihr helfen. Vergeblich versucht sie, durch eine Scheinheirat mit einem Chinesen zu entkommen oder über Bulgarien nach Palästina zu fliehen. Sie findet Unterschlupf im Artistenmilieu und lebt mit einem holländischen Fremda...
Über fünfzig Jahre danach erzählt Marie Jalowicz Simon erstmals ihre ganze Geschichte. 77 Tonbänder entstehen - sie sind die Grundlage dieses einzigartigen Zeitdokuments. Offen und schonungslos schildert Marie, was es heißt, sich Tag für Tag im nationalsozialistischen Berlin durchzuschlagen: Sie braucht falsche Papiere, sichere Verstecke und sie braucht Menschen, die ihr helfen. Vergeblich versucht sie, durch eine Scheinheirat mit einem Chinesen zu entkommen oder über Bulgarien nach Palästina zu fliehen. Sie findet Unterschlupf im Artistenmilieu und lebt mit einem holländischen Fremdarbeiter zusammen. Immer wieder retten sie ihr ungewöhnlicher Mut und ihre Schlagfertigkeit - der authentische Bericht einer außergewöhnlichen jungen Frau, deren unbedingter Lebenswille sich durch nichts brechen ließ.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.