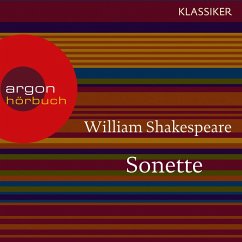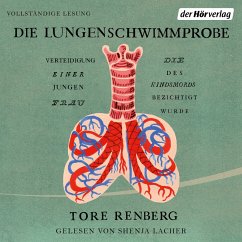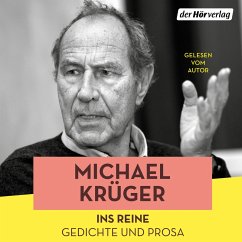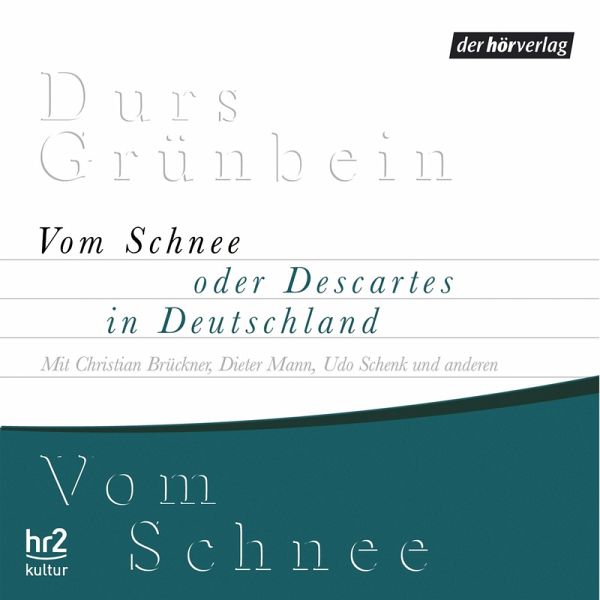
Vom Schnee oder Descartes in Deutschland (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 179 Min.
Sprecher: Schenk, Udo; Brückner, Christian; Marquitan, Christin; Mann, Dieter; Winkelmann, Helmut / Komponist: Binder, Wolfgang
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
16,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!
Wir schreiben das Jahr 1619. Deutschland friert im Jahrhundertwinter. René Descartes und sein Diener Gillot sitzen fest. Lange Spaziergänge, einsame Nächte und Gedankenspiele bestimmen ihre Tage. In hinreißend schönem und lebendigem Ton formt Durs Grünbein ein philosophisches Winterpoem, das die Gedankenwelt Descartes in seinen poetischen Bildern entfaltet und aufgehen lässt. Dieter Mann als Descartes und Udo Schenk als Gillot liefern sich Wortgefechte, die ebenso lebensklug wie komisch, ebenso melancholisch wie heiter sind. Büchnerpreisträger Durs Grünbein mit einer Hommage in Stimm...
Wir schreiben das Jahr 1619. Deutschland friert im Jahrhundertwinter. René Descartes und sein Diener Gillot sitzen fest. Lange Spaziergänge, einsame Nächte und Gedankenspiele bestimmen ihre Tage. In hinreißend schönem und lebendigem Ton formt Durs Grünbein ein philosophisches Winterpoem, das die Gedankenwelt Descartes in seinen poetischen Bildern entfaltet und aufgehen lässt. Dieter Mann als Descartes und Udo Schenk als Gillot liefern sich Wortgefechte, die ebenso lebensklug wie komisch, ebenso melancholisch wie heiter sind. Büchnerpreisträger Durs Grünbein mit einer Hommage in Stimmen an den Winter, von ihm selbst fürs Hörspiel bearbeitet (Laufzeit: 2h 59)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.