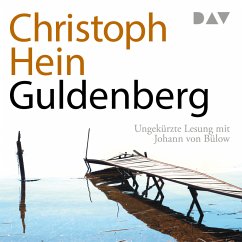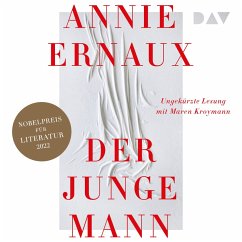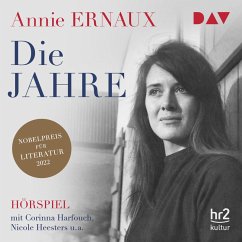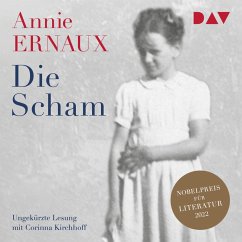Von allem Anfang an (MP3-Download)
Große Werke. Große Stimmen. Ungekürzte Lesung. 348 Min.
Sprecher: Mühe, Ulrich
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
8,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
4 °P sammeln!
Keinem darf der dreizehnjährige Daniel sagen, wohin sein Vater ihn bringen wird: nach Westberlin. Dort soll er das Gymnasium besuchen, weil ihm das in der ostdeutschen Kleinstadt nicht möglich ist. Der neue Schuldirektor warnt vor Heimatbesuchen: Es sei zu gefährlich. Auch der Autor Christoph Hein besuchte eine Schule im Westen, da er in der DDR nicht zum Abitur zugelassen wurde. Als er 1961 zu Besuch in seiner alten Heimat ist, wird er vom Mauerbau überrascht und muss bleiben. Ohne Schulabschluss schlägt er sich als Montagearbeiter, Buchhändler und Kellner durch. In seiner fiktiven Auto...
Keinem darf der dreizehnjährige Daniel sagen, wohin sein Vater ihn bringen wird: nach Westberlin. Dort soll er das Gymnasium besuchen, weil ihm das in der ostdeutschen Kleinstadt nicht möglich ist. Der neue Schuldirektor warnt vor Heimatbesuchen: Es sei zu gefährlich. Auch der Autor Christoph Hein besuchte eine Schule im Westen, da er in der DDR nicht zum Abitur zugelassen wurde. Als er 1961 zu Besuch in seiner alten Heimat ist, wird er vom Mauerbau überrascht und muss bleiben. Ohne Schulabschluss schlägt er sich als Montagearbeiter, Buchhändler und Kellner durch. In seiner fiktiven Autobiographie erzählt Hein von einer Jugend in der DDR der 50er-Jahre.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.




heike-s.jpg)