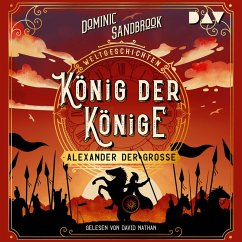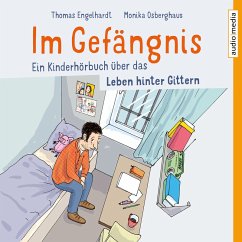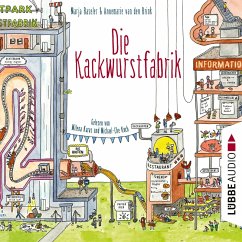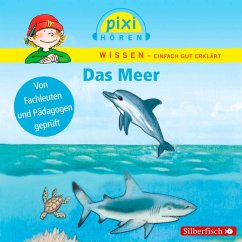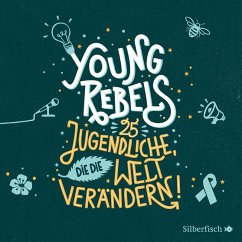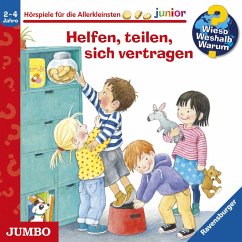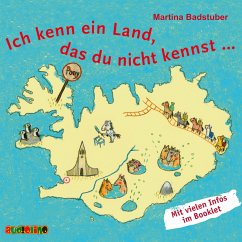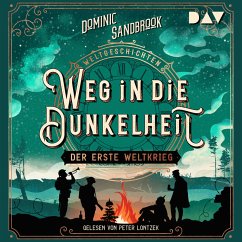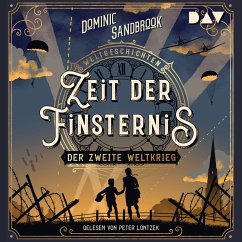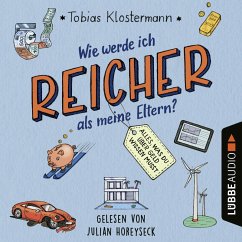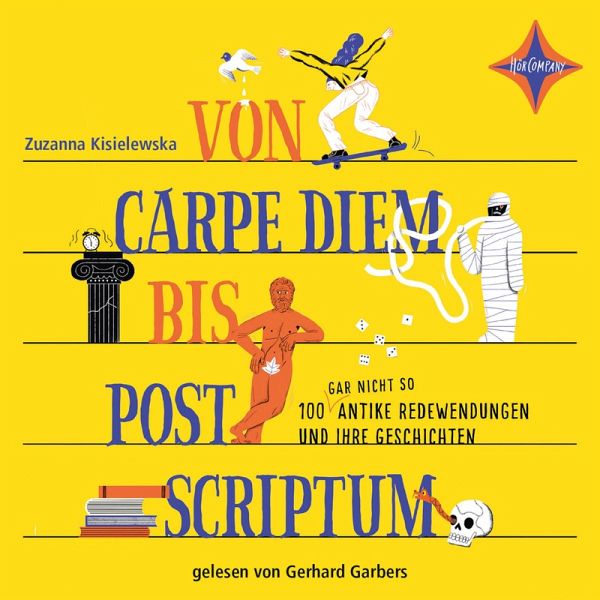
Von Carpe Diem bis Post Scriptum (MP3-Download)
100 (gar nicht so) antike Redewendungen und ihre Geschichten Ungekürzte Lesung. 99 Min.
Sprecher: Garbers, Gerhard

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!
Wie konnte eine Feige einen Krieg auslösen? Welcher römische Kaiser wird von einem bedeutenden Rapper zitiert? Warum bedeutet es Schlechtes, wenn es heißt: "Hannibal ante portas"? Und warum rufen wir auch heute noch "Heureka!", wenn wir einen genialen Einfall haben? Die Antworten darauf finden sich in dieser originellen Zusammenstellung vieler lateinischer und und ein paar griechischer Redensarten, die zeigt: So verstaubt sind die Sprüche von damals gar nicht! Sei es das "Corpus delicti" im Lieblingskrimi oder das zeitlose Motto "Carpe Diem" auf der Geburtstagskarte - antike Sätze beg...
Wie konnte eine Feige einen Krieg auslösen? Welcher römische Kaiser wird von einem bedeutenden Rapper zitiert? Warum bedeutet es Schlechtes, wenn es heißt: "Hannibal ante portas"? Und warum rufen wir auch heute noch "Heureka!", wenn wir einen genialen Einfall haben? Die Antworten darauf finden sich in dieser originellen Zusammenstellung vieler lateinischer und und ein paar griechischer Redensarten, die zeigt: So verstaubt sind die Sprüche von damals gar nicht! Sei es das "Corpus delicti" im Lieblingskrimi oder das zeitlose Motto "Carpe Diem" auf der Geburtstagskarte - antike Sätze begegnen uns auch heute noch überall. Zuzanna Kisielewska spürt sie in Graffitis oder Songtexten auf und enthüllt die Herkunft alltäglicher Lebenswahrheiten. Hätten Sie's gewusst? Gerhard Garbers staubt seine Lateinkenntnisse ab und liest den unterhaltsamen Ratgeber für Jung und Alt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.