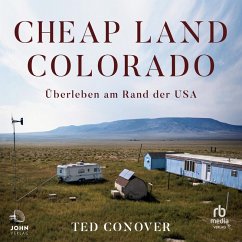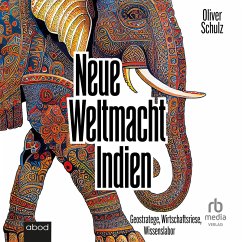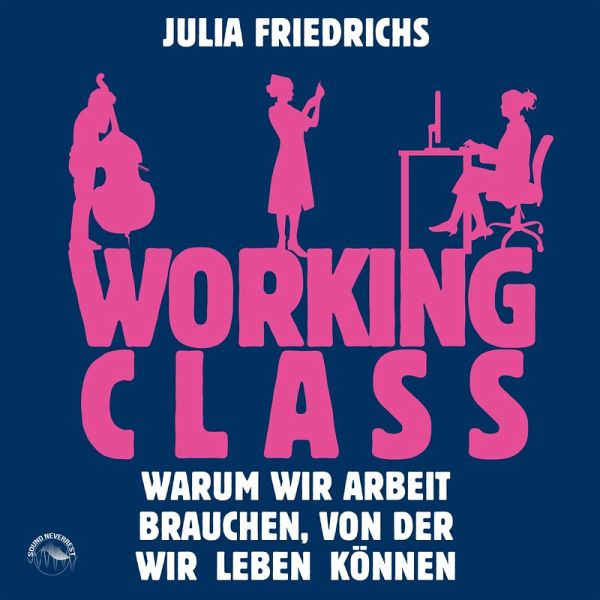
Working Class (MP3-Download)
Warum wir Arbeit brauchen von der wir leben können Ungekürzte Lesung. 553 Min.
Sprecher: Vanroy, Funda
Sofort per Download lieferbar
19,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!
Gewinner und Verlierer im Ungleichland - eine schonungslose Analyse der sozialen Ungerechtigkeit in Deutschland... Journalistin und Autorin Julia Friedrichs hinterfragt mit ihrem beeindruckenden und aufrüttelnden Sachbuch "Working Class: Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können" die Wohlstandsillusion. In Zeiten der prekären Arbeitsverhältnisse und des Lohndumpings ist der Vermögensaufbau aus eigener Kraft für die meisten Bundesbürger unmöglich. Soziale Durchlässigkeit für die Mitglieder der Working Class und damit ein Aufstieg in höhere Gesellschaftsschichten hat sich eb...
Gewinner und Verlierer im Ungleichland - eine schonungslose Analyse der sozialen Ungerechtigkeit in Deutschland... Journalistin und Autorin Julia Friedrichs hinterfragt mit ihrem beeindruckenden und aufrüttelnden Sachbuch "Working Class: Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können" die Wohlstandsillusion. In Zeiten der prekären Arbeitsverhältnisse und des Lohndumpings ist der Vermögensaufbau aus eigener Kraft für die meisten Bundesbürger unmöglich. Soziale Durchlässigkeit für die Mitglieder der Working Class und damit ein Aufstieg in höhere Gesellschaftsschichten hat sich ebenfalls deutlich erschwert. Der reiche Teil der Bevölkerung hält an einem Großteil des Vermögens fest und hat Mittel und Wege, diesen Reichtum schnell und einfach zu vervielfachen. Ärmeren Gesellschaftsschichten bleibt währenddessen gerade noch genug zum Leben. "Ihr werdet es einmal schlechter haben!" Die Generation nach den Babyboomern ist die erste nach dem Zweiten Weltkrieg, die ihre Eltern mehrheitlich nicht wirtschaftlich übertreffen wird. Obwohl die Wirtschaft ein Jahrzehnt lang wuchs, besitzt die Mehrheit in diesem Land kaum Kapital, kein Vermögen. Doch sich Wohlstand aus eigener Kraft zu erarbeiten ist schwieriger geworden, insbesondere für die, die heute unter 45 sind. Die Hälfte von ihnen fürchtet, im Alter arm zu sein. Julia Friedrichs zeichnet ein sehr düsteres Bild von einem Land und einer Welt, in der eine blühende Mittelschicht und soziale Gerechtigkeit eher eine vage Erinnerung als eine zeitgemäße Realität sind. Trotz ihrer ernüchternden Erkenntnisse entwirft sie einige inhaltsreiche Ideen, die aus dieser Krise hinausführen könnten. Die verschwundene Mittelschicht - wie das Leben der modernen Arbeiterklasse wirklich aussieht Julia Friedrichs interviewt Experten aus der Wissenschaft und Politiker. Sie fokussiert sich aber auch auf Menschen, die jeden Tag putzen, unterrichten und ins Büro gehen, um ihr Überleben zu sichern, und dabei nicht genug für die Rente oder den Vermögensaufbau verdienen. Der Wunsch nach gesellschaftlichen Umwälzungen ist bei dieser Lektüre vorprogrammiert. Nominiert für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2021 "Menschennah, aber kitschfrei, präzise und durch Daten, Fakten und Analysen von Ökonomen gestützt, erzählt Friedrichs vom wachsenden Reichtum weniger auf Kosten vieler, wie und seit wann Kapital Arbeit schlägt." -- Corinna Nohn - Handelsblatt
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.