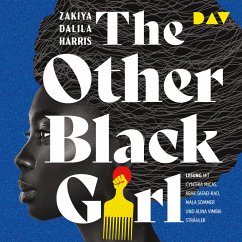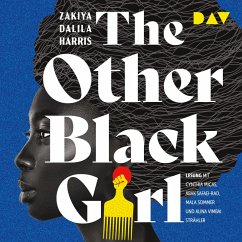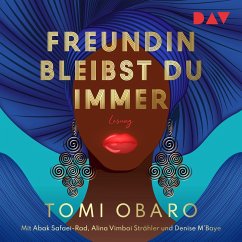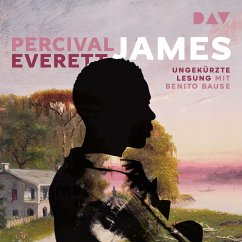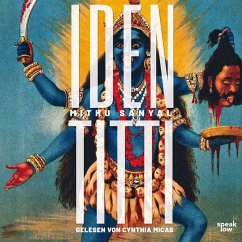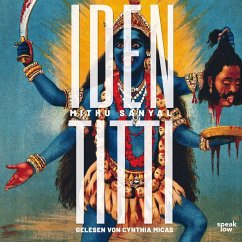Natasha Brown
Hörbuch-Download MP3
Zusammenkunft (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 152 Min.
Sprecher: Bailey, Benita Sarah / Übersetzer: Thomae, Jackie

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!





Sie ist jung und erfolgreich, als Schwarze Frau hat sie es in den Olymp der Londoner Hochfinanz geschafft. Ihr Freund kommt aus dem alten Empire, aus betuchtem Hause. Doch als sie zu einer Gartenparty bei seiner Familie eingeladen wird, muss sie am eigenen Körper erfahren, dass erlittenes Unrecht tiefere Wurzeln geschlagen hat, als sie dachte. Ein außergewöhnlicher Roman, der die toxische Wirkung der Vergangenheit in unseren Worten und in unserem Besitz nachzeichnet. Natasha Brown macht das Drama der Gegenwart erfahrbar, das sich aus dem jahrhundertalten Erbe von Sexismus, Rassismus, Klassi...
Sie ist jung und erfolgreich, als Schwarze Frau hat sie es in den Olymp der Londoner Hochfinanz geschafft. Ihr Freund kommt aus dem alten Empire, aus betuchtem Hause. Doch als sie zu einer Gartenparty bei seiner Familie eingeladen wird, muss sie am eigenen Körper erfahren, dass erlittenes Unrecht tiefere Wurzeln geschlagen hat, als sie dachte. Ein außergewöhnlicher Roman, der die toxische Wirkung der Vergangenheit in unseren Worten und in unserem Besitz nachzeichnet. Natasha Brown macht das Drama der Gegenwart erfahrbar, das sich aus dem jahrhundertalten Erbe von Sexismus, Rassismus, Klassismus und Kolonialismus ergibt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Natasha Brown arbeitete nach ihrem Mathematikstudium an der Universität Cambridge zehn Jahrelang im Londoner Finanzsektor. Mit ihrem Roman Zusammenkunft gelang ihr eines der erfolgreichsten literarischen Debüts Englands der letzten Jahre. Er stand auf der Shortlist des Folio Prize, des Goldsmiths Prize und des Orwell Prize und wurde in 17 Sprachen übersetzt. Natasha Brown gehört zu den alle zehn Jahre ernannten Grantäs Best of Young British Novelists. Jackie Thomae, geboren 1972 in Halle, aufgewachsen in Leipzig, ist Journalistin, Fernsehautorin und Schriftstellerin. Mit ihrem Roman Brüder wurde sie für den Deutschen Buchpreis 2019 nominiert und mit dem Düsseldorfer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Seit 1989 lebt sie in Berlin.
Produktdetails
- Verlag: Der Audio Verlag
- Gesamtlaufzeit: 152 Min.
- Erscheinungstermin: 16. Februar 2022
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783742423252
- Artikelnr.: 63289300
»Was die eigentliche Schlagkraft von Natasha Browns Roman ausmacht und ihn verstörend sein lässt, ist die Intensität ihrer Selbstbefragung ...« Rose-Maria Gropp Frankfurter Allgemeine Zeitung 20220517
Thunderbolt and Lightning
Wie ein Blitz ist dieses Buch. Unglaublich grell. Und schnell vorbei. Viel zu schnell? Nein. Sein Nachhall, der Donner, wirkt lange und laut.
Die Protagonistin arbeitet im Finanzsektor. Hat sich aus prekären Verhältnissen hochgearbeitet. Führende …
Mehr
Thunderbolt and Lightning
Wie ein Blitz ist dieses Buch. Unglaublich grell. Und schnell vorbei. Viel zu schnell? Nein. Sein Nachhall, der Donner, wirkt lange und laut.
Die Protagonistin arbeitet im Finanzsektor. Hat sich aus prekären Verhältnissen hochgearbeitet. Führende Position, Eigentumswohnung in London, keinerlei Sorgen. Finanzieller Art. Denn sie ist eine Frau. Und schwarz. Und somit Opfer von Sexismus und Rassismus. Mal offen und direkt, wie bei einer Begegnung mit einem Betrunkenen in der Bahnstation. Meist versteckt oder (gar-nicht-mal-so-)nett verpackt, in zynischen Bemerkungen von Kollegen oder den Eltern ihres Freundes, die sie eh nur als „die aktuelle Freundin ihres Sohnes“ sehen.
Natasha Brown erzählt ihre Geschichte, aber auch die einer ganzer Generation von Menschen anderer Herkunft, von Frauen, von Rollenbildern und Rollen in diesem Theater, das wir Leben nennen. Ohne etwas vorweg nehmen zu wollen, um den Nachhall dieses Buches nicht zu zerstören: Manche Themen sind in den letzten Jahren publik geworden dank #metoo und BLM, manche sind neu, aber eigentlich auch nur für die Leser:innen, die nicht davon betroffen sind, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben.
Brown gelingt dabei eine starke Dramaturgie – von „random Einzelfällen“ (die natürlich keine sind) zum Leben der Protagonistin. Von ihrem Berufsalltag hin zu ihrer Beziehung mit einem Sohn reicher, einflussreicher Eltern und weiter zu ihrer Krebserkrankung, die sie nicht behandeln lassen möchte, da der Krebs der Gesellschaft mehr schmerzt als der in ihrer Brust.
Und obwohl „Zusammenkunft“ so kurz wie eine Novelle erscheint, so steckt auf den 113 Seiten mehr als in manchem 400 Seiten-Roman. Mehr Inhalt, mehr Tiefe, mehr Gewicht. Es ist schnell gelesen. Aber vorbei ist es damit noch lange nicht. Achtet auf den Nachhall – und nehmt etwas davon mit in euer Verhalten!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Zusammenkunft, von Natasha Brown
Cover:
Das Cover und der Titel sind für mich völlig willkürlich und ich kann keinen Bezug zum Buch finden.
Inhalt:
Eine dunkelhäutige Frau (die namenlos bleibt) erzählt in der ICH Perspektive von ihrem Leben in der Londoner …
Mehr
Zusammenkunft, von Natasha Brown
Cover:
Das Cover und der Titel sind für mich völlig willkürlich und ich kann keinen Bezug zum Buch finden.
Inhalt:
Eine dunkelhäutige Frau (die namenlos bleibt) erzählt in der ICH Perspektive von ihrem Leben in der Londoner Oberschicht. Von ihrem Kampf nach oben. Von Rassismus und sonstigen „Anfeindungen“.
Meine Meinung:
Ein Buch mit nur 114 Seiten, mit dem ich überhaupt nicht klar gekommen bin.
Vor allem der Schreibstil macht mir zu schaffen. Kurze abgehakter Sätze, Zeitsprünge, konfus aneinander gereihte kleine Abschnitte, einzelne Tatsachen für mich ohne Zusammenhang, vieles wird angedeutet, aber nicht zu Ende erzählt – klar, es geht um Rassismus, trotzdem Frage ich mich am Ende des Buches: was wollte de Autorin mir sagen?
Meine Distanz und mein Unverständnis, auch der Protagonistin gegenüber, sind beim Lesen immer größer geworden. Die Protagonistin blieb für mich immer „gesichtslos“. Ich habe keinen Zugang gefunden.
Absolut nicht mein Buch.
Autorin:
Natasha Brown arbeitete nach ihrem Mathematikstudium an der Universität Cambridge für zehn Jahre im Londoner Finanzsektor. 2019 gewann sie den London Writers Award und konzentriert sich fortan auf das Schreiben.
Mein Fazit:
Ein Buch mit einem wichtigen Thema.
Aber es erreicht mich nicht und lässt mich ratlos und verwirrt zurück.
Deshalb von mir (fürs wichtige Thema) 2 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Geschichte einer verletzten Seele
Natasha Brown kannte ich bisher nicht, bin aber überzeugt davon, dass man von ihr noch einiges hören wird. Bereits zu Beginn der Geschichte spuckt sie uns Sätze entgegen, die ihre gefühlte Erniedrigung und ihren Ekel transportieren. …
Mehr
Geschichte einer verletzten Seele
Natasha Brown kannte ich bisher nicht, bin aber überzeugt davon, dass man von ihr noch einiges hören wird. Bereits zu Beginn der Geschichte spuckt sie uns Sätze entgegen, die ihre gefühlte Erniedrigung und ihren Ekel transportieren. Reflektiert und detailliert schildert 'sie', die Protagonistin, ihre verwirrende, verstörende und schonungslose Gedankenwelt. Sie hat sich nach oben gekämpft, ist intelligent und erfolgreich und sieht sich dennoch konfrontiert mit abschätzigen Bemerkungen und 'männlichem' Verhalten ihrer Kollegen zu ihrem 'Schwarzsein' und 'Frausein'. Sie ist eine Meisterin der Verdrängung, sogar ihrer Krankheit, dem Krebs - doch zu welchem Preis? Sie schafft es mit 'ihm, dem Sohn' in den Olymp der besitzenden Weißen aufzusteigen und teilnehmen zu dürfen an der Zusammenkunft. Doch will sie das alles wirklich?
Das Buch ist ungewöhnlich geschrieben, fordert mich als Lesende zu hoher Konzentration, um den Gedankenfetzen folgen zu können und doch bleibt für mich vieles offen. Einerseits finde ich das schade, andererseits bietet es viel Raum für meine eigene Interpretation. Ich hatte das Gefühl im Kopf von 'ihr', der Protagonistin, zu sitzen und dort jedes Wort, direkt an mich gerichtet, aufzunehmen. Insgesamt ist 'Zusammenkunft' ein bedrückender, aber auf alle Fälle lesenswerter Roman, zu einem höchst aktuellen Thema unserer Zeit, betrachtet durch die Augen einer betroffenen schwarzen Frau.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
schwieriges Buch
Die Runde bei Lesenswert war sich nicht einig. Gratulation an Ijoma Mangold, der die Mängel am besten auf den Punkt brachte.
Die Erzählung, die ich nicht Roman nennen würde, wirkte auf mich wie ein Werk einer diskriminierten Amerikanerin. Leerstellen waren …
Mehr
schwieriges Buch
Die Runde bei Lesenswert war sich nicht einig. Gratulation an Ijoma Mangold, der die Mängel am besten auf den Punkt brachte.
Die Erzählung, die ich nicht Roman nennen würde, wirkte auf mich wie ein Werk einer diskriminierten Amerikanerin. Leerstellen waren insofern gut, dass ich das Büchlein schnell gelesenen habe. Viel behalten habe ich aber nicht, die Beschreibung von Abbildung, die man nicht sieht, sind mir noch in Erinnerung.
Da ich das schnelle Ende erlebt habe, gibt es nach meinen Kriterien 2 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Poetischer Rückblick
Natasha Browns Roman wirkt schmal mit seinen 113 Seiten. Dennoch ist dessen Inhalt nicht weniger wichtig.
Wir erfahren vom Leben einer jungen, schwarzen Frau, die in England lebt. Während das Grundgerüst des Buches ein einfaches Wochenende bei den Eltern …
Mehr
Poetischer Rückblick
Natasha Browns Roman wirkt schmal mit seinen 113 Seiten. Dennoch ist dessen Inhalt nicht weniger wichtig.
Wir erfahren vom Leben einer jungen, schwarzen Frau, die in England lebt. Während das Grundgerüst des Buches ein einfaches Wochenende bei den Eltern ihres Freundes beschreibt, webt Natasha Brown immer wieder Erinnerungsschnipsel der Protagonistin in den Hauptbericht mit ein. So geht es um Sexismus am Arbeitsplatz, Rassismus, Kolonialisierung, Macht und die britische Gesellschaft.
Durch das ganze Buch zieht sich das Thema, dass die Protagonistin angekommen ist in der britischen Gesellschaft, jedoch nur nach außen hin. Im inneren fühlt sie sich immer noch nicht akzeptiert, ausgegrenzt vom Rest der weißen, britischen Mehrheitsgesellschaft.
Brown stellt schwerwiegende Fragen wie, Wieso überhaupt weiterleben, wenn die man sich nie richtig zugehörig fühlen wird? All diese Aspekte erforscht sie mit einem poetischen, bildlichen Schreibstil, der es schafft, kleine, unwichtig scheinende Momente detailliert zu beschreiben - ein Bild zu zeichnen.
Mir hat dieses Buch sehr gut gefallen, ich mag Browns lyrischen Schreibstil, der mit einem einfacheren, alltäglichen Schreibstil gepaart wird. Mir gefällt auch, dass sie Beispiele aus dem echten Leben aufgreift und den Text auf den Seiten nach Sinneseindrücken ordnet.
Der Roman ist kurzweilig, aber dennoch in seiner Themenvielfalt wichtig. Wer den Roman von Yrsa Daley-Ward "Alles, was passiert ist" gelesen hat und mochte, wird mit Natasha Brown genauso glücklich werden!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Starkes Debüt über Rassismus, Seximus und Leistungsgesellschaft - eine brilliante Gesellschaftskritik
In «Zusammenkunft» (im Original: Asseemby; übersetzt ins Deutsche von Jackie Thomae) analysiert und kritisiert die Autorin Natasha Brown in erzählerischen …
Mehr
Starkes Debüt über Rassismus, Seximus und Leistungsgesellschaft - eine brilliante Gesellschaftskritik
In «Zusammenkunft» (im Original: Asseemby; übersetzt ins Deutsche von Jackie Thomae) analysiert und kritisiert die Autorin Natasha Brown in erzählerischen Handlungsfragmenten den Rassismus, Sexismus und den enormen Leistungsdruck in der britischen Gesellschaft und insbesondere der Upper Class. Die namenlose Ich-Erzählerin ist schwarz und hat sich ihre Führungsposition in einem Finanzdienstleistungsunternehmen nach ihrem Oxford-Studium hart erarbeitet. Oberflächlich scheint alles gut zu laufen im Job, mit der eigenen Wohnung in London, in der Partnerschaft mit ihrem Upper-Class Freund und dessen Familie. Dennoch zeigen die geschilderten Gedanken der Protagonistin ganz pointiert, was alles nicht gut läuft und wie stark der hohe Leistungsdruck und die Diskrimmierungen belasten und welchem psychischen Druck und Belästigung sie dadurch ausgesetzt ist. Dies zeigt sich vor allem in ihrem Umgang mit dem bei Ihr diagnostizierten Krebs.
In kurzen Szenen und brilliant formuliert gelingt es Natasha Brown den allgegenwärtigen Rassismus, Seximus und Leistungsdruck herauszustellen und pointiert zu kritisieren. Ein starkes Debüt, das es auf wenigen Seiten schafft, viel Emotion und gerechtfertigte Kritik zu transportieren!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Anstrengende Gesellschaftskritik
Ich war sehr neugierig auf den Debütroman von Natasha Brown, da das 114 Seiten umfassende Buch überwiegend positiv besprochen wurde und in England als das erfolgreichste literarische Debüt des Jahres 2021 bezeichnet wird.
Der Roman …
Mehr
Anstrengende Gesellschaftskritik
Ich war sehr neugierig auf den Debütroman von Natasha Brown, da das 114 Seiten umfassende Buch überwiegend positiv besprochen wurde und in England als das erfolgreichste literarische Debüt des Jahres 2021 bezeichnet wird.
Der Roman erzählt die Geschichte einer dunkelhäutigen Britin jamaikanischer Herkunft, die aus sehr einfachen Verhältnissen stammt. Mit viel Ehrgeiz und Fleiß hat sie es zur erfolgreichen Investmentbankerin gebracht. Nahezu täglich ist sie Rassismus und Sexismus ausgesetzt.
Die namenlose Ich-Erzählerin bereitet sich auf ein Gartenfest der Eltern ihres wohlhabenden weißen Freundes vor und lässt währenddessen ihren Gedanken freien Lauf. Einen Schwerpunkt dabei bildet die Auseinandersetzung mit einem gesundheitlichen Problem. Sie ist an Krebs erkrankt und muss wichtige Entscheidungen treffen.
Der unzusammenhängende und verwirrende Stil des Buches hat mich nicht begeistert. Ohne Zweifel ist "Zusammenkunft" ein scharfsinniger Roman mit einem sehr wichtigen Thema, der mich allerdings nicht in seinen Bann ziehen konnte. Die Protagonistin ist mir fremd geblieben und hat mich emotional nicht berührt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Vor einer Weile habe ich schon einmal Natasha Browns "Assembly" begonnen zu lesen, aber irgendwie packte mich dieser Roman so gar nicht. Zu sehr störte mich das Fragmentarische, die Sprünge zwischen einzelnen Themen und Szenen und ich verlor schnell das Interesse. Und das …
Mehr
Vor einer Weile habe ich schon einmal Natasha Browns "Assembly" begonnen zu lesen, aber irgendwie packte mich dieser Roman so gar nicht. Zu sehr störte mich das Fragmentarische, die Sprünge zwischen einzelnen Themen und Szenen und ich verlor schnell das Interesse. Und das eigentlich gar nicht mal aufgrund des Inhalts, denn Natasha Brown zeigt hier sehr eindrucksvoll, welchen Herausforderungen sich PoC in der heutigen Zeit stellen müssen, wie sie stets beäugt, befragt, rassistisch angegangen werden. Aber ich konnte einfach keine Nähe zur Protagonistin aufbauen und vieles plätscherte dann nur dahin, verwirrte mich und meine Englischkenntnisse stießen an ihre Grenzen (zumindest dachte ich das). Daher war ich nun auch ganz froh, dass . "Assembly" vor einer Weile auf Deutsch in der Übersetzung von Jackie Thomae erschienen ist und so wollte ich "Zusammenkunft" eine erneute Chance geben, und mich dem Leben der Protagonistin nähern. Diese nimmt die Leser*innen mit in ihren Alltag, zwischen Arbeit, Familie, Aufopferung, Aufstieg und tief verankertem Fallen. Die toxische Vergangenheit, Rassismus, Anfeindungen, Abwertungen holen viele PoC und auch sie ständig ein. Und dann sehen sie sich, neben all ihren anderen Problemen, ständig damit konfrontiert. Es ist ein Roman zwischen Aufklärung und bekanntem Schubladendenken, der deutlich die Unterschiede zwischen Klassen, Arbeit, Werten, Geschlechtern, Herkunft und Besitz darstellt. Und das, obwohl wir Menschen ja alle immer so tolerant und weltoffen sind. Das ist teilweise schon sehr bedrückend und erschreckend.
Was heißt es dazuzugehören und gefühlt doch nicht dazugehören, nie so akzeptiert zu sein wie 'die anderen'... man mag es sich gar nicht so genau vorstellen und doch erleben das tagtäglich viel zu viele Menschen in der Welt und eben auch die Protagonistin in England.
"Ich habe mein Leben immer nach dem Prinzip gelebt, dass ich, wann immer mir ein Problem begegnet, dann arbeiten muss, eine Handlung zu finden, um es zu überwinden; oder Platz dafür zu schaffen; oder einen Weg außen herum zu schlagen; oder sogar den Boden darunter abzutragen. So wurde ich aufs Leben vorbereitet. So bereiten wir uns selbst vor, das bringen wir unseren Kindern bei, um an diesen Ort heranzugehen, an dem Hindernis auf Hindernis folgt. Arbeite doppelt so hart. Sei doppelt so gut. Und immer, pass dich an."
Dieses Buch ist voll von Augenöffnern, erschreckenden Aussagen oder auch Begegnungen. Also dafür schätze ich diesen Roman wirklich sehr und ich habe mal wieder die Lage der PoC in dieser weißgeprägten Welt kennenlernen müssen, verstanden, aktiv durchdacht und hoffe nun sensibler an eben jene Themen heranzutreten. Es ist ein erschreckender Spiegel und doch wünschte ich mir für einen Roman, dass alles zusammenhängender, packender und wahrscheinlich auch durchrüttelnder erzählt werden würde. Ich hadere, es ist keine wirkliche Leseempfehlung von mir und doch würde ich sagen, dass es ein wichtiges Buch ist, dass man als Weiße*r mal gelesen haben sollte. Doch, doch.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Unbedingt lesen!
Brauchen wir noch ein Buch über Diskriminierung, Frauenhass und Alltagsrassismus? Ja, unbedingt, wenn es sich dabei um ein solches Meisterwerk wie „Zusammenkunft“ der britischen Autorin Natasha Brown handelt. Der Roman handelt von einer jungen Frau, die es bis …
Mehr
Unbedingt lesen!
Brauchen wir noch ein Buch über Diskriminierung, Frauenhass und Alltagsrassismus? Ja, unbedingt, wenn es sich dabei um ein solches Meisterwerk wie „Zusammenkunft“ der britischen Autorin Natasha Brown handelt. Der Roman handelt von einer jungen Frau, die es bis nach ganz oben in der britischen Finanzwelt geschafft hat. Ein paar Tage lang begleiten wir sie zu Werbeveranstaltungen, in die Chefetage und zum Besuch bei der Familie ihres Partners - alter, englischer Geldadel. Doch was ist dabei nun anders als in all den anderen Romanen zum selben Thema, die gerade den Buchmarkt fluten?
Zuerst ist da Natasha Browns Art, Rassismus und Misogynie zu thematisieren. Gerade in der ersten Hälfte des Buches scheint auf den ersten Blick alles „normal“ zu sein. Was ist daran verkehrt, wenn die Protagonistin den männlichen Kollegen Kaffe kocht, wenn die Empfangsdame weg ist? Ist es nicht enorm wichtig, bei einem Vortrag gut akzentuiert zu sprechen? Und wenn der Bauarbeiter von denen und uns spricht, dann ist das doch eher auf seine mangelnde Bildung als auf rassistische Absichten zurückzuführen - oder? Der*die Leser*in muss also ständig auf der Hut sein, Zusammenhänge zwischen selbst erkennen und sich so das eigentliche Thema erschließen. Die späteren streams of conscious bieten reichlich Verknüpfungsangebote. Grandios erzählt - nicht zuletzt auf Grund der treffenden Metaphern, die Kompliziertes und Unbeschreibbares greifbar machen. Besonders hervorzuheben sind hier auch die „Abbildungen“-Texte im hinteren Teil, auf die ich an dieser Stelle inhaltlich nicht genauer eingehen möchte, die aber enorm viel Unbehagen beim Lesen wecken.
Zum anderen stellt die Autorin durch ihre Protagonistin die richtigen Fragen: Über welchen Teil des Lebens bestimmen wir wirklich selbst, wenn sogar die Körper im Zuge der Ausbeutung angeeignet wurden? Ist es dann nur noch die Form des Todes, die uns eine Wahl lässt? Was bestimmt über unsere Identität - Geld, Herkunft, Kollektive Erinnerungen, Kulturelles Kapital, der Familienname? Dabei gelingt Brown das Kunststück, keine Platten Antworten zu liefern, sondern dem*der Leser*in die Antwort zu überlassen. So kommt es, dass sich das Buch stellenweise eher wie ein Essay als wie ein Roman liest.
Mein Fazit: Ich kann den Hype um das Buch in Großbritannien absolut nachvollziehen. Für mich eines der besten Bücher zum Thema - sowohl inhaltlich als auch sprachlich. Absolute Leseempfehlung
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Starkes Buch, spannendes Thema
Natasha Browns Debütroman war bereits ein großer Erfolg in UK. Nun dürfen sich auch die deutschen Leser*innen über "Zusammenkunft" freuen.
Inhaltlich geht es um eine junge Person of Colour, die sich in der Londoner Finanzbranche mit …
Mehr
Starkes Buch, spannendes Thema
Natasha Browns Debütroman war bereits ein großer Erfolg in UK. Nun dürfen sich auch die deutschen Leser*innen über "Zusammenkunft" freuen.
Inhaltlich geht es um eine junge Person of Colour, die sich in der Londoner Finanzbranche mit viel Kraft nach oben gekämpft hat. Offener Alltagsrassismus begleiten sie ebenso wie versteckte Angriffe auf ihre Hautfarbe. Beruflich wird ihr oft vorgeworfen, dass sie nur so weit gekommen wäre, weil Diversity gerade wichtig sei. Die Protagonistin hat auf den ersten Blick alles, doch was bedeutet das? Ein starkes Zitat aus dem Roman, das mich bewegt hat, war Folgendes: "Aber das, was du brauchst, um dorthin zu kommen, ist nicht das, was du brauchst, sobald du dort angekommen bist." Neben der Geschichte der Ich-Erzählerin und ihre Suche nach Herkunft und Heimat, wird auch der Umgang Großbritanniens mit Einwander*innen thematisiert - und der Zum Teil wirklich erschreckend.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich ziehe allerdings einen Stern ab, da ich etwas gebraucht habe, um mich in die Geschichte einzufinden. Am Anfang war es etwas wild und zum Teil unterscheiden sich die Erzählweisen und der Sprachstil von Abschnitt zu Abschnitt. Zudem finde ich es sehr schade, dass die Ich-Erzählerin doch etwas anonym und distanziert wirkt. Ansonsten liest es sich sehr schön und die Sprache des Buchs ist sehr poetisch, ohne zu kompliziert zu werden.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für