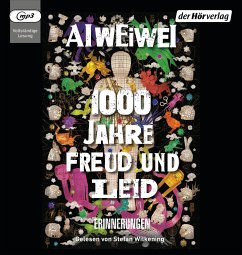Einer der größten Künstler unserer Zeit erzählt sein Leben vor dem Hintergrund der Geschichte Chinas
In seinen Erinnerungen schildert Ai Weiwei seinen künstlerischen Werdegang vor dem Hintergrund der Geschichte seiner Familie. Sein Vater Ai Qing war einst ein enger Vertrauter Mao Zedongs und Chinas einflussreichster Dichter. Im Zuge der Kulturrevolution brandmarkte man Ai Qing als »Rechtsabweichler« und verurteilte ihn zu Zwangsarbeit. Die gesamte Familie wurde in einen abgelegenen Teil des Landes verbannt, der als »Klein-Sibirien« bekannt war. Ai Weiwei erzählt von seiner Kindheit dort und der schwierigen Entscheidung, seine Familie zu verlassen, um für ein Kunststudium in die USA zu gehen. Dort freundete er sich mit Allen Ginsberg an und ließ sich von Marcel Duchamp und Andy Warhol inspirieren. Aufrichtig und geistreich beschreibt Ai Weiwei seine Rückkehr nach China, seinen Aufstieg zum Star der Kunstwelt und seine Entwicklung zum internationalen Menschenrechtsaktivisten.
Ungekürzte Lesung mit Stefan Wilkening
2 MP3-CDs, 14h 26min
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
In seinen Erinnerungen schildert Ai Weiwei seinen künstlerischen Werdegang vor dem Hintergrund der Geschichte seiner Familie. Sein Vater Ai Qing war einst ein enger Vertrauter Mao Zedongs und Chinas einflussreichster Dichter. Im Zuge der Kulturrevolution brandmarkte man Ai Qing als »Rechtsabweichler« und verurteilte ihn zu Zwangsarbeit. Die gesamte Familie wurde in einen abgelegenen Teil des Landes verbannt, der als »Klein-Sibirien« bekannt war. Ai Weiwei erzählt von seiner Kindheit dort und der schwierigen Entscheidung, seine Familie zu verlassen, um für ein Kunststudium in die USA zu gehen. Dort freundete er sich mit Allen Ginsberg an und ließ sich von Marcel Duchamp und Andy Warhol inspirieren. Aufrichtig und geistreich beschreibt Ai Weiwei seine Rückkehr nach China, seinen Aufstieg zum Star der Kunstwelt und seine Entwicklung zum internationalen Menschenrechtsaktivisten.
Ungekürzte Lesung mit Stefan Wilkening
2 MP3-CDs, 14h 26min
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Dieses Werk verdankt sich der politischen Opposition: Ai Weiwei erzählt von seiner künstlerischen Entwicklung und vom Leben seines Vaters.
Die Idee zu diesem Buch sei ihm in den geheimen Verliesen der chinesischen Staatssicherheit in Peking gekommen, als er an all die Demütigungen gedacht habe, die sein Vater, der bekannte Schriftsteller Ai Qing, jahrzehntelang über sich ergehen lassen musste. Auch Ai Weiwei war zum Staatsfeind erklärt und 2011 in Gewahrsam genommen worden. Nachdem seine Isolationshaft nach 81 Tagen unvermittelt endete, versammelte er ein Team aus Autoren um sich und recherchierte die Lebensgeschichte seines Vaters, um sie gemeinsam mit seiner eigenen Vita zu erzählen.
Fast die Hälfte seiner Erinnerungen widmet Ai Weiwei der Biographie des Vaters, der Geschichte von Haft, Verbannung, Zwangsexil eines Dichters, dem selbst seine späte Rehabilitierung in den Siebzigerjahren noch als Akt selbstherrlicher staatlicher Willkür erscheinen muss. Ai Qing, Kopf der "Neuen Lyrik", war 1941 als Mitglied der Kommunistischen Partei von den Nationalisten hinter Gitter gebracht worden, wurde dann unter Mao, den er ebenso wie den Parteiführer Zhou Enlai persönlich kannte, als "Rechtsabweichler" stigmatisiert, um während der Kulturrevolution 1967 abermals - nun als Urheber bourgeoiser Literatur - gesellschaftlich gebrandmarkt zu werden.
Sein Sohn hatte die Drangsalierungen in jungen Jahren selbst zu spüren bekommen, konnte die politischen Hintergründe und Verwerfungen aber natürlich nicht ermessen. Das holt er in seinen Erinnerungen nach und zeichnet in metapherngesättigter Sprache das Generationenporträt eines unbeugsamen Dissidententums.
Der 1957 geborene Ai Weiwei erweist sich als erstaunlich versierter Autor, eindringlich und anekdotenreich schildert er die Lebensphasen des 1910 geborenen Ai Qing und ordnet sie in die chinesischen Zeitläufte ein, die sich für die (überlebenden) Intellektuellen mit Abschnitten von vager Hoffnung und Entspannung verbanden, vor allem aber mit furchtbaren Strafaktionen - der "Besserung durch Arbeit" - unter Mao. Imposant tritt der Widerstandsgeist Ai Qings hervor, den dieser noch in der Wildnis im Norden Xinjiangs, als Latrinenputzer an der Jauchegrube bei Minus dreißig Grad, nicht verliert. Erst als er selbst "zum Angriffsziel der Feindseligkeit des Regimes" wird, so Ai Weiwei, sei ihm das Schicksal seines Vaters "allmählich klar geworden".
In einem schmalen Kapitel handelt Ai Weiwei seinen zwölfjährigen Aufenthalt in New York ab, wo er in einem ziellosen künstlerischen Dasein Duchamp für sich entdeckt und interessanten Persönlichkeiten nahekommt wie dem taiwanischen Aktionskünstler Tehching Hsieh oder dem Dichter Allen Ginsberg, der das Werk Ai Qings aus eigener Lektüre kennt. Nach dem Mord auf offener Straße an seinem Künstlerkollegen Lin Lin wird Ai Weiwei die "Absurdität dieser Gesellschaft" indessen zu viel, und er kehrt 1993 zurück nach Peking, um noch Zeit mit seinem Vater zu verbringen (der 1996 stirbt). Erst dort findet er zu seinem Werk, das durch die politische Opposition begründet wird, wie Ai Weiwei wiederholt betont.
Die Beschäftigung mit traditioneller chinesischer Kunst und seine bekannten ikonoklastischen "kleinen Schandtaten", verübt an Ritualgefäßen aus der Han-Zeit, bezeichnet Ai als persönlichen Neuanfang. Er fühlt sich jetzt bereit, seinen "Platz als Künstler und Kritiker einzunehmen" und in seiner "eigenen Sprache eine neue Wirklichkeit zu konstruieren". Detailliert berichtet er, wie er zur Documenta 12 von 2007 jene 1001 Landsleute auswählt, die er in einer denkwürdigen Performance auftreten lässt; wie er 2008 nach dem Erdbeben von Sichuan zusammen mit etlichen Helfern den grassierenden Pfusch am Bau aufdeckt und die Namen der Opfer unter den Kindern veröffentlicht; wie er 2010 mit 1600 Arbeitskräften die gigantische Installation "Sunflower Seeds" in der Londoner Tate Modern zustande bringt.
Längst ist er damals "Teil des Globalisierungsspektakels", wie Ai Weiwei einigermaßen gallig bemerkt, als er wiedergibt, wie er 2006 in Peking von einer Delegation des Museum of Modern Art besucht wird. Dabei sehe man im MoMA "nichts als Vorurteile, Snobismus und Eitelkeit", und wer dort nicht von Scham überwältigt werde, sei von allen "künstlerischen Instinkten verlassen oder ein Halunke".
Am stärksten wirkt Ai Weiwei damals durch seinen - 2009 von der Regierung geschlossenen - Blog, der ihn nach eigenen Worten vom Künstler zum Aktivisten werden lässt und seiner Kritik an Staat und Gesellschaft eine enorme Reichweite beschert. In diesem Forum formiert sich eine Res publica, die sich nur hier so versammeln kann. Kein Wunder, dass Ai Weiwei den Blog als Erzeugung von Realität versteht und keineswegs nur als deren Abbildung. So geben ihm denn auch manche User schon früh zu verstehen, er solle es mit der Offenheit nicht übertreiben. "Wir brauchen Sie, Ihren Blog zu besuchen ist ein Teil unseres Lebens geworden." Eine Bitte, die sich Ai Weiwei nicht zu Herzen nimmt und dafür bezahlen muss.
Bedauern darf man den Umstand, dass er seiner Auswanderung nach Berlin kein eigenes Kapitel widmet, hat er sich doch in Deutschland offenbar nicht sonderlich gut aufgehoben gefühlt und das Land zunächst nach Großbritannien, dann gen Portugal verlassen. Kurz geht Ai Weiwei noch auf eine Reise nach Lesbos ein, wo er 2015 ein Schlauchboot mit erschöpften Insassen sieht, ein Eindruck "mit der Kraft einer heiligen Offenbarung", die er in mehreren, auch filmischen Werken verarbeitet. Dass er den Tod des Flüchtlingskindes Aylan für eine Fotografie nachstellt, die von der Kunstkritik ungnädig aufgenommen wird, lässt Ai Weiwei unerwähnt.
Der Künstler schließt mit einer bitteren Erkenntnis über sein Heimatland. China sei einem "moralischem Verfall" preisgegeben. Ai Weiweis OEuvre fehlt in der Emigration hingegen die Konfrontation mit einer Obrigkeit, die eine öffentliche Kritik nicht direkt auch als Ausweis freier Meinungsäußerung für sich verbuchen kann. Wie man sein jüngeres Werk auch beurteilen mag: Dieser Künstler hat vorgelebt, was Zivilcourage bedeutet. GEORG IMDAHL
Ai Weiwei: "1000 Jahre Freud und Leid". Erinnerungen.
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz und Elke Link. Penguin Verlag, München 2021. 416 S., Abb., geb. 38,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Georg Imdahl begegnet in Ai Weiweis Erinnerungen einem Künstler mit Zivilcourage, genauer zwei Künstlern. Dass Ai zunächst die Biografie seines Vaters, des Dichters Ai Qing, nacherzählt, die Drangsalierungen und die Verbannung durch den chinesischen Staat, denen er ausgesetzt war, und die ihn letztlich zerbrachen, macht für Imdahl Sinn. Von hier aus gelangt der Autor anekdotenreich und in bildreicher Sprache, so Imdahl, zu seiner eigenen Sozialisation als widerständiger Künstler. Gallige Passagen über die Vereinnahmung durch die westliche Kunstwelt wechseln laut Imdahl ab mit bitteren Erkenntnissen über die Heimat des Künstlers. Dass Ai seine Zeit in Berlin nicht erwähnt, findet der Rezensent bedauerlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Man merkt in diesen Memoiren, wie ernst es Ai Weiwei ist. Was für ein tief moralischer Künstler er ist. Es ist absolut erschütternd, aufregend und faszinierend, das zu lesen.« Daniel Kehlmann, radioeins »Die Literaturagenten«