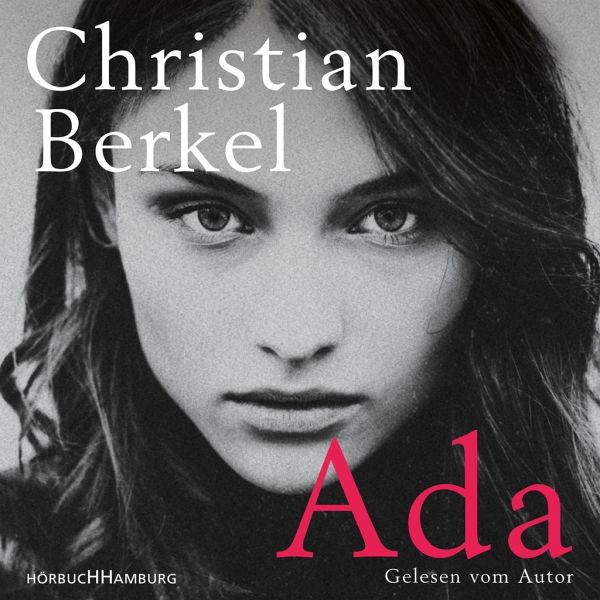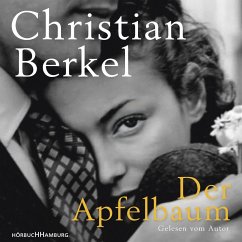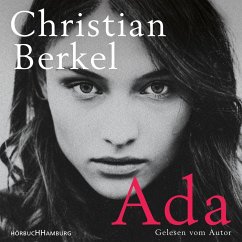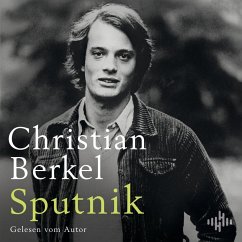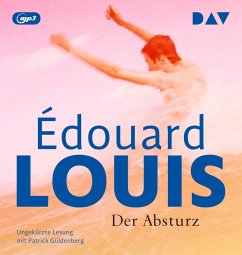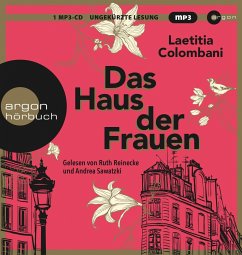Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Statt: 16,00 €**
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!





Wirtschaftswunder, Mauerbau, die 68er-Bewegung - und eine vielschichtige junge Frau, die aus dem Schweigen der Elterngeneration heraustritt.In der noch jungen Bundesrepublik ist die dunkle Vergangenheit für Ada ein Buch, aus dem die Erwachsenen das entscheidende Kapitel herausgerissen haben. Mitten im Wirtschaftswunder sucht sie nach den Teilen, die sich zu einer Identität zusammensetzen lassen und stößt auf eine Leere aus Schweigen und Vergessen. Ada will kein Wunder, sie wünscht sich eine Familie, sie will endlich ihren Vater - aber dann kommt alles anders.Vor dem Hintergrund umwälzend...
Wirtschaftswunder, Mauerbau, die 68er-Bewegung - und eine vielschichtige junge Frau, die aus dem Schweigen der Elterngeneration heraustritt.
In der noch jungen Bundesrepublik ist die dunkle Vergangenheit für Ada ein Buch, aus dem die Erwachsenen das entscheidende Kapitel herausgerissen haben. Mitten im Wirtschaftswunder sucht sie nach den Teilen, die sich zu einer Identität zusammensetzen lassen und stößt auf eine Leere aus Schweigen und Vergessen. Ada will kein Wunder, sie wünscht sich eine Familie, sie will endlich ihren Vater - aber dann kommt alles anders.
Vor dem Hintergrund umwälzender historischer Ereignisse erzählt Christian Berkel von der Schuld und der Liebe, von der Sprachlosigkeit und der Sehnsucht, vom Suchen und Ankommen - und beweist sich einmal mehr als mitreißender Erzähler.
In der noch jungen Bundesrepublik ist die dunkle Vergangenheit für Ada ein Buch, aus dem die Erwachsenen das entscheidende Kapitel herausgerissen haben. Mitten im Wirtschaftswunder sucht sie nach den Teilen, die sich zu einer Identität zusammensetzen lassen und stößt auf eine Leere aus Schweigen und Vergessen. Ada will kein Wunder, sie wünscht sich eine Familie, sie will endlich ihren Vater - aber dann kommt alles anders.
Vor dem Hintergrund umwälzender historischer Ereignisse erzählt Christian Berkel von der Schuld und der Liebe, von der Sprachlosigkeit und der Sehnsucht, vom Suchen und Ankommen - und beweist sich einmal mehr als mitreißender Erzähler.
Christian Berkel, 1957 in West-Berlin geboren, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Er war an zahlreichen europäischen Filmproduktionen sowie an Hollywood-Blockbustern beteiligt und wurde u. a. mit dem Bambi, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Für seine Hörbuch-Interpretation von Daniel Glattauers Roman 'Gut gegen Nordwind' wurde ihm zusammen mit Andrea Sawatzki die Goldene Schallplatte verliehen. 2020 erhielt er den Deutschen Hörbuchpreis. Auch als Autor ist Christian Berkel erfolgreich. Seine Romane 'Der Apfelbaum' und 'Ada' wurden Bestseller.
Produktdetails
- Verlag: Hörbuch Hamburg
- Anzahl: 2 MP3-CDs
- Gesamtlaufzeit: 675 Min.
- Erscheinungstermin: 27. September 2021
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783869092928
- Artikelnr.: 61666028
Herstellerkennzeichnung
Hörbuch Hamburg
Völckerstraße 18
22765 Hamburg
info@hoerbuch-hamburg.de
»Christian Berkel hat ein kunstvolles Buch über die Ambivalenz geschrieben. Eines über das große, gleichermaßen beruhigende wie erschütternde Sowohl-als-auch des Lebens.« Gerhard Matzig Süddeutsche Zeitung 20201119
"Allzu tiefes Schweigen macht mich so bedenklich wie zu lauter Schrei ." (Sophokles)
Die 1945 in Leipzig geborene Ada wächst ihre ersten 9 Lebensjahre allein mit ihrer jüdischen Mutter Sala in Argentinien auf, bevor beide in die alte Heimat zurückkehren und sich in Berlin …
Mehr
"Allzu tiefes Schweigen macht mich so bedenklich wie zu lauter Schrei ." (Sophokles)
Die 1945 in Leipzig geborene Ada wächst ihre ersten 9 Lebensjahre allein mit ihrer jüdischen Mutter Sala in Argentinien auf, bevor beide in die alte Heimat zurückkehren und sich in Berlin niederlassen. Für Ada bedeutet das erst einmal Lernen, denn sie beherrscht weder die Sprache noch kennt sie die Kultur und Verhaltensregeln ihrer Mitmenschen. Auch ihrem Vater Otto begegnet sie zum ersten Mal und erlebt ein Familienleben, das versucht, Normalität zu vermitteln, während es unter der Oberfläche schwelt. Ada erlebt nicht nur das deutsche Wirtschaftswunder mit, sondern erlebt auch den Mauerbau hautnah mit. Doch irgendwie bleibt ihr alles fremd, denn Ada fühlt sich in ihrer eigentlichen deutschen Heimat nicht verwurzelt und Fragen zur Vergangenheit werden ignoriert oder nicht beantwortet. Mit Mitte 40 entscheidet sich Ada am Tag des Mauerfalls, einen Psychotherapeuten in Anspruch zu nehmen, um ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten und vielleicht endlich einiges verstehen zu lernen….
Christian Berkel, der mit „Der Apfelbaum“ ein fulminantes Debüt hingelegt hat, lässt mit „Ada“ nun seinen neuesten Roman folgen, das wie eine Vertiefung seines Erstlingswerkes wirkt. Berkels flüssiger, gefühlvoller und mitreißender Schreibstil schafft mit der gewählten Ich-Erzählform eine enge Anbindung des Lesers, denn er erfährt Adas Geschichte praktisch aus erster Hand, indem er ihren Worten „lauscht“ und ihr Werdegang sowie ihre Gedanken- und Gefühlswelt direkt von ihr persönlich herangetragen werden. Dabei überzeugt der Autor mit einer Sensibilität und Empathie, wie man sie selten bei männlichen Schriftstellern erlebt, um ihren weiblichen Protagonisten Lebendigkeit zu verleihen. Neben Adas persönlicher Geschichte, die von Selbstzweifeln und Entwurzelung zeugen, bekommt der Leser begleitend auch viele Informationen über das Leben in der Nachkriegszeit. So geht es über das Wirtschaftswunder, den Mauerbau, die 60er Jahre bis hin zum Mauerfall. Berkel zeichnet ein buntes und realistisches Gesellschaftsbild der damaligen Zeit. Vorrangig aber geht es um Adas Erkenntnis, dass sie jüdischer Abstammung ist, dies erst sehr spät erfährt und nun die Aufarbeitung beginnt, der sich die meisten Deutschen leider versagt haben, um nur nicht an den Massenmord im Zweiten Weltkrieg erinnert zu werden. Man mag sich gar nicht vorstellen, was in einem Menschen vorgeht, der erst im Nachhinein erfährt, was damals passiert ist und der doch eigentlich durch den Zeitpunkt seiner Geburt und die Familienumstände direkt davon betroffen war. Die Sprachlosigkeit innerhalb ihrer Eltern muss für sie eine Art Damoklesschwert gewesen sein, das sie einerseits durchbrechen wollte, aber sich andererseits auch davor fürchtete.
Lebendige und realistisch gezeichnete Charaktere wachsen dem Leser mit ihren persönlichen Ecken und Kanten schnell ans Herz, die Nähe zu ihnen ermöglicht ihm einen Einblick in ihr Seelenleben und lässt ein Mitbangen und Hinterfragen zu. Ada ist eine Frau, die zwischen zwei Welten hin- und hergezogen wird, weshalb es ihr auch nicht gelingt, sich standfest und sicher zu fühlen. Voller Zweifel und dem Schweigen ausgeliefert, gehört sie zu einer Generation, die Gründe sucht und Antworten haben will. Dabei stürzt sie sich wie viele andere auch eine Art Rebellion, probiert Drogen und Liebe aus, besucht Woodstock und vieles mehr. Mutter Sala ist zwar eine liebenswerte und fürsorgliche Frau, hüllt sich Adas Fragen gegenüber aber immer in Schweigen und lässt ihre Tochter auf ihre Art damit im Stich. Vater Otto ist ein strenger Mann, der wenig Wärme ausstrahlt. Aber auch Mopp und Hannes spielen eine Rolle in dieser Handlung.
„Ada“ ist eine gefühlvolle und aufwühlende Lebensgeschichte, die nachdenklich stimmt und selbst so einige Fragen beim Leser aufkommen lässt. Absolut empfehlenswert für alle, die sich nicht nur für deutsche Geschichte, sondern auch für die Schicksale dahinter interess
Weniger
Antworten 6 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 6 von 7 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Ada erzählt ihrem Psychiater ihre Lebensgeschichte. Da ist sie Mitte Vierzig und erinnert sich an erstaunlich vieles aus ihrer Kindheit und Jugend und versucht dabei Antworten zu finden. Was hat sie zu der werden lassen, die sie geworden ist? War es nur die Reaktion auf ihre Mutter und deren …
Mehr
Ada erzählt ihrem Psychiater ihre Lebensgeschichte. Da ist sie Mitte Vierzig und erinnert sich an erstaunlich vieles aus ihrer Kindheit und Jugend und versucht dabei Antworten zu finden. Was hat sie zu der werden lassen, die sie geworden ist? War es nur die Reaktion auf ihre Mutter und deren Art, durch Verschweigen allen unliebsamen Fragen aus dem Weg zu gehen, auf die Ablehnung, die Ada zu spüren glaubte?
Ada ist in Argentinien und Westberlin aufgewachsen in Zeiten, in denen ich selbst wohlbehütet in einer intakten Familie auf dem Land nahe Leipzig groß wurde und von den Studentenunruhen, Drogen und Wohngemeinschaften nur aus den damals zugänglichen Medien wusste. Um so spannender, diese Zeiten mal aus völlig anderer Perspektive kennenzulernen. Auch die Kapitel, die in Paris 1968 handeln und natürlich Woodstock waren sehr eindrucksvoll. Die Unmittelbarkeit von Adas Erzählung wirkt sehr authentisch und hat mich sehr gefesselt.
Den Punktabzug musste ich machen, weil ich das Buch in sich nicht ganz stimmig fand, es gab große zeitliche Lücken, für die mir das Verständnis fehlt. Urplötzlich waren wir in den Neunziger Jahren, das Ende kam abrupt und ich verstand nicht, wieso. Vielleicht muss man doch den "Apfelbaum" vorher gelesen haben? - Ich werde mir dieses erste Buch von Christian Berkel als nächstes vornehmen, denn seine Erzählweise finde ich gut. VIelleicht füllt das ja die offenen Lücken.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
beeindruckendes Schweigen in der Nachkriegszeit
Berkels Apfelbaum hat mich dazu inspiriert, Bücher über den Mont Verita zu lesen. Sein zweites Werk handelt in der Nachkriegszeit und wird von der fiktiven Tochter Ada von Berkels Mutter erzählt. Ada, die den ersten Teil ihrer …
Mehr
beeindruckendes Schweigen in der Nachkriegszeit
Berkels Apfelbaum hat mich dazu inspiriert, Bücher über den Mont Verita zu lesen. Sein zweites Werk handelt in der Nachkriegszeit und wird von der fiktiven Tochter Ada von Berkels Mutter erzählt. Ada, die den ersten Teil ihrer Kindheit in Argentinien verbracht hat, freundet sich in Berlin mit Uschka an, deren Vater zur Widerstandsbewegung gegen Hitler gehörte. Obwohl er von den Nazis umgebracht wurde, sehen ihn Teile der Bevölkerung als Vaterlandsverräter an.
Die eine Stärke des Buches ist das Schweigen über den Krieg. Weder Adas Vater erzählt, was er in Russland erlebt hat noch ihre Mutter erzählt, wie sie als Jüdin – im Nazijargon Halbjüdin – die Verfolgung überlebt hat. Die andere Stärke ist der Witz des Buches der besonders im Leben Adas mit ihrem jüngeren Bruder „Sputnik“ zum Ausdruck kommt. Die Szenen mit den „Katzenzungen“ und im Badezimmer sind so gut, dass ich sie nicht verraten will.
Allerdings habe ich weder den Sinn der Rahmenerzählung zur deutschen Einheit noch das Woodstock-Kapitel verstanden. Und im Kapitel über das Judentum bei ihrer Paris-Reise wurde mir der Erklärbär zu groß. Deswegen 4 Sterne.
Lieblingszitat: Noch so’n Ding, Augenring (63)
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Nach Christian Berkels Familiengeschichte "Der Apfelbaum" folgt nun der Roman "Ada", der wieder den familiären Rahmen Berkels aufgreift und im Ullstein Verlag erscheint.
Im Februar 1945 wird Ada in Deutschland geboren, ihre ersten neun Lebensjahre verbringt sie vaterlos …
Mehr
Nach Christian Berkels Familiengeschichte "Der Apfelbaum" folgt nun der Roman "Ada", der wieder den familiären Rahmen Berkels aufgreift und im Ullstein Verlag erscheint.
Im Februar 1945 wird Ada in Deutschland geboren, ihre ersten neun Lebensjahre verbringt sie vaterlos mit ihrer Mutter in Argentinien. Zurück in Berlin muss sie erst einmal die Sprache und Mentalität ihrer deutschen Landsleute lernen, über die politische Vergangenheit wird geschwiegen. Sie erlebt den Berliner Mauerbau, das Wirtschaftswunder und die 68er-Bewegung mit. Sie sucht nach ihren Wurzeln und erhält auf ihre Fragen hin nur Schweigen.
Die Vorkenntnis von "Der Apfelbaum" ist nicht erforderlich, es hilft jedoch dabei, die Hintergründe von Sala und Otto besser zu verstehen. In diesem Buch geht es um Ada, ihr Leben gleicht einer Achterbahn von Hochs und Tiefs, ihre Gedanken und Ängste, Wünsche und Erlebnisse schildert sie in Gesprächen während einer Psychotherapie, die sie zu Beginn der 90er Jahre zur Aufarbeitung ihres Selbst macht. Dort erfährt man von ihrer Kindheit, in der sie sich eine normale Familie wünschte. Die Abstammung wird verschwiegen, Antworten über die Vergangenheit ihrer jüdischen Mutter bekommt sie nicht oder über Umwege. Sie grenzt sich von ihrer Familie ab, beginnt ein Studium, probiert die Liebe und die Drogen, erlebt die Studentenbewegung in Berlin mit, reist nach Paris und Woodstock.
In diesem Roman taucht man mit Ada eindrucksvoll in ihre Vergangenheit ein, erlebt ihren Zwiespalt mit ihrer Identität, die Frage nach ihren Wurzeln und ihre weitere Entwicklung in dieser sich politisch verändernden Zeit der 68er Jahre. Sie ist Deutsche und Argentinierin, katholisch und auch jüdisch. Ihre Mutter Sala verschweigt ihre eigene Vergangenheit, all das Leid und die erlebten Schwierigkeiten möchte sie für immer hinter sich lassen. Adas Fragen werden nicht beantwortet, der später geborene Bruder wird das Lieblingskind der Eltern, sie wird in ein Internat geschickt, das macht ihr zu schaffen. Sie löst sich von ihrer Familie und beginnt einen neuen Lebensweg.
Sprachlich ist das Buch wieder ein echter Genuß, Christian Berkels Sprachgewandtheit und sein schnörkelloser Erzählfluss sind mitreißend und die Handlung lässt sich spannend verfolgen. Er füllt Adas Persönlichkeit mit Leben und daraus erklärt sich ihre Depression in den 90er Jahren. Dennoch fehlen mir die Erlebnisse der 80er Jahre, um Adas Lebenswege genau zu kennen. Dafür lassen sich die 68er Jahre umso intensiver miterleben.
Sämtliche Charaktere haben wiedererkennbare Züge, besonders Sala mit ihren Sprüchen und Ausrufen oder Otto mit seiner Heimatverbundenheit. Gefangen in dieser Familienkonstellation erlebt man die Emotionen mit, sieht die Fragen und versteht die Ausgrenzung Adas in der Familie nicht.
Viele Hintergründe haben mich zum Nachdenken gebracht, wie es dieser Generation von jüdischen Nachfahren in Deutschland erging. Das Schweigen über die Vergangenheit lässt keine Identität zu.
Ein bewegend erzählter Lebensweg einer interessanten Protagonistin, die sich ihrer jüdischen Abstammung erst spät bewusst wurde. Was macht das mit einem Menschen?
Weniger
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Das Buch "Der Apfelbaum" habe ich gern gelesen. Deshalb war ich neugierig auf sein zweites Buch. Obwohl Ada eine fiktive Gestalt ist, knüpft er auch in diesen Buch wieder an seine Familiengeschichte an.
Die Rahmenhandlung spielt zwischen 1989 und 1993. Ada ist auf der Suche nach …
Mehr
Das Buch "Der Apfelbaum" habe ich gern gelesen. Deshalb war ich neugierig auf sein zweites Buch. Obwohl Ada eine fiktive Gestalt ist, knüpft er auch in diesen Buch wieder an seine Familiengeschichte an.
Die Rahmenhandlung spielt zwischen 1989 und 1993. Ada ist auf der Suche nach ihrer Identität. Deshalb erzählt sie einen Psychologen ihre Lebensgeschichte. Es beginnt mit ihrer Kindheit in Buenos Aires. Weiter geht es mit ihrer Jugend in Berlin und endet in 1969 in Woodstock.
Die Geschichte wird komplett aus Sicht von Ada in der Ich-Form erzählt. Dadurch erscheint das Buch als nicht endender Monolog. Gern hätte ich auch etwas anderes erfahren als die (innere) Sicht von Ada.
Der Schreibstil des Buches ist angenehm. Christian Berkel versteht sein Handwerk. Nur hat mich das Buch emotional nicht erreicht. Deshalb vergebe ich 3 Sterne.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Mit ihrer Familie hat Ada schon vor Jahren gebrochen, aber um ihren Bruder wieder zu sehen geht sie ins Theater, es ist der 9. November 1989, der Tag des Mauerfalls. Sie verfehlt ihn, lässt sich dann alleine von den Massen durch die Straßen Berlins schieben und hängt ihren Gedanken …
Mehr
Mit ihrer Familie hat Ada schon vor Jahren gebrochen, aber um ihren Bruder wieder zu sehen geht sie ins Theater, es ist der 9. November 1989, der Tag des Mauerfalls. Sie verfehlt ihn, lässt sich dann alleine von den Massen durch die Straßen Berlins schieben und hängt ihren Gedanken nach. Wer ist sie, wo gehört sie hin? Sie ist jetzt 45 Jahre alt, in Argentinien aufgewachsen, lebt aber seit ihrem 9. Lebensjahr wieder in Berlin - aber ist sie hier auch zu Hause? Um ihre Identität zu klären und zu sich selbst zu finden begibt sie sich in die Hände eines Psychologen, dem sie nach und nach ihre Lebensgeschichte erzählt …
Der Autor Christian Berkel ist ein bekannter deutscher Schauspieler. Er wurde 1957 in West-Berlin geboren und ist mit der Schauspielerin Andrea Sawatzki verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne.
In seinem erstem Roman „Der Apfelbaum“ aus dem Jahr 2018 beschreibt Berkel die Geschichte seiner Familie und setzt sich dabei mit Eltern und Großeltern auseinander. Sein zweiter Roman „Ada“ ist als Fortsetzung seiner Familiengeschichte gedacht, wobei es sich bei der Protagonistin Ada um eine fiktive Person handelt, denn Berkel hat keine Schwester. Laut Aussage des Autors ist das Ganze als Trilogie geplant und ein dritter Teil bereits in Bearbeitung.
Es ist Adas Lebensgeschichte die sie nun, 45jährig, bei einem Psychologen aufarbeitet. Sie ist planlos und unzufrieden mit ihrem Leben, zerrissen von Ängsten und Zweifel über ihre Herkunft und ohne Perspektive für die Zukunft. Sie leidet unter dem Schweigen der Eltern, weiß nichts über die NS-Zeit, weiß nicht wie ihre jüdische Mutter den Krieg überstand und wie ihr Vater die Gefangenschaft überlebte. Sie erlebt das Wirtschaftswunder, den Mauerbau und die Studentenrevolten der 68er-Jahre, macht Erfahrungen mit Drogen und fliegt 1969 nach Amerika, um drei Tage in Woodstock dabei zu sein.
Dieses Buch zu beurteilen fällt mir nicht leicht. Dass der Autor schreiben kann hat er hier wieder bewiesen, dennoch konnte mich die Geschichte nicht packen. Wenn in dieser Familie nicht über die Vergangenheit geredet wurde, dürfte es sich wohl eine Ausnahme handeln und man muss es so hinnehmen. (In anderen Familien, so auch in meiner, war die NS-Zeit und ihre Folgen durchaus ein Thema.) Adas Lebensgeschichte, die sie in Ich-Form dem Leser selbst erzählt, fand ich in Ansätzen tatsächlich interessant, störend und verwirrend jedoch waren für mich die rasanten Zeitsprünge und Adas teils bizarren Gedankengänge. Ebenso seltsam fand ich den Schluss, der wohl das Interesse auf eine Fortsetzung wecken soll.
Fazit: Ein Buch das unterhält und durch seine Thematik den Leser zum Nachdenken anregt.
Weniger
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Christian Berkels autofiktionaler Roman zeigt das Leben in Deutschland in den fünfziger und sechziger Jahren.
Dabei sind die Lebensstationen offenbar real an Berkels Familiengeschichte ausgerichtet, so heißt auch Berkels Mutter Sala und hat die gleichen Erfahrungen gemacht. Der …
Mehr
Christian Berkels autofiktionaler Roman zeigt das Leben in Deutschland in den fünfziger und sechziger Jahren.
Dabei sind die Lebensstationen offenbar real an Berkels Familiengeschichte ausgerichtet, so heißt auch Berkels Mutter Sala und hat die gleichen Erfahrungen gemacht. Der später geborene Sohn Sputnik hat schon früh ein Interesse an Schauspielerei und vermutlich ist er somit Berkels Ebenbild.
Aber die Figur Ada ist anscheinend fiktiv und exemplarisch.
Adas Lebens ist beeinflusst von Geschehnissen der Vergangenheit, über die geschwiegen wurde. Ihre jüdischen Wurzeln mütterlicherseits ist sie sich wenig bewusst.
Der Roman ist vielschichtig, reißt einige Themen an und zeigt viel von Deutschland.Es ging mir beim Lesen dann auch so, dass mich manche Passagen sehr interessierten, andere weniger.
Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Zu vermuten und zu wünschen ist
ein Buch, in dem Berkels Leben selbst erzählt wird.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Schauspieler Christian Berkel versucht sich in dem Roman ein zweites Mal als Schriftsteller, nach dem Apfelbaum, beide Geschichten mit einer teils autobiographischen Note verziert. Die Geschichte handelt hier von der 1945 geborenen Ada, deren Mutter, mit jüdische Wurzeln, nach Ende des Krieges …
Mehr
Schauspieler Christian Berkel versucht sich in dem Roman ein zweites Mal als Schriftsteller, nach dem Apfelbaum, beide Geschichten mit einer teils autobiographischen Note verziert. Die Geschichte handelt hier von der 1945 geborenen Ada, deren Mutter, mit jüdische Wurzeln, nach Ende des Krieges für ein Jahrzehnt nach Argentinien zieht aber dann nach Berlin zurückkehrt. Dort findet Ada ihren Vater mit einer neuen Frau verheiratet, jedoch versucht die Familie einen neuen Anfang und kommt wieder zusammen.
Ada versucht einiges über die Vergangenheit ihrer Eltern zu erfahren, doch diese schweigen sich über die Nazizeit aus. Der kommende Aufbau und Fall der DDR, die Ängste und Hoffnungen sowie die Suche nach sich selbst beeinflussen Ada zutiefst und prägen ihre Persönlichkeit.
Berkel hat einen eindringlichen Schreibstil und die Beschreibungen Berlins in den Zweiten des Mauerbaus waren wirklich sehr lebendig und beeindruckend. Auch die Suche Adas nach ihrer Herkunft und die Leere die man fühlt hat man diese Antworten nicht parat, wird glaubwürdig thematisiert.
Geschichtlich lehrreich und unterhaltsam zugleich.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Zum Inhalt: Ada, geboren 1945 erzählt ihrem Psychologen die Geschichte ihres Lebens, immer auf der Suche nach ihrer Identität. Sie kann sich an sehr vieles erinnern, auch sehr viel historisches findet sich in der Erzählung. Wie wurde Ada wer sie ist. Meine Meinung: Bei der Bewertung …
Mehr
Zum Inhalt: Ada, geboren 1945 erzählt ihrem Psychologen die Geschichte ihres Lebens, immer auf der Suche nach ihrer Identität. Sie kann sich an sehr vieles erinnern, auch sehr viel historisches findet sich in der Erzählung. Wie wurde Ada wer sie ist. Meine Meinung: Bei der Bewertung des Buches bin ich schon ein wenig hin und her gerissen. Ich finde den Schreibstil des Buches sehr gelungen. Der Autor kann schon hervorragend mit Worten umgehen. Die Geschichte der Ada fand ich in Teilen auch durchaus sehr interessant, besonders bekannte historische Fakten. Womit ich mich extrem schwer getan habe, waren z. B. die Zeitsprünge. Auch fehlten teilweise ganze Zeiten, was natürlich ein Stilmittel sein kann, aber schon verwirrt. Ich habe das Buch schon interessiert gelesen, hab mich aber am Ende gefragt, was mir das Buch jetzt sagen soll. Aber gut, unterhalten habe ich mich dennoch. Fazit: Wie sie wurden was sie sind
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
An „Der Apfelbaum“ bin ich mit einiger Skepsis herangegangen, denn ich dachte „schon wieder ein Prominenter, der sich als Schriftsteller versuchen will“. Doch Christian Berkel hat mich als Autor überzeugt und daher kam ich auch an „Ada“ nicht vorbei.
In …
Mehr
An „Der Apfelbaum“ bin ich mit einiger Skepsis herangegangen, denn ich dachte „schon wieder ein Prominenter, der sich als Schriftsteller versuchen will“. Doch Christian Berkel hat mich als Autor überzeugt und daher kam ich auch an „Ada“ nicht vorbei.
In diesem Buch geht es um Ada, eine Frau in den Vierzigern, die auf der Suche nach sich selbst ist. Ada wird 1945 als Tochter einer Jüdin in Leipzig geboren. Sie verbringt daher ihre ersten Jahre in Argentinien und kehrt mit ihrer Mutter als neunjähriges Mädchen nach Deutschland zurück. Sie kommt in ein ihr fremdes Land und muss erst einmal die Sprache lernen. Dann tritt Otto in ihr Leben, der als ihr Vater gilt. Sie leben in Berlin als Familie zusammen und dann bekommt sie noch einen Bruder. Aber ist Otto wirklich ihr Vater? Ihre Fragen bleiben unbeantwortet. Niemand will die vielen Fragen, die sie hat, beantworten, denn niemand will an die Vergangenheit erinnert werden. Erst mit Mitte 40 versucht Ada mit Hilfe eines Psychotherapeuten ihre wahre Identität zu finden und in ihrem Leben anzukommen.
Christian Berkel erzählt diese Geschichte aus der Perspektive von Ada, so dass ich als Leser mich gut in ihre Gefühlswelt hineinversetzen kann. Der Schreibstil ist schön flüssig zu lesen und wirklich packend. Die Atmosphäre der Nachkriegszeit kommt realistisch rüber. Man will nicht an die Vergangenheit denken, sondern setzt seine ganze Hoffnung auf die Zukunft, die verheißungsvoll aussieht.
Ada ist eine sympathische junge Frau, auch wenn sie als Jugendliche sehr rebellisch ist. Doch wer kann es ihr verdenken, denn sie fühlt sich nirgendwo geborgen und zuhause. Sie hat viele Fragen, bekommt aber keine Antworten, was dazu führt, dass sie irgendwie entwurzelt ist. Es braucht seine Zeit und einige Umwege, bis sie sich auf die Suche nach sich selbst macht und dabei die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch nimmt.
Das Ende ist ziemlich offen, so dass jeder sich seine Version vom Fortgang der Geschichte machen kann. Das passt, stellt mich aber nicht so ganz zufrieden.
Eine interessante, aber auch bedrückende Geschichte.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für