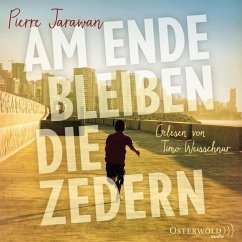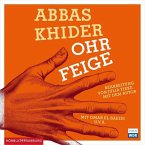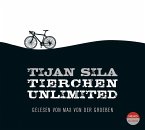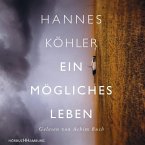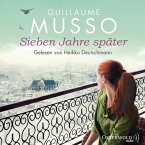Samirs Eltern sind kurz vor seiner Geburt aus dem Libanon nach Deutschland geflohen. Als sein geliebter Vater spurlos verschwindet, ist Samir acht. Zwanzig Jahre später macht er sich auf in das Land der Zedern, um das Rätsel dieses Verschwindens zu lösen. Seine Suche führt ihn durch ein noch immer gespaltenes Land, und schon bald scheint Samir nicht mehr nur den Spuren des Vaters zu folgen. Vielmehr ist es, als seien die Figuren aus dessen Geschichten real geworden. Vor dem Hintergrund des dramatischen Schicksals des Nahen Ostens erzählt Pierre Jarawan eine phantasievolle, berührende und wendungsreiche Geschichte über die Suche nach den eigenen Wurzeln.

Als Samir sechs Jahre alt ist, verschwindet sein Vater. Geht aus dem Haus und kommt nicht wieder. Aber dass er sich beim Zigarettenholen plötzlich überlegt haben könnte, ein anderes Leben führen zu wollen, kann nicht glauben, wer seine Geschichte kennt. Samirs Vater stammt aus dem Libanon, den er im Bürgerkriegsjahr 1982 heimlich verließ, indem er sich in den Kofferraum eines Autos sperren und in das damals noch friedliche Syrien fahren ließ. In Deutschland hat er Asyl bekommen, Arbeit gefunden, ein Haus bezogen, aber angekommen ist er nicht. So wächst Samir mit dem Verdacht auf, dass sein Vater einfach zurückgekehrt sein könnte in die Heimat.
Dass dies an dem Jungen nicht spurlos vorbeigeht, liegt auf der Hand, führt in dem Debütroman von Pierre Jarawan, 1985 als Sohn eines libanesischen Vaters und einer deutschen Mutter in Jordanien geboren, aber vor allem dazu, dass Samir gut zwanzig Jahre lang die Einsamkeit sucht, um von seinem Vater zu träumen - bevor er sich endlich auf den Weg macht, um die Spur im Libanon aufzunehmen. Vorher hat er sich, klischeekonform verhaltend, aus alten Zeitungsartikeln, Fotos, Nägeln und Fäden die damalige Lage im Libanon an den Wänden seiner Wohnung deutlich zu machen versucht: Der Mord an Hariri, die Zedernrevolution, der Einmarsch der Israelis, der Hass auf die syrische Schutzmacht, die verfeindeten Religionsgruppen - alles kommt vor, als Episoden, die mit routiniert wirkender Hand in ein Geschehen eingeflochten sind, das allerdings nicht an Fahrt aufnimmt, sondern immer schwerfälliger wird.
Der Ich-Erzähler Samir ist ein Jugendlicher, der sich den Libanon aus der Ferne erst erarbeiten muss. Und so ähnlich, mit einem Hang zur Gemächlichkeit, erzählt auch Jarawan von dieser Annäherung. Er formuliert Probleme aus, die er, weil sie so erwartbar sind, nur hätte andeuten müssen: die Obsession, zu der die Suche nach dem Vater gerät, die nie sich eingestandene Liebe zu dem einzigen Mädchen, das Samir je nah war, weil sie ihn auch vor dem Verschwinden des Vaters schon kannte, und schließlich die Erschütterungen, welche die Reise in den Libanon dann tatsächlich bei Samir auslösen. So leidet die Geschichte unter Redundanz, und die Figuren leiden unter einer Harmlosigkeit, die sie auch in Extremsituationen nicht ablegen können. Da hilft selbst der sichere, Poetry-Slam-geschulte Umgang mit der Sprache dem Autor Jarawan nicht mehr viel.
lbo.
Pierre Jarawan: "Am Ende bleiben die Zedern". Roman. Berlin Verlag, Berlin 2016. 448 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Lange kein derart ausgefeilt formuliertes, in der Wortwahl so treffsicheres Buch in der Hand gehalten. Keines von derart zartem Umgang mit der Sprache.« Gießener Allgemeine 20180414