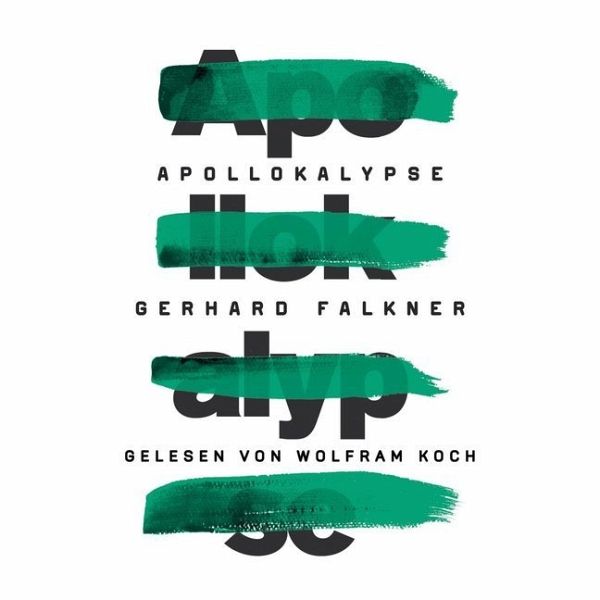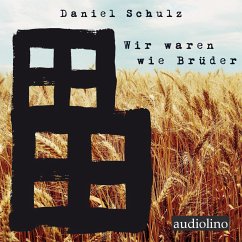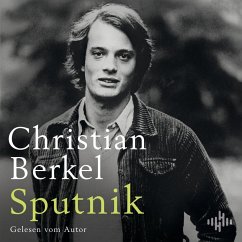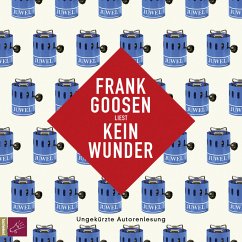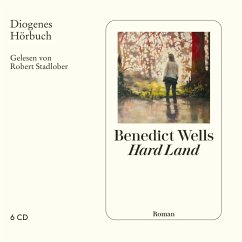Gerhard Falkner
Audio-CD
Apollokalypse
579 Min.. CD Standard Audio Format.Lesung.Gekürzte Ausgabe
Gesprochen: Koch, Wolfram
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Statt: 22,00 €**
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!





Georg Autenrieth ist eine zwielichtige Gestalt in zwiegesichtigen Zeiten, durchsucht die Stadt und zelebriert Laster, Lebensgier und Liebeskunst. Immer wieder taucht er auf in Berlin, der Mann aus Westdeutschland, hält Kontakt mit der Szene. Wohin aber verschwindet er dann? Wer ist der »Glasmann«? Und welche Rolle spielen seine Verbindungen zur RAF? Die Hauptrolle im Roman jedoch spielt die Stadt Berlin, haufenweise gehen Künstlerexistenzen an ihrer magischen Gestalt in die Brüche. Und wenn die RAF sich über den BND mit der Stasi berührt, gerät die Zeitgeschichte unter das Messer der P...
Georg Autenrieth ist eine zwielichtige Gestalt in zwiegesichtigen Zeiten, durchsucht die Stadt und zelebriert Laster, Lebensgier und Liebeskunst. Immer wieder taucht er auf in Berlin, der Mann aus Westdeutschland, hält Kontakt mit der Szene. Wohin aber verschwindet er dann? Wer ist der »Glasmann«? Und welche Rolle spielen seine Verbindungen zur RAF? Die Hauptrolle im Roman jedoch spielt die Stadt Berlin, haufenweise gehen Künstlerexistenzen an ihrer magischen Gestalt in die Brüche. Und wenn die RAF sich über den BND mit der Stasi berührt, gerät die Zeitgeschichte unter das Messer der Psychiatrie. Am Schluss nimmt der Teufel leibhaftig das Heft in die Hand.
Kühn, groß und verstörend: ein sprachmächtiger Roman über die wilden 1980er- und 90er-Jahre in Berlin, gelesen von Wolfram Koch.
Kühn, groß und verstörend: ein sprachmächtiger Roman über die wilden 1980er- und 90er-Jahre in Berlin, gelesen von Wolfram Koch.
Gerhard Falkner, geboren 1951, zählt zu den bedeutendsten Dichtern der Gegenwart. Er veröffentlichte zahlreiche Gedichtbände, u. a. »Hölderlin Reparatur«, für den er 2009 den Peter-Huchel-Preis erhielt, und zuletzt den Gedichtband »Ignatien« (2014), mit Bildern von Yves Netzhammer. Für seine Novelle »Bruno« bekam er 2008 den Kranichsteiner Literaturpreis. Er gehört zu den meistausgezeichneten deutschsprachigen Autoren mit Aufenthalten in der Villa Massimo (Casa Baldi) und der Akademie Schloss Solitude. Er war 2013 der erste Fellow für Literatur in der neugegründeten Kulturakademie Tarabya in Istanbul und zuletzt, 2014, Stipendiat in der Villa Aurora in Los Angeles, Kalifornien. Er lebt in Berlin und Bayern.
Wolfram Koch, geboren 1962, ist u. a. am Deutschen Theater Berlin auf der Bühne zu sehen. Für seine Darstellung in Samuel Becketts »Warten auf Godot« erhielt er zusammen mit Samuel Finzi den Gertrud-Eysoldt-Ring 2014. Sein Kinodebüt gab er bereits als Dreizehnjähriger in der Romanverfilmung »Ansichten eines Clowns«. Im Fernsehen ermittelt er im Frankfurter »Tatort«. Mit seiner sonoren Stimme überzeugt Koch ebenfalls als Hörbuchsprecher. Seine interpretatorische Bandbreite reicht von Krimis von Arne Dahl bis hin zu Romanen von Stefan Zweig.
Wolfram Koch, geboren 1962, ist u. a. am Deutschen Theater Berlin auf der Bühne zu sehen. Für seine Darstellung in Samuel Becketts »Warten auf Godot« erhielt er zusammen mit Samuel Finzi den Gertrud-Eysoldt-Ring 2014. Sein Kinodebüt gab er bereits als Dreizehnjähriger in der Romanverfilmung »Ansichten eines Clowns«. Im Fernsehen ermittelt er im Frankfurter »Tatort«. Mit seiner sonoren Stimme überzeugt Koch ebenfalls als Hörbuchsprecher. Seine interpretatorische Bandbreite reicht von Krimis von Arne Dahl bis hin zu Romanen von Stefan Zweig.
Produktdetails
- Verlag: Osterwoldaudio
- Gesamtlaufzeit: 579 Min.
- Erscheinungstermin: 11. Oktober 2016
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783869523255
- Artikelnr.: 44905127
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.09.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.09.2016Reise ins Zentrum der Nacht
Sexbesessene Raserei: Gerhard Falkners Roman "Apollokalypse" lässt das aus der Zeit gefallene Berlin der Wendezeit opulent wiederauferstehen.
Die einstige Welthauptstadt der Negation hat es schwer getroffen. Aus dem Dark Room der Ideologie wurde ein pummelgesunder Touristenspielplatz mit einer Literatur, die man niemandem wünscht. Während in New York ein Virtuose wie Jonathan Lethem den Mythos der Stadt am offenen Herzen operierte, wurde das neue Berlin von sogenannten Popliteraten breitgelatscht. Der Rückstand aber scheint allmählich aufgeholt zu werden. So legt Gerhard Falkner, mit Herz und Rhythmus Lyriker, also ein Sezierer, jetzt einen Roman über die "lost years" der
Sexbesessene Raserei: Gerhard Falkners Roman "Apollokalypse" lässt das aus der Zeit gefallene Berlin der Wendezeit opulent wiederauferstehen.
Die einstige Welthauptstadt der Negation hat es schwer getroffen. Aus dem Dark Room der Ideologie wurde ein pummelgesunder Touristenspielplatz mit einer Literatur, die man niemandem wünscht. Während in New York ein Virtuose wie Jonathan Lethem den Mythos der Stadt am offenen Herzen operierte, wurde das neue Berlin von sogenannten Popliteraten breitgelatscht. Der Rückstand aber scheint allmählich aufgeholt zu werden. So legt Gerhard Falkner, mit Herz und Rhythmus Lyriker, also ein Sezierer, jetzt einen Roman über die "lost years" der
Mehr anzeigen
deutsch-deutschen Hauptstadt vor - die achtziger und neunziger Jahre -, für den man ihn mit Recht als neuen Mythopoeten Berlins ansehen darf.
Es reißt einen in die eigenen Erinnerungen zurück, dieses sprudelnde, überbordende Buch, in dem ein Doppelgänger des Autors seinen irgendwie allegorischen Helden durch die Niederungen der Identitätssuche führt und dabei das doppelgesichtige Berlin retrospektiv so genau vermisst, dass der verblasste (und ein wenig auch klebrige) Mythos der Zerrissenheit für einen Moment wieder seinen alten Glanz erhält. Hier ersteht der Osten noch einmal in seiner ganzen Pracht, "geronnen wie altes Blut", "ein deutsches Pompeji": "Die meisten Leute, denen ich begegnete, sahen aus, als ob sie steckbrieflich gesucht würden . . . Abgeblättertes, aufplatzendes, ungeschöntes, ruchloses Wohnmaterial erhob sich längs der Straßen, ohne Farbe . . . Sogar der Himmel sah aus, als hätte man ihn im Neuen Deutschland gedruckt."
Gespiegelt wird diese herrliche Kaputtheit vom bordellhaften Westen mit seinen Billigläden, "die sich mit ihrem Gekröse auf die Gehsteige ergossen. Wie Soldaten nach dem Bauchschuss." Dazu die Clubs, das Konspirative, der geistige Hedonismus und der Sex. Auf vier Worte gebracht: "Berlin bot außerplanmäßiges Existieren."
Der beherzte Kopfsprung in die Frontstadt des Wahnsinns beginnt trotz des nicht ganz greifbaren Ich-Erzählers, der in kreisenden Erinnerungen zurückblickt, vergleichsweise übersichtlich. In den frühen achtziger Jahren zog es Georg Autenrieth nach Berlin, wo er gemeinsam mit dem psychisch labilen Künstler Heinrich Büttner und dem geldbefleckten Müßiggänger Dirk Pruy seine Jugend vergeudete und zum Intellektuellen heranreifte: ein Dandyleben, ausgezeichnet durch eine "hochmütige Melancholie, die mit einer stetigen Angst vor dem Versagen und vor dem Erhaschen eines Blicks auf die Überflüssigkeit und die Unvertretbarkeit der eigenen Existenz einherging". Zwar pflegte Autenrieth Beziehungen zum linksradikalen Milieu, aber im Kern war er ein Zyniker, der allenfalls die akademische Daseinsweise gelten ließ und auch einmal verblasen den "Blitzsieg des Geistes gegen die Kräfte des Nachtkollers" herbeisehnte.
Trotzdem ergaben sich die Freunde mit Haut und Haaren dem Rausch. Wofür hat man denn sonst einen Körper? Außerdem kannten sie ihren Nietzsche gut genug, um zu wissen, dass aus dem Zusammenprall des Dionysischen mit dem Apollinischen die (Lebens-)Kunst hervorgeht.
Der Phallozentrismus habe Berlin zu dieser Zeit fest im Griff gehabt, weiß der Erzähler. Seinem Helden lässt er es in dieser Hinsicht an nichts mangeln. Den zahlreichen Nahaufnahmen aus dem Intimleben gelingt dabei das Kunststück, authentisch, aber nicht anstößig zu wirken. Dass Autenrieth, sexbesessen bis zur Raserei, dem manisch-depressiven Büttner die junge Geliebte Isabel ausspannte, wurde erst in dem Moment zum Problem, als Büttner sich vor einen Zug warf. Die Folge war der komplette Rückzug Autenrieths aus der Öffentlichkeit. Als transparenter "Glasmann" wollte er Buße tun, abwesend unter Anwesenden sein, was sich am Steglitzer Kreisel, einem Ort ohne jede Anschaulichkeit, perfekt verwirklichen ließ.
Dann schließt sich nach dem Modell des doppelten Cursus ein zweiter Umlauf des Helden an, der eine noch ausschweifendere Kopie des ersten zu sein scheint. Wieder gibt es eine tabulose Geliebte, Bilijana mit Namen. Die Bulgarin ist verheiratet mit einem wichtigen Bundesnachrichtendienst-Funktionär und später mausetot. Spätestens jetzt aber sind die Unschärfen von Heisenbergschem Format nicht mehr zu übersehen. Auch zuvor schon hatte Autenrieth geahnt, "dass nicht nur ich es bin, der in meiner Haut steckt", doch nun mehren sich die Hinweise auf eine konkurrierende Biographie. Falkner spielt das Doppelgängermotiv in allen Schattierungen durch, lässt den Leser nicht einmal ganz gewiss sein, ob die drei Freunde wirklich getrennte Personen waren (zumal auch die Figur Dirk Pruy einfach aus der Handlung verschwindet). Von Kellerträumen verfolgt, nagt der Zweifel an Autenrieth: "Der See der Erinnerungslosigkeit, für den das Wort Amnesie nun immer häufiger fiel, wurde immer größer." Hat er eine Tarnidentität gelebt? Steht er viel enger mit der RAF und der Stasi in Verbindung?
Bis in den metaphysischen Existentialismus hinein treibt der Autor das Verwirrspiel, wenn schließlich eine expressionistische Teufelsfigur, die zugleich die Züge eines maliziösen Therapeuten, Kiez-Verrückten und Geheimagenten besitzt, mit der sich selbst unheimlich gewordenen Hauptfigur über deren Integrität als Person spricht. Während das Geschehen im Todesstreifen zwischen Agenten-B-Movie und Depersonalisations-Fallstudie um Fassung ringt, rundet sich das Buch so zum postmodern poetologischen Roman erster Güte, denn natürlich ist es ein Zwiegespräch zwischen Autor und Figur, das wir hier belauschen. Da erschließen sich dann auch die endlos vielen literarischen Bezugnahmen auf Hölderlin, Kleist, Goethe, Balzac, Rilke, Kafka und immer wieder - klar! - Proust, da ergeben die lässig eingestreuten Bemerkungen der Figuren über seinerzeit führende Poststrukturalisten Sinn: Georg Autenrieth ist nicht nur eine Chiffre für Berlin, mit dem er den Wesenskern - die Schizophrenie - teilt, sondern, wenn man so will, Quintessenz und Kulmination der literarischen Tradition selbst, als Konglomerat aus Diskursen autopoietisch in die Welt gekommen und keinem Autor mehr gefügig.
Wenn man es nicht derart hochgedreht will (und das Buch lässt diese Möglichkeit zu), mag man sich die Ichschwäche des Helden vielleicht mit Verdrängung erklären. Wenn die Wahrheit gut dekonstruktiv nur eine "in Sicherheit gebrachte Lüge" ist, kann es auch mehrere nebeneinander geben. In jedem Fall stellt sich beim Leser zunehmend das Gefühl ein, das auch Autenrieth beschlichen haben muss: sich zwischen zwei einander gegenüberstehenden Spiegeln zu befinden. Dass die Kaskaden von Metaphern, Kalauern und Einfällen manchmal gar kein Ende zu nehmen scheinen - auf hohem Niveau ist das Buch durchaus ein wenig verquatscht -, soll kein echter Einwand sein. Man will ja schließlich nicht zu jener Kategorie von Lesern gehören, für die im Roman "meine Vermieterin" herhalten muss, die zeternd den fehlenden Zusammenhang oder die Frauenfeindlichkeit beklagt.
Freuen wir uns lieber, wie verspielt, humorvoll und sprachgewandt der Autor das Berlin der auf dem Boden liegenden Matratzen einfängt. Auf jeder Seite findet sich mindestens ein Satz, der im bonbonbunten Prenzlauer Berg - man hat sich für eine Identität entschieden - auf einen Jutebeutel gedruckt zu werden verdient.
OLIVER JUNGEN
Gerhard Falkner: "Apollokalypse". Roman. Berlin Verlag, Berlin 2016. 430 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Es reißt einen in die eigenen Erinnerungen zurück, dieses sprudelnde, überbordende Buch, in dem ein Doppelgänger des Autors seinen irgendwie allegorischen Helden durch die Niederungen der Identitätssuche führt und dabei das doppelgesichtige Berlin retrospektiv so genau vermisst, dass der verblasste (und ein wenig auch klebrige) Mythos der Zerrissenheit für einen Moment wieder seinen alten Glanz erhält. Hier ersteht der Osten noch einmal in seiner ganzen Pracht, "geronnen wie altes Blut", "ein deutsches Pompeji": "Die meisten Leute, denen ich begegnete, sahen aus, als ob sie steckbrieflich gesucht würden . . . Abgeblättertes, aufplatzendes, ungeschöntes, ruchloses Wohnmaterial erhob sich längs der Straßen, ohne Farbe . . . Sogar der Himmel sah aus, als hätte man ihn im Neuen Deutschland gedruckt."
Gespiegelt wird diese herrliche Kaputtheit vom bordellhaften Westen mit seinen Billigläden, "die sich mit ihrem Gekröse auf die Gehsteige ergossen. Wie Soldaten nach dem Bauchschuss." Dazu die Clubs, das Konspirative, der geistige Hedonismus und der Sex. Auf vier Worte gebracht: "Berlin bot außerplanmäßiges Existieren."
Der beherzte Kopfsprung in die Frontstadt des Wahnsinns beginnt trotz des nicht ganz greifbaren Ich-Erzählers, der in kreisenden Erinnerungen zurückblickt, vergleichsweise übersichtlich. In den frühen achtziger Jahren zog es Georg Autenrieth nach Berlin, wo er gemeinsam mit dem psychisch labilen Künstler Heinrich Büttner und dem geldbefleckten Müßiggänger Dirk Pruy seine Jugend vergeudete und zum Intellektuellen heranreifte: ein Dandyleben, ausgezeichnet durch eine "hochmütige Melancholie, die mit einer stetigen Angst vor dem Versagen und vor dem Erhaschen eines Blicks auf die Überflüssigkeit und die Unvertretbarkeit der eigenen Existenz einherging". Zwar pflegte Autenrieth Beziehungen zum linksradikalen Milieu, aber im Kern war er ein Zyniker, der allenfalls die akademische Daseinsweise gelten ließ und auch einmal verblasen den "Blitzsieg des Geistes gegen die Kräfte des Nachtkollers" herbeisehnte.
Trotzdem ergaben sich die Freunde mit Haut und Haaren dem Rausch. Wofür hat man denn sonst einen Körper? Außerdem kannten sie ihren Nietzsche gut genug, um zu wissen, dass aus dem Zusammenprall des Dionysischen mit dem Apollinischen die (Lebens-)Kunst hervorgeht.
Der Phallozentrismus habe Berlin zu dieser Zeit fest im Griff gehabt, weiß der Erzähler. Seinem Helden lässt er es in dieser Hinsicht an nichts mangeln. Den zahlreichen Nahaufnahmen aus dem Intimleben gelingt dabei das Kunststück, authentisch, aber nicht anstößig zu wirken. Dass Autenrieth, sexbesessen bis zur Raserei, dem manisch-depressiven Büttner die junge Geliebte Isabel ausspannte, wurde erst in dem Moment zum Problem, als Büttner sich vor einen Zug warf. Die Folge war der komplette Rückzug Autenrieths aus der Öffentlichkeit. Als transparenter "Glasmann" wollte er Buße tun, abwesend unter Anwesenden sein, was sich am Steglitzer Kreisel, einem Ort ohne jede Anschaulichkeit, perfekt verwirklichen ließ.
Dann schließt sich nach dem Modell des doppelten Cursus ein zweiter Umlauf des Helden an, der eine noch ausschweifendere Kopie des ersten zu sein scheint. Wieder gibt es eine tabulose Geliebte, Bilijana mit Namen. Die Bulgarin ist verheiratet mit einem wichtigen Bundesnachrichtendienst-Funktionär und später mausetot. Spätestens jetzt aber sind die Unschärfen von Heisenbergschem Format nicht mehr zu übersehen. Auch zuvor schon hatte Autenrieth geahnt, "dass nicht nur ich es bin, der in meiner Haut steckt", doch nun mehren sich die Hinweise auf eine konkurrierende Biographie. Falkner spielt das Doppelgängermotiv in allen Schattierungen durch, lässt den Leser nicht einmal ganz gewiss sein, ob die drei Freunde wirklich getrennte Personen waren (zumal auch die Figur Dirk Pruy einfach aus der Handlung verschwindet). Von Kellerträumen verfolgt, nagt der Zweifel an Autenrieth: "Der See der Erinnerungslosigkeit, für den das Wort Amnesie nun immer häufiger fiel, wurde immer größer." Hat er eine Tarnidentität gelebt? Steht er viel enger mit der RAF und der Stasi in Verbindung?
Bis in den metaphysischen Existentialismus hinein treibt der Autor das Verwirrspiel, wenn schließlich eine expressionistische Teufelsfigur, die zugleich die Züge eines maliziösen Therapeuten, Kiez-Verrückten und Geheimagenten besitzt, mit der sich selbst unheimlich gewordenen Hauptfigur über deren Integrität als Person spricht. Während das Geschehen im Todesstreifen zwischen Agenten-B-Movie und Depersonalisations-Fallstudie um Fassung ringt, rundet sich das Buch so zum postmodern poetologischen Roman erster Güte, denn natürlich ist es ein Zwiegespräch zwischen Autor und Figur, das wir hier belauschen. Da erschließen sich dann auch die endlos vielen literarischen Bezugnahmen auf Hölderlin, Kleist, Goethe, Balzac, Rilke, Kafka und immer wieder - klar! - Proust, da ergeben die lässig eingestreuten Bemerkungen der Figuren über seinerzeit führende Poststrukturalisten Sinn: Georg Autenrieth ist nicht nur eine Chiffre für Berlin, mit dem er den Wesenskern - die Schizophrenie - teilt, sondern, wenn man so will, Quintessenz und Kulmination der literarischen Tradition selbst, als Konglomerat aus Diskursen autopoietisch in die Welt gekommen und keinem Autor mehr gefügig.
Wenn man es nicht derart hochgedreht will (und das Buch lässt diese Möglichkeit zu), mag man sich die Ichschwäche des Helden vielleicht mit Verdrängung erklären. Wenn die Wahrheit gut dekonstruktiv nur eine "in Sicherheit gebrachte Lüge" ist, kann es auch mehrere nebeneinander geben. In jedem Fall stellt sich beim Leser zunehmend das Gefühl ein, das auch Autenrieth beschlichen haben muss: sich zwischen zwei einander gegenüberstehenden Spiegeln zu befinden. Dass die Kaskaden von Metaphern, Kalauern und Einfällen manchmal gar kein Ende zu nehmen scheinen - auf hohem Niveau ist das Buch durchaus ein wenig verquatscht -, soll kein echter Einwand sein. Man will ja schließlich nicht zu jener Kategorie von Lesern gehören, für die im Roman "meine Vermieterin" herhalten muss, die zeternd den fehlenden Zusammenhang oder die Frauenfeindlichkeit beklagt.
Freuen wir uns lieber, wie verspielt, humorvoll und sprachgewandt der Autor das Berlin der auf dem Boden liegenden Matratzen einfängt. Auf jeder Seite findet sich mindestens ein Satz, der im bonbonbunten Prenzlauer Berg - man hat sich für eine Identität entschieden - auf einen Jutebeutel gedruckt zu werden verdient.
OLIVER JUNGEN
Gerhard Falkner: "Apollokalypse". Roman. Berlin Verlag, Berlin 2016. 430 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
eBook, ePUB
Georg Authenrieth erinnert sich. Soweit er das noch kann, denn vieles ist weg oder nur noch verschwommen da, manches ergibt auch wenig Sinn. Aber vielleicht sind das ja auch nicht seine Erinnerungen, sondern die seines Doppelgängers. Schließlich ist ohnehin alles nur Rekonstruktion. Die …
Mehr
Georg Authenrieth erinnert sich. Soweit er das noch kann, denn vieles ist weg oder nur noch verschwommen da, manches ergibt auch wenig Sinn. Aber vielleicht sind das ja auch nicht seine Erinnerungen, sondern die seines Doppelgängers. Schließlich ist ohnehin alles nur Rekonstruktion. Die Kindheit in Nürnberg, die erste Liebe zu Isabel, das Leben im Berlin der 80er Jahre. Die zweite wichtige Frau, Billy, der Anschlag, der Geheimdienst, die Freunde, die Reisen in die USA und die DDR. Man muss das nehmen, was man hat und so macht es auch Georg oder Georg über den Menschen Georg Authenrieth, der vorgibt, er zu sein und es vielleicht sogar ist.
Gerhard Falkners Roman hat es 2016 auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Die Presse hat den Roman bejubelt: ein neues Kapitel der Berlin-Literatur (Süddeutsche), großartig (Deutschlandradio Kultur), fantastisch (Zeit), kunstvoll und komisch erzählt (LiteraturSpiegel). Ich habe mich auf jeder Seite gefragt: was soll das? Was will mir das sagen? Hä?
Ein Erzähler, der sich seiner Erinnerung nicht sicher ist – ok, keine ganz originelle Idee, aber kann man was draus machen. Diskontinuierliche, unchronologische Erzählung – kein Thema, man darf als Leser schon ein wenig gefordert werden. Episodenhafte Erzählungen, lose Verbindungen – auch das kann seinen Reiz haben. Aber hier war mir alles zu lose, zu unverbindlich, zu wenig greifbar. Phasenweise waren zwar Ansätze einer Erzählung vorhanden, diese wurden dann wiederum von absurden Spekulationen über das Sein abgelöst und der Erzähler springt von der ersten zur dritten Person. Wenn alles im Rahmen von Spekulation und Unverbindlichkeit bleibt, wozu dann noch ein Roman? Wenn selbst die Literatur sich nicht mehr in der fiktiven Welt festlegt, wer soll dies denn noch in der Realität tun? Ein Roman, der nichts sagen will, ist für mich letztlich egal und auch irrelevant.
Rechnet man die Idee einer inhaltlichen Aussage raus, könnte der Text immer noch durch seine Konstruktion und die Sprache punkten. Aber auch da erreicht er mich nicht. Insbesondere die Ergüsse im Bereich der Fäkalien sind einfach nur widerlich, die Wortwahl abstoßend und dezidierte Beobachtungen des Stuhlgangs sind für mich keine Kunst, sondern schlichtweg verzichtbar.
Irgendwer scheint den Roman verstanden zu haben, ich offenkundig nicht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Poststrukturalistisches Chaos
Der vielseitig tätige Schriftsteller Bernhard Falkner hat 2016 mit «Apollokalypse» sein Prosadebüt vorgelegt, ein Epochenroman aus dem Berlin der achtziger und neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, der es auf Anhieb auf die Longlist des …
Mehr
Poststrukturalistisches Chaos
Der vielseitig tätige Schriftsteller Bernhard Falkner hat 2016 mit «Apollokalypse» sein Prosadebüt vorgelegt, ein Epochenroman aus dem Berlin der achtziger und neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, der es auf Anhieb auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2016 geschafft hat. Der Neologismus seines Titels spiegelt das Schöne und Verführerische in der totalen Zerstörung. Gott seines Romans ist ein zwielichtiger, dionysischer Held, dem nach allmählichem Zerbrechen sämtlicher Illusionen schließlich der Leibhaftige gegenübertritt. Mehr als zehn Jahre, so wird kolportiert, hat der österreichische Lyriker sich Zeit gelassen für seinen Roman-Erstling, dessen beeindruckende Bildermacht und Intertextualität vom Feuilleton zum Teil bejubelt wurde, während Andere jedwede erzählerische Kontinuität vermissen und am Falknerschen «Wortgeschwurbel» zu ersticken drohen. «Meine Vermieterin sagt, dies hier wäre ein schlechter Roman», lässt der Autor mit geheuchelter Selbstkritik seinen Doppelgänger sagen, und er liefert wortreich auch gleich die Gründe dafür mit.
«Wenn man verliebt ist und gut gefickt hat, verdoppelt die Welt ihre Anstrengung, in Erscheinung zu treten» lautet symptomatisch der erste Satz des Romans. Georg Autenrieth, eine undurchsichtige Gestalt aus Westdeutschland, ist dem Sog der Metropole erlegen und durchstreift auf der Suche nach Genuss die einschlägige Szene Berlins in der Wendezeit. Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll stehen im Mittelpunkt einer extensiv ausgelebten Lebensgier, die sich völlig unpolitisch gibt, selbst der Mauerfall wird nicht thematisiert. Gleichwohl unterhält der junge Mann scheinbar Kontakte zur RAF und zu den Geheimdiensten beider Deutschlands, - scheinbar, denn wie alles bleibt auch das vage in diesem Roman, der sich immer wieder in Andeutungen verliert. Die Wendepunkte dabei setzten Frauen: «Das Buch Isabel» widmet sich der Geschichte seines manisch-depressiven Freundes Büttner, eines exaltierten Künstlers, dem er die Freundin ausspannt, indem er sie zu einer Reise in die USA einlädt, deren Höhepunkt eine feuchtfröhliche Nacht bei Musik vom Plattenspieler im Amargosa Opera House von Death Valley Junction bildet. Büttner landet in der Psychiatrie und wirft sich später vor den Zug, was bei Autenrieth zu einer Identitätskrise führt, in deren Verlauf er untertaucht, sich als «Glasmann» unsichtbar zu machen sucht. Die zweite Zäsur unter dem Titel «Das Buch Billy» ist dann die leidenschaftliche Affäre mit Bilijana, einer undurchsichtigen Bulgarin, die mit einem deutschen Militärattaché liiert ist. Alle diese zwiespältigen Figuren bewegen sich voller Obsessionen in einem geradezu mythologischen Berlin, welches sie voller burlesk überzeichneter Ausschweifungen rauschhaft erleben, das sie dann aber immer wieder ernüchtert auf sich selbst zurückwirft.
Eine den Leser faszinierende Geschichte auszubreiten ist Gerhard Falkners Sache nicht, das Atmosphärische bildmächtig und sprachverliebt in allen seinen Facetten auszubreiten ist schon eher sein Metier, der Lyriker in ihm ist partout nicht zu verleugnen. Dabei stört das vulgär Sexuelle seines narzisstischen Helden mit den multiplen Identitäten, der zuweilen neckisch mit sich selber spricht und als Figur vom Autor selbst kaum noch unterscheidbar ist. Als Poststrukturalist bildet Falkner mit seiner Sprachmacht Realität nicht nur ab, er erschafft sie vielmehr selbst durch seine radikale Abkehr von einer objektivistischen Sicht sozialer oder moralischer Kriterien.
Sein Anspielungsreichtum wirkt dabei selbstverliebt überzogen, die Literaturgeschichte wird schon fast parodistisch einbezogen in den schwer lesbaren, diskontinuierlichen Erzählfluss, der heftig zwischen Schein und Sein mäandert. So bleibt dem Leser als Lektürebonus die grandiose Beschreibungskunst des Autors, der mit scharfem Blick hinter die Fassaden Berlins blickt, sein narratives Chaos aber nicht auflöst, der alles in der Schwebe hält bis zum Schluss.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für