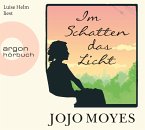»Mehr kann man manchmal nicht tun, finde ich. Nicht weiterfragen, aber dableiben.« Morton
Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen Anruf bekommt, ist in seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Sein bester Freund Bogi ist plötzlich sehr krank. Kurz danach fährt Jacqueline Schmiedebach vom Einstein Gymnasium auf einem Hollandrad an ihm vorbei, und die nächste Erschütterung nimmt ihren Lauf. Zwischen diesen beiden Polen, der Möglichkeit des Todes und der Möglichkeit der Liebe, spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu, geraten außer Kontrolle und stellen Motte vor unbekannte, schmerzhafte Herausforderungen. Doch zum richtigen Zeitpunkt sind die richtigen Leute an Mottes Seite und tun genau das Richtige. Und er selbst schaut den Dingen mutig ins Gesicht, mit scharfem Blick und trockenem Witz.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen Anruf bekommt, ist in seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Sein bester Freund Bogi ist plötzlich sehr krank. Kurz danach fährt Jacqueline Schmiedebach vom Einstein Gymnasium auf einem Hollandrad an ihm vorbei, und die nächste Erschütterung nimmt ihren Lauf. Zwischen diesen beiden Polen, der Möglichkeit des Todes und der Möglichkeit der Liebe, spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu, geraten außer Kontrolle und stellen Motte vor unbekannte, schmerzhafte Herausforderungen. Doch zum richtigen Zeitpunkt sind die richtigen Leute an Mottes Seite und tun genau das Richtige. Und er selbst schaut den Dingen mutig ins Gesicht, mit scharfem Blick und trockenem Witz.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Der Schauspieler Matthias Brandt ist ein wunderbarer Erzähler. Sein Roman „Blackbird“ geht unter die Haut.
© BÜCHERmagazin, Christiane von Korff
Das Rätsel der männlichen Teenagerseele von 1970
Ein Autor denkt für seine Figuren: Matthias Brandt erzählt in "Blackbird" von Tod und Liebe in der Jugend
Der haut total rein, der Blackbirdfielder", sagt Bogi zu Motte. Die beiden Schulfreunde sind unterwegs zu einem Fußballcamp. Amselfelder ist ein billiger "Jugo-Wein", den sich die Jungs unter Mithilfe einer nachlässigen Supermarktkassiererin leisten können. Nach dieser Amsel im Felder ist das Romandebüt des Schauspielers Matthias Brandt benannt. In der Wortschöpfung "Blackbirdfielder" verbergen sich Glanz und Elend der Jugend: verfeinertes Sprachgefühl, ironische Selbstbetrachtung, das Versprechen auf einen billigen Rausch und erste Kontakte mit dem, was nach dem Exzess kommt.
Der jüngste Sohn von Bundeskanzler Willy Brandt war vor allem als "Polizeiruf"-Kommissar Hanns von Meuffels im Abendprogramm der ARD zu erleben. Diskret, distinguiert, ein bisschen vernuschelt. Vor drei Jahren erfand Brandt sich dann mit einem Erzählungsband neu als Autor. "Raumpatrouille" war ein geglückter Versuch, die Bonner Kindheit des Autors in skurrilen Erinnerungsbildern aufleben zu lassen. In "Blackbird" erzählt Brandt nun eine Jugendgeschichte aus den Siebzigern.
Und zwar so: Bogi, eigentlich Manfred, leidet unter Lymphdrüsenkrebs und wird bald an dieser heimtückischen Krankheit sterben und seinen besten Freund Motte alleinlassen. Weil aber mit sechzehn noch so viele andere Sachen wichtig sind, geht es über weite Strecken des Romans gar nicht um den Krebstod des Freundes, sondern darum, wie das Leben mit sechzehn so ist. Brandt nimmt seine Leser mit auf peinlich missratene Dates, in die Scheidungsdramen der Siebzigerjahre-Eltern, in die Unterrichtsstunden alter Nazilehrer, aber auch in die junger Achtundsechziger-Idealisten. Das ist recht unterhaltsam, manchem Leser vielleicht sogar genug. Und doch ist dieses Buch ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, einen Jugendroman zu schreiben - einen jugendlichen Ich-Erzähler nämlich so erzählen zu lassen, dass er nicht wie die Marionette eines Erwachsenen klingt, der sich bloß vorstellt, wie junge Leute so reden und worüber. Dass, was Wolfgang Herrndorf gelungen ist, was zuletzt auch Wolf Haas in seiner kleinen Roadnovel "Junger Mann" geschafft hat, ist in Wahrheit eine hohe Kunst der Einfühlung: das Eintauchen in die Logik des Jungseins jenseits der Pointe.
Dazu gehört zum Beispiel das Aufgeben gefakter Souveränität. Dieser Motte, den wir uns nach dem Willen des Autors als etwas muffeligen Zeitgenossen vorzustellen haben, hat jederzeit die gedankliche Kontrolle über das, was er zu verarbeiten hat. Die Krebsdiagnose seines Kumpels löst zum Beispiel einerseits Trauer in ihm aus: "Aber eigentlich war ich sauer auf ihn, weil ich mein altes Leben wiederhaben wollte, inklusive ihm, Bogi. Ich fand einfach, dass ich auch ohne den Mist schon genug um die Ohren hatte, keine Ahnung, hatte ich mir ja nicht ausgesucht, dass ich das jetzt dachte."
Hat er sich tatsächlich nicht ausgedacht, dass er das jetzt denken muss. Dass er jetzt zurückrudern soll und mit dem Gewissen eines Erwachsenen einräumen muss, dass solches Denken nach einer Rechtfertigung verlangt. Das hat sich nämlich sein Schöpfer Matthias Brandt ausgedacht. Ebenso den dauerhaft angeödeten Ton, der alles und jedes von oben herab kommentiert. Gekotzt wird "am Strahl", Orte liegen am "Arsch der Welt", ,Lehrer sind "Vollhorste", man selbst hat eine "Kacklaune", und die Tischordnung im Klassenzimmer ist eine "verdammte, verschissene Hufeisensitzordnung". Um Fassungslosigkeit auf der Kinderstation des Krankenhauses, auf der Bogi behandelt wird, zum Ausdruck zu bringen, muss Motte sagen: "bekacktes Giraffenzimmer". Zusätzlich müssen er und seine Kumpels darüber nachdenken, ob Bogi die Krankenschwestern auf Station "flachlegt".
Einfach mal steil ins Unbekannte der männlichen Teenagerseele von 1970 behauptet: Derlei am Pornographischen geschulte Phantasien sind schiere Projektion. Sicherlich haben erotische Überschreitungsphantasien zu allen Zeiten eine wichtige Rolle beim Erwachsenwerden gespielt. Aber dass man sechzehnjährig ältere Kinderkrankenschwestern auf der Krebsstation flachlegt, gehört eher, wenn überhaupt, ins Maulheldenrepertoire der Generation YouPorn. Vermutlich aber eher ins nachgereichte Wunschdenken der Generation Brandt. Nicht schlimm? Nicht wirklich. Aber es sind genau diese Unstimmigkeiten, die den Roman so seelenlos machen. Am Ende des Buchs ist man den Hauptfiguren nicht wirklich nahegekommen. Ihre Probleme und Abenteuer wirken austauschbar. Man hat sie anderswo schon besser gelesen. Nicht zuletzt in Varianten selbst erlebt. Gerade deshalb ist der Coming-of-Age-Roman im Gegensatz zum, sagen wir, Künstlerroman vielleicht eine der schwierigsten Stilübungen.
Zuletzt: Ein Jugendroman, der in der Welt der Literatur überdauern will, muss immer auch über den beschränkten Horizont seines jugendlichen Personals hinausweisen. Indem zum Beispiel die Doppelmoral einer Gesellschaft entlarvt wird. Oder deren Geschlechterrollen hervortreten. Zumindest müsste sich am Ende eine Art Entwicklung abzeichnen, die über die erzählte Zeit hinausweist. All das bietet "Blackbird" nicht. Am Ende steht ein Begräbnis. Motte hat eine nette Freundin, mit der er gerne knutscht. Es fließen auch endlich ein paar Tränen aus verstockten Jungsgesichtern. Und Mamas neuer Freund will mit den Jungs einen kiffen. Ganz schön verrückte Welt. Ganz schön verrückte Jugend. Darauf einen Amselfelder.
KATHARINA TEUTSCH
Matthias Brandt: "Blackbird". Roman.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2019. 276 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Ein Autor denkt für seine Figuren: Matthias Brandt erzählt in "Blackbird" von Tod und Liebe in der Jugend
Der haut total rein, der Blackbirdfielder", sagt Bogi zu Motte. Die beiden Schulfreunde sind unterwegs zu einem Fußballcamp. Amselfelder ist ein billiger "Jugo-Wein", den sich die Jungs unter Mithilfe einer nachlässigen Supermarktkassiererin leisten können. Nach dieser Amsel im Felder ist das Romandebüt des Schauspielers Matthias Brandt benannt. In der Wortschöpfung "Blackbirdfielder" verbergen sich Glanz und Elend der Jugend: verfeinertes Sprachgefühl, ironische Selbstbetrachtung, das Versprechen auf einen billigen Rausch und erste Kontakte mit dem, was nach dem Exzess kommt.
Der jüngste Sohn von Bundeskanzler Willy Brandt war vor allem als "Polizeiruf"-Kommissar Hanns von Meuffels im Abendprogramm der ARD zu erleben. Diskret, distinguiert, ein bisschen vernuschelt. Vor drei Jahren erfand Brandt sich dann mit einem Erzählungsband neu als Autor. "Raumpatrouille" war ein geglückter Versuch, die Bonner Kindheit des Autors in skurrilen Erinnerungsbildern aufleben zu lassen. In "Blackbird" erzählt Brandt nun eine Jugendgeschichte aus den Siebzigern.
Und zwar so: Bogi, eigentlich Manfred, leidet unter Lymphdrüsenkrebs und wird bald an dieser heimtückischen Krankheit sterben und seinen besten Freund Motte alleinlassen. Weil aber mit sechzehn noch so viele andere Sachen wichtig sind, geht es über weite Strecken des Romans gar nicht um den Krebstod des Freundes, sondern darum, wie das Leben mit sechzehn so ist. Brandt nimmt seine Leser mit auf peinlich missratene Dates, in die Scheidungsdramen der Siebzigerjahre-Eltern, in die Unterrichtsstunden alter Nazilehrer, aber auch in die junger Achtundsechziger-Idealisten. Das ist recht unterhaltsam, manchem Leser vielleicht sogar genug. Und doch ist dieses Buch ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, einen Jugendroman zu schreiben - einen jugendlichen Ich-Erzähler nämlich so erzählen zu lassen, dass er nicht wie die Marionette eines Erwachsenen klingt, der sich bloß vorstellt, wie junge Leute so reden und worüber. Dass, was Wolfgang Herrndorf gelungen ist, was zuletzt auch Wolf Haas in seiner kleinen Roadnovel "Junger Mann" geschafft hat, ist in Wahrheit eine hohe Kunst der Einfühlung: das Eintauchen in die Logik des Jungseins jenseits der Pointe.
Dazu gehört zum Beispiel das Aufgeben gefakter Souveränität. Dieser Motte, den wir uns nach dem Willen des Autors als etwas muffeligen Zeitgenossen vorzustellen haben, hat jederzeit die gedankliche Kontrolle über das, was er zu verarbeiten hat. Die Krebsdiagnose seines Kumpels löst zum Beispiel einerseits Trauer in ihm aus: "Aber eigentlich war ich sauer auf ihn, weil ich mein altes Leben wiederhaben wollte, inklusive ihm, Bogi. Ich fand einfach, dass ich auch ohne den Mist schon genug um die Ohren hatte, keine Ahnung, hatte ich mir ja nicht ausgesucht, dass ich das jetzt dachte."
Hat er sich tatsächlich nicht ausgedacht, dass er das jetzt denken muss. Dass er jetzt zurückrudern soll und mit dem Gewissen eines Erwachsenen einräumen muss, dass solches Denken nach einer Rechtfertigung verlangt. Das hat sich nämlich sein Schöpfer Matthias Brandt ausgedacht. Ebenso den dauerhaft angeödeten Ton, der alles und jedes von oben herab kommentiert. Gekotzt wird "am Strahl", Orte liegen am "Arsch der Welt", ,Lehrer sind "Vollhorste", man selbst hat eine "Kacklaune", und die Tischordnung im Klassenzimmer ist eine "verdammte, verschissene Hufeisensitzordnung". Um Fassungslosigkeit auf der Kinderstation des Krankenhauses, auf der Bogi behandelt wird, zum Ausdruck zu bringen, muss Motte sagen: "bekacktes Giraffenzimmer". Zusätzlich müssen er und seine Kumpels darüber nachdenken, ob Bogi die Krankenschwestern auf Station "flachlegt".
Einfach mal steil ins Unbekannte der männlichen Teenagerseele von 1970 behauptet: Derlei am Pornographischen geschulte Phantasien sind schiere Projektion. Sicherlich haben erotische Überschreitungsphantasien zu allen Zeiten eine wichtige Rolle beim Erwachsenwerden gespielt. Aber dass man sechzehnjährig ältere Kinderkrankenschwestern auf der Krebsstation flachlegt, gehört eher, wenn überhaupt, ins Maulheldenrepertoire der Generation YouPorn. Vermutlich aber eher ins nachgereichte Wunschdenken der Generation Brandt. Nicht schlimm? Nicht wirklich. Aber es sind genau diese Unstimmigkeiten, die den Roman so seelenlos machen. Am Ende des Buchs ist man den Hauptfiguren nicht wirklich nahegekommen. Ihre Probleme und Abenteuer wirken austauschbar. Man hat sie anderswo schon besser gelesen. Nicht zuletzt in Varianten selbst erlebt. Gerade deshalb ist der Coming-of-Age-Roman im Gegensatz zum, sagen wir, Künstlerroman vielleicht eine der schwierigsten Stilübungen.
Zuletzt: Ein Jugendroman, der in der Welt der Literatur überdauern will, muss immer auch über den beschränkten Horizont seines jugendlichen Personals hinausweisen. Indem zum Beispiel die Doppelmoral einer Gesellschaft entlarvt wird. Oder deren Geschlechterrollen hervortreten. Zumindest müsste sich am Ende eine Art Entwicklung abzeichnen, die über die erzählte Zeit hinausweist. All das bietet "Blackbird" nicht. Am Ende steht ein Begräbnis. Motte hat eine nette Freundin, mit der er gerne knutscht. Es fließen auch endlich ein paar Tränen aus verstockten Jungsgesichtern. Und Mamas neuer Freund will mit den Jungs einen kiffen. Ganz schön verrückte Welt. Ganz schön verrückte Jugend. Darauf einen Amselfelder.
KATHARINA TEUTSCH
Matthias Brandt: "Blackbird". Roman.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2019. 276 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ein Autor denkt für seine Figuren: Matthias Brandt erzählt in "Blackbird" von Tod und Liebe in der Jugend
Der haut total rein, der Blackbirdfielder", sagt Bogi zu Motte. Die beiden Schulfreunde sind unterwegs zu einem Fußballcamp. Amselfelder ist ein billiger "Jugo-Wein", den sich die Jungs unter Mithilfe einer nachlässigen Supermarktkassiererin leisten können. Nach dieser Amsel im Felder ist das Romandebüt des Schauspielers Matthias Brandt benannt. In der Wortschöpfung "Blackbirdfielder" verbergen sich Glanz und Elend der Jugend: verfeinertes Sprachgefühl, ironische Selbstbetrachtung, das Versprechen auf einen billigen Rausch und erste Kontakte mit dem, was nach dem Exzess kommt.
Der jüngste Sohn von Bundeskanzler Willy Brandt war vor allem als "Polizeiruf"-Kommissar Hanns von Meuffels im Abendprogramm der ARD zu erleben. Diskret, distinguiert, ein bisschen vernuschelt. Vor drei Jahren erfand Brandt sich dann mit einem Erzählungsband neu als Autor. "Raumpatrouille" war ein geglückter Versuch, die Bonner Kindheit des Autors in skurrilen Erinnerungsbildern aufleben zu lassen. In "Blackbird" erzählt Brandt nun eine Jugendgeschichte aus den Siebzigern.
Und zwar so: Bogi, eigentlich Manfred, leidet unter Lymphdrüsenkrebs und wird bald an dieser heimtückischen Krankheit sterben und seinen besten Freund Motte alleinlassen. Weil aber mit sechzehn noch so viele andere Sachen wichtig sind, geht es über weite Strecken des Romans gar nicht um den Krebstod des Freundes, sondern darum, wie das Leben mit sechzehn so ist. Brandt nimmt seine Leser mit auf peinlich missratene Dates, in die Scheidungsdramen der Siebzigerjahre-Eltern, in die Unterrichtsstunden alter Nazilehrer, aber auch in die junger Achtundsechziger-Idealisten. Das ist recht unterhaltsam, manchem Leser vielleicht sogar genug. Und doch ist dieses Buch ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, einen Jugendroman zu schreiben - einen jugendlichen Ich-Erzähler nämlich so erzählen zu lassen, dass er nicht wie die Marionette eines Erwachsenen klingt, der sich bloß vorstellt, wie junge Leute so reden und worüber. Dass, was Wolfgang Herrndorf gelungen ist, was zuletzt auch Wolf Haas in seiner kleinen Roadnovel "Junger Mann" geschafft hat, ist in Wahrheit eine hohe Kunst der Einfühlung: das Eintauchen in die Logik des Jungseins jenseits der Pointe.
Dazu gehört zum Beispiel das Aufgeben gefakter Souveränität. Dieser Motte, den wir uns nach dem Willen des Autors als etwas muffeligen Zeitgenossen vorzustellen haben, hat jederzeit die gedankliche Kontrolle über das, was er zu verarbeiten hat. Die Krebsdiagnose seines Kumpels löst zum Beispiel einerseits Trauer in ihm aus: "Aber eigentlich war ich sauer auf ihn, weil ich mein altes Leben wiederhaben wollte, inklusive ihm, Bogi. Ich fand einfach, dass ich auch ohne den Mist schon genug um die Ohren hatte, keine Ahnung, hatte ich mir ja nicht ausgesucht, dass ich das jetzt dachte."
Hat er sich tatsächlich nicht ausgedacht, dass er das jetzt denken muss. Dass er jetzt zurückrudern soll und mit dem Gewissen eines Erwachsenen einräumen muss, dass solches Denken nach einer Rechtfertigung verlangt. Das hat sich nämlich sein Schöpfer Matthias Brandt ausgedacht. Ebenso den dauerhaft angeödeten Ton, der alles und jedes von oben herab kommentiert. Gekotzt wird "am Strahl", Orte liegen am "Arsch der Welt", ,Lehrer sind "Vollhorste", man selbst hat eine "Kacklaune", und die Tischordnung im Klassenzimmer ist eine "verdammte, verschissene Hufeisensitzordnung". Um Fassungslosigkeit auf der Kinderstation des Krankenhauses, auf der Bogi behandelt wird, zum Ausdruck zu bringen, muss Motte sagen: "bekacktes Giraffenzimmer". Zusätzlich müssen er und seine Kumpels darüber nachdenken, ob Bogi die Krankenschwestern auf Station "flachlegt".
Einfach mal steil ins Unbekannte der männlichen Teenagerseele von 1970 behauptet: Derlei am Pornographischen geschulte Phantasien sind schiere Projektion. Sicherlich haben erotische Überschreitungsphantasien zu allen Zeiten eine wichtige Rolle beim Erwachsenwerden gespielt. Aber dass man sechzehnjährig ältere Kinderkrankenschwestern auf der Krebsstation flachlegt, gehört eher, wenn überhaupt, ins Maulheldenrepertoire der Generation YouPorn. Vermutlich aber eher ins nachgereichte Wunschdenken der Generation Brandt. Nicht schlimm? Nicht wirklich. Aber es sind genau diese Unstimmigkeiten, die den Roman so seelenlos machen. Am Ende des Buchs ist man den Hauptfiguren nicht wirklich nahegekommen. Ihre Probleme und Abenteuer wirken austauschbar. Man hat sie anderswo schon besser gelesen. Nicht zuletzt in Varianten selbst erlebt. Gerade deshalb ist der Coming-of-Age-Roman im Gegensatz zum, sagen wir, Künstlerroman vielleicht eine der schwierigsten Stilübungen.
Zuletzt: Ein Jugendroman, der in der Welt der Literatur überdauern will, muss immer auch über den beschränkten Horizont seines jugendlichen Personals hinausweisen. Indem zum Beispiel die Doppelmoral einer Gesellschaft entlarvt wird. Oder deren Geschlechterrollen hervortreten. Zumindest müsste sich am Ende eine Art Entwicklung abzeichnen, die über die erzählte Zeit hinausweist. All das bietet "Blackbird" nicht. Am Ende steht ein Begräbnis. Motte hat eine nette Freundin, mit der er gerne knutscht. Es fließen auch endlich ein paar Tränen aus verstockten Jungsgesichtern. Und Mamas neuer Freund will mit den Jungs einen kiffen. Ganz schön verrückte Welt. Ganz schön verrückte Jugend. Darauf einen Amselfelder.
KATHARINA TEUTSCH
Matthias Brandt: "Blackbird". Roman.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2019. 276 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Was Blackbird so besonders macht, so klar, so unabweislich, so bewegend, dass man sich auf einer und derselben Seite kaputtlachen kann, um im nächsten Moment den Tränen nah zu sein, das sind die Sprache, das Gespür für Rhythmus, Szenen, Bilder und Proportion.« Peter Körte FAS 20190818
»Ein wunderbares Buch - so cool wie herzergreifend.« Eva-Maria Lerch Publik-Forum 20210611