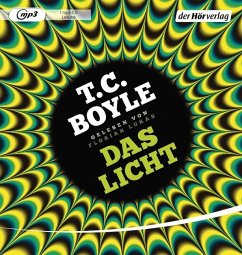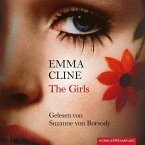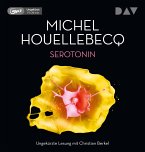T. C. Boyles Roman über den Psychologen und Hippie Timothy Leary und dessen LSD-Experimente: hell, bunt und wie ein Rausch
Harvard-Professor, Psychologe und LSD-Guru Timothy Leary schart Anfang der 60er einen Kreis von Jüngern um sich, für neuartige Experimente mit psychedelischen Drogen. Unter dem Deckmantel seriöser Wissenschaft steuert das Ganze auf den totalen Kontrollverlust zu. Ein greller Trip an die Grenzen des Bewusstseins und darüber hinaus. Endlich wird der aufstrebende wissenschaftliche Assistent Fitz auf eine der LSD-Partys seines Professors, des Psychologen und LSD-Gurus Timothy Leary eingeladen. Er erhofft sich davon einen wichtigen Karriereschritt, merkt aber bald, dass Learys Ziele weniger medizinischer Natur sind; es geht dem Psychologen um eine Revolution des Bewusstseins und eine von sozialen Zwängen losgelöste Lebensform. Fitz wird mitgerissen von dieser Vision, mit Frau und Sohn schließt er sich der Leary-Truppe an: Sie leben in Mexiko, später in der berühmten Kommune in Millbrook, mit Drogen und sexuellen Ausschweifungen ohne Ende. Ein rauschhaftes Hörerlebnis - T.C. Boyle at his best.
Gelesen von Florian Lukas.
(1 mp3-CD, Laufzeit: 11h 28)
Harvard-Professor, Psychologe und LSD-Guru Timothy Leary schart Anfang der 60er einen Kreis von Jüngern um sich, für neuartige Experimente mit psychedelischen Drogen. Unter dem Deckmantel seriöser Wissenschaft steuert das Ganze auf den totalen Kontrollverlust zu. Ein greller Trip an die Grenzen des Bewusstseins und darüber hinaus. Endlich wird der aufstrebende wissenschaftliche Assistent Fitz auf eine der LSD-Partys seines Professors, des Psychologen und LSD-Gurus Timothy Leary eingeladen. Er erhofft sich davon einen wichtigen Karriereschritt, merkt aber bald, dass Learys Ziele weniger medizinischer Natur sind; es geht dem Psychologen um eine Revolution des Bewusstseins und eine von sozialen Zwängen losgelöste Lebensform. Fitz wird mitgerissen von dieser Vision, mit Frau und Sohn schließt er sich der Leary-Truppe an: Sie leben in Mexiko, später in der berühmten Kommune in Millbrook, mit Drogen und sexuellen Ausschweifungen ohne Ende. Ein rauschhaftes Hörerlebnis - T.C. Boyle at his best.
Gelesen von Florian Lukas.
(1 mp3-CD, Laufzeit: 11h 28)

Von Ratten, Schlangen und Präsidenten: Im ausverkauften Schauspiel Frankfurt stellt T. C. Boyle seinen neuen Roman vor.
Von Florian Balke
Er hat einmal neben Donald Trump gesessen. In den neunziger Jahren war das, bei einer Buchvorstellung in Las Vegas. "Ich glaube, die Zuhörer mochten mich lieber", sagt T. C. Boyle. Wie in Vegas, so auch im restlos ausverkauften Schauspiel Frankfurt, wo der Schriftsteller auf Einladung des Literaturhauses seinen neuen Roman vorstellt. Für den amerikanischen Autor hat das Publikum ausgesprochen viel übrig, für den Präsidenten der Vereinigten Staaten gar nichts. Es giert nach Trump-Kritik wie die Fehlbesetzung im Weißen Haus nach Aufmerksamkeit.
Das passt zu einem Abend, der sich um Süchte dreht, von Boyles neuem Buch bis zu den Ratten, die er zu Hause im kalifornischen Montecito in Lebendfallen fängt und ein paar Meilen weiter in freier Wildbahn wieder aussetzt. Sie lieben die Kabel im BMW seiner Frau. Und die Erdnussbutter, die er als Lockstoff in den Fallen plaziert. Was amerikanische Ratten halt so mögen. Und es sind viele kleine Nagetiere, von deren Fang und Aussetzung Boyle auf Twitter berichtet. 158 habe er bislang gezählt, sagt Martin Scholz von der "Welt am Sonntag", dessen ebenfalls angekündigter Kollege Stefan Aust auf Recherchereise gehen musste und daher entschuldigt fehlt. Es seien weit mehr, entgegnet Boyle: "Ich erwarte die Ankunft von Nummer 205." Seine Tweets geben ihm die Möglichkeit, neben dem Skurrilen zahlreiche flüchtige Aspekte der Wirklichkeit festzuhalten: "Wir alle sehen es und gehen daran vorbei." Und das Suchtpotential der sozialen Medien? "Es gibt ja auch noch so etwas wie den Ausschaltknopf."
Um bewusstseinserweiternde Drogen geht es in Boyles Roman "Das Licht", der vor knapp zwei Wochen, wie zuvor schon andere Bücher des Autors, als Erstes auf Deutsch erschienen ist. In der englischsprachigen Welt kommt er unter dem Titel "Outside Looking In" erst im April heraus. Eine gute Begründung für die anhaltende Zuneigung seiner deutschen Leser ist Boyle am Abend vor dem Frankfurter Auftritt auch eingefallen: "Liebe." Was seine hierzulande besonders zahlreichen und treuen Anhänger betrifft, ist das nichts als die Wahrheit. Aber der humorvolle, zudem mit allen Wassern des Live-Auftritts gewaschene Autor lässt auch sonst keine Gelegenheit aus, seine Antworten durch gekonnte Zuspitzung so auf den Punkt zu bringen, dass das Publikum entweder lacht oder klatscht.
Warum also abermals ein Roman über Männer mit Mission, Besessenheit und Gefolgschaft? Nach Büchern über den Sexforscher Alfred Kinsey, den Architekten Frank Lloyd Wright und den Lebensreformer William Kellogg, dessen Bruder die Erdnussbutter für Boyles Ratten erfand, geht es nun um Timothy Leary, den Psychologieprofessor aus Harvard, der das Amerika der frühen sechziger Jahre mit der Einnahme von LSD bekanntmachte, zunächst als Arzneimittel zur Erleichterung der Psychotherapie. Boyle faszinieren solche Männer, deren Tätigkeit mitunter weitreichendere Folgen gehabt habe als die so manchen Generals mit Panzern. Er schiebt eine selbstbewusste Beobachtung nach: "Ich folge niemandem, ich führe selbst." Und gibt dem Gedanken noch einen weiteren Dreh: "Ich bin selbst ein Guru, aber ein guter." Womit das kurze Aufblitzen des Manipulativen, das in jeder Kunstgattung, vor allem aber in der literarischen Fiktion steckt, wieder im gutmütigen Selbstveräppeln geerdet ist.
Und wie war es für Boyle vor 50 Jahren in Woodstock? Um das Festival geht es an diesem Abend leichter Plauderei ein bisschen zu ausführlich. Der Autor antwortet artig, klingt auf diese Weise aber ein wenig nach Opa, der vom Krieg erzählt. Seine Karten hat er noch, den ersten Festivaltag verpassten er und seine Freunde, weil sie sich erst noch Drogen kaufen mussten, deswegen kamen sie trotz der vielen Staus auf den Zufahrtsstraßen schließlich doch noch aufs Gelände, wo das Schönste das Gemeinschaftserlebnis war: "Alle waren eines Sinnes." Würde er es wieder tun? "Ich wäre lieber Gefangener des ,Islamischen Staates'." Jetzt aber nochmal im Ernst - wie steht er heute zur damaligen Mischung aus Hedonismus und Protest? "Das Gute überwiegt das Schlechte."
Fast unbesprochen bleiben Freiheit, Schönheit, Macht, Verführung und Missbrauch im neuen Buch, dessen deutsche Passagen Christoph Pütthoff liest. Zu viel geht es um das Leben des 1948 in einer Kleinstadt bei New York geborenen Autors. Darum, dass er als junger Erwachsener selbst LSD genommen und kaum gute Erfahrungen damit gemacht hat, aber neugierig war und wissen wollte, ob der Ruf der Droge als Rauschmittel, das seine Konsumenten Gott schauen ließ, auf Wahrheit beruhte: "Ist Gott nur eine chemische Reaktion?" Schon lange lebt er bis auf Rotwein ohne jede stimulierende Substanz: "Mein Gehirn hängt am seidenen Faden, also schone ich es." Er selbst braucht nur noch Zeit allein in der Natur: "Dann bin ich nicht länger an die Erde gebunden, sondern auf einem Trip ganz eigener Art."
Die Drogenepidemie jedoch, die sich seit einigen Jahren rund um fahrlässig verschriebene Schmerzmittel bis ins ländliche Amerika ausgebreitet hat und Bürger trifft, die nie Erfahrungen mit Drogen machen wollten, führt Boyle auf die Hoffnungslosigkeit zurück, die der Niedergang traditioneller Berufe und Arbeitsmodelle mit sich bringe. Gerade hat er im "New Yorker" eine Kurzgeschichte über selbstfahrende Kraftfahrzeuge veröffentlicht. Viel hält er nicht von ihnen. Nicht nur der amerikanische Mensch brauche das protestantische Arbeitsethos und das Gefühl, etwas herstellen, tun und bewirken zu können: "Wenn man mir heute Abend sagte, ich dürfte nicht mehr schreiben, wäre ich in zwei Wochen Junkie." Im Schauspiel darf er nach der Lesung zumindest fast zwei Stunden lang signieren. Die Schlange reicht vom Chagallsaal bis in die Tiefen der Panorama-Bar. Und in Zukunft? Wenn Trump nicht mehr Präsident ist und sein nächstes Buch auf der Frankfurter Buchmesse vorstellt? "Das ist unmöglich. Dann sitzt er im Gefängnis."
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Tolle Idee, einen Roman über Timothy Leary und seine Psychonauten zu schreiben, findet Rezensent Christoph Schröder. Der Harvard-Psychologe war die wissenschaftliche Instanz, die den radikalen Individualismus der Hippies nobilitierte. Allerdings wurde er mit seinen um sich gescharten Jüngern bald von der Universität und nach Mexiko vertrieben. Boyle erzählt die Geschichte aus der Sicht eines jungen Leary-Mitarbeiters, Fitz Loney, der mit seiner Frau seinem Guru durch sämtliche Höhen und Tiefen folgt. Dass der verheißungsvolle Trip am Ende in große Ernüchterung mündet, hat der Rezensent erwartet. Aber dass Boyle für seine spannende Geschichte, für all die Rauschzustände und Entgrenzungserfahrungen eine so konventionelle, ja geradezu brave Form findet, erstaunt ihn schon. Etwas "mehr experimentelle Fantasie" hätte dem Roman nicht geschadet, meint Schröder.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein intelligenter, unterhaltender Roman über den Versuch aus Pillen eine Religion zu machen." Denis Scheck, Tagesspiegel am Sonntag, 17.03.19 "Diese Geschichte schiebt sich unglaublich gut hin- und her zwischen Fakten und Fiktionen." Christine Westerman, Literarisches Quartett, 04.03.19 "Ein rauschhafter, nebenwirkungsfreier Roman über eine Generation, die die Freiheit sucht und dabei einer Lüge aufsitzt. In 'Das Licht' vermischt Boyle gekonnt Wahrheit und Fiktion, um den Guru der Hippie Bewegung Timothy Leary." Roana Brogsitter, Bayrischer Rundfunk, 30.01.19 "In der Beschreibung des vielfältigen Verlangens, aus dem Elend ans Licht zu kommen, ist Boyle (und mit ihm sein Übersetzer Dirk van Gunsteren) in allerberster Form. ... Wie die jungen Vorstadtpaare entgleisen, sich voneinander entfremden und in ihren je eigenen Orbits kreisen, darin leuchtet der farbechte, seelenbeglaubigte, sprachlich spielerische Realismus, für den man Boyle liebt." Petra Kohse, Frankfurter Rundschau,02.02.19 "T.C. Boyle findet mit Timothy Learys Drogenkreis einen Romanstoff, der wie für ihn geschaffen ist. ... Ein gutgeglückter Boyle. Sehr geglückt sogar." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.01.19 "Wie schon in anderen Büchern mixt T.C. Boyle aus Suchenenden, Außenseitern und visionären Persönlichkeiten, aus Sex, Rausch und Gruppenexperimenten einen historischen Roman. Und wieder einmal wirft er darin Fragen auf, die wir uns bis heute stellen: Führt jeder Versuch, die Welt zu verbessern ins Chaos? Brauchen auch intelligente Menschen Führerfiguren? ... 'Das Licht' beleuchtet diese Fragen: grell, bunt, schillernd, sarkastisch und intelligent." Carsten Hueck, Deutschlandfunk Kultur, 30.01.19 "Eine fantastische Erzählung über unsere Zeit, unsere Träume, Lebenslügen und Irrtümer." Gerhard Matzig, Süddeutsche Zeitung, 28.01.19 "Ein knallbuntes und zugleich nuanciertes Buch, direkt erzählt, vergnüglich und gut recherchiert." Martina Läubli, NZZ am Sonntag, 27.01.19 "Eine psychedelische Gottessuche. ... Ein Roman ... über einen charismatischen Verführer, die Gefahren psychologischer Herumpfuscherei, das Platzen von sozialen Aufstiegswünschen." Erich Demmer, Die Presse, 26.01.19