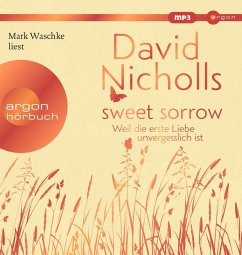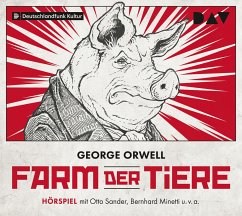Nicht lieferbar

Das Ministerium des äußersten Glücks
901 Min.. Lesung. Ungekürzte Ausgabe
Übersetzung: Grube, Anette;Gesprochen: Blum, Gabriele
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Auf einem Friedhof in der Altstadt von Delhi wird ein handgeknüpfter Teppich ausgerollt. Auf einem Bürgersteig taucht plötzlich ein Baby auf. In einem verschneiten Tal schreibt ein Vater einen Brief an seine 5-jährige Tochter über die vielen Menschen, die zu ihrer Beerdigung kamen. In einem Zimmer im 2. Stock liest eine einsame Frau die Notizbücher ihres Geliebten. Im Jannat Guest House umarmen sich im Schlaf zwei Menschen, als ob sie sich eben erst getroffen hätten - aber sie kennen sich schon ein Leben lang.Voller Inspiration, Gefühl und Überraschungen beweist der Roman in jedem Mom...
Auf einem Friedhof in der Altstadt von Delhi wird ein handgeknüpfter Teppich ausgerollt. Auf einem Bürgersteig taucht plötzlich ein Baby auf. In einem verschneiten Tal schreibt ein Vater einen Brief an seine 5-jährige Tochter über die vielen Menschen, die zu ihrer Beerdigung kamen. In einem Zimmer im 2. Stock liest eine einsame Frau die Notizbücher ihres Geliebten. Im Jannat Guest House umarmen sich im Schlaf zwei Menschen, als ob sie sich eben erst getroffen hätten - aber sie kennen sich schon ein Leben lang.
Voller Inspiration, Gefühl und Überraschungen beweist der Roman in jedem Moment Arundhati Roys Kunst. Ihre Helden werden von der Welt zerbrochen, aber durch die Liebe geheilt. Und so werden sie unbezwingbar.
Voller Inspiration, Gefühl und Überraschungen beweist der Roman in jedem Moment Arundhati Roys Kunst. Ihre Helden werden von der Welt zerbrochen, aber durch die Liebe geheilt. Und so werden sie unbezwingbar.