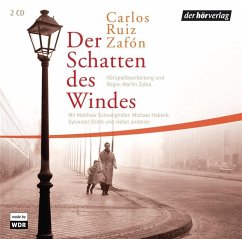Carlos Ruiz Zafón
Audio-CD
Das Spiel des Engels / Barcelona Bd.2 (9 Audio-CDs)
Autorisierte Lesefassung. Ungekürzte Ausgabe. 611 Min.
Übersetzung: Schwaar, Peter;Gesprochen: Wameling, Gerd
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:




Der junge David Martín fristet sein Leben als Autor von Schauergeschichten. Als ernsthafter Schriftsteller verkannt, von einer tödlichen Krankheit bedroht und um die Liebe seines Lebens betrogen, scheinen seine großen Erwartungen sich in nichts aufzulösen. Doch einer glaubt an sein Talent: Der mysteriöse Verleger Andreas Corelli macht ihm ein Angebot, das Verheißung und Versuchung zugleich ist... Carlos Ruiz Zafón entführt uns in ein unheimliches, fantastisches Barcelona vor dem Bürgerkrieg: ein Labyrinth voller Geheimnisse, in dessen Zentrum die Magie der Bücher und eine unerfüllte...
Der junge David Martín fristet sein Leben als Autor von Schauergeschichten. Als ernsthafter Schriftsteller verkannt, von einer tödlichen Krankheit bedroht und um die Liebe seines Lebens betrogen, scheinen seine großen Erwartungen sich in nichts aufzulösen. Doch einer glaubt an sein Talent: Der mysteriöse Verleger Andreas Corelli macht ihm ein Angebot, das Verheißung und Versuchung zugleich ist... Carlos Ruiz Zafón entführt uns in ein unheimliches, fantastisches Barcelona vor dem Bürgerkrieg: ein Labyrinth voller Geheimnisse, in dessen Zentrum die Magie der Bücher und eine unerfüllte Liebe stehen.
Ruiz Zafón, Carlos
Carlos Ruiz Zafón begeistert mit seinen Barcelona-Romanen um den Friedhof der Vergessenen Bücher - "Der Schatten des Windes", "Das Spiel des Engels" und "Der Gefangene des Himmels" - ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Auch "Marina", der Roman, den er kurz vor den großen Barcelona-Romanen schuf, stand wochenlang auf den Bestsellerlisten. Seine ersten Erfolge feierte Zafón mit den drei phantastischen Schauerromanen "Der Fürst des Nebels", "Mitternachtspalast" und "Der dunkle Wächter". Carlos Ruiz Zafón wurde 1964 in Barcelona geboren und lebt heute in Los Angeles.
Schwaar, Peter
Peter Schwaar wurde 1947 in Zürich geboren, Studium der Germanistik in Zürich und Berlin, Redakteur beim Zürcher »Tagesanzeiger«, seit 1987 freier Journalist und Übersetzer (Eduardo Mendoza, Juan José Millás, Javier Tomeo, Adolfo Bioy Casares, Álvaro Mutis, Tomás Eloy Martinéz, David Trueba u.a.). Er lebt in Barcelona.
Wameling, Gerd
Gerd Wameling spielt neben seiner Theaterkarriere in diversen Fernseh- und Kinoproduktionen und ist einer der beliebtesten und bekanntesten deutschen Hörbuchsprecher.
Carlos Ruiz Zafón begeistert mit seinen Barcelona-Romanen um den Friedhof der Vergessenen Bücher - "Der Schatten des Windes", "Das Spiel des Engels" und "Der Gefangene des Himmels" - ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Auch "Marina", der Roman, den er kurz vor den großen Barcelona-Romanen schuf, stand wochenlang auf den Bestsellerlisten. Seine ersten Erfolge feierte Zafón mit den drei phantastischen Schauerromanen "Der Fürst des Nebels", "Mitternachtspalast" und "Der dunkle Wächter". Carlos Ruiz Zafón wurde 1964 in Barcelona geboren und lebt heute in Los Angeles.
Schwaar, Peter
Peter Schwaar wurde 1947 in Zürich geboren, Studium der Germanistik in Zürich und Berlin, Redakteur beim Zürcher »Tagesanzeiger«, seit 1987 freier Journalist und Übersetzer (Eduardo Mendoza, Juan José Millás, Javier Tomeo, Adolfo Bioy Casares, Álvaro Mutis, Tomás Eloy Martinéz, David Trueba u.a.). Er lebt in Barcelona.
Wameling, Gerd
Gerd Wameling spielt neben seiner Theaterkarriere in diversen Fernseh- und Kinoproduktionen und ist einer der beliebtesten und bekanntesten deutschen Hörbuchsprecher.

© Douglas Kirkland/Suhrkamp Verlag
Produktdetails
- Verlag: Argon Verlag
- Originaltitel: El juego del angel
- Gesamtlaufzeit: 611 Min.
- Erscheinungstermin: 5. November 2008
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783866106062
- Artikelnr.: 25006023
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Ich fieberte dem Erscheinen des Buches förmlich entgegen, man versinkt sofort in den Tiefen des Romans und möchte nur noch lesen. Der Schreibstil ist einmalig und die Geschichte wieder mal spannend, mystisch und ungewöhnlich. Ein erstklassiges Lesevergnügen.
Antworten 14 von 16 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 14 von 16 finden diese Rezension hilfreich
Ein typischer Zafón - und doch ganz anders, zumindest wenn man von 'Der Schatten des Windes' ausgeht.
Nach einer unglückseligen Jugend darf der 17jährige David Martin, dessen Leidenschaft das Schreiben ist, seine ersten Geschichten in einer Zeitung veröffentlichen. Er hat …
Mehr
Ein typischer Zafón - und doch ganz anders, zumindest wenn man von 'Der Schatten des Windes' ausgeht.
Nach einer unglückseligen Jugend darf der 17jährige David Martin, dessen Leidenschaft das Schreiben ist, seine ersten Geschichten in einer Zeitung veröffentlichen. Er hat Erfolg, doch durch Neid und Mißgunst von Kollegen verliert er seine Stelle. Sein Freund und Förderer Vidal vermittelt ihn an zwei ausbeuterische Verleger, für die er eine neue Serie anspruchsloser Geschichten schreibt - diese ist bald ebenfalls sehr erfolgreich. Er mietet sich im Haus seiner Träume eine Wohnung, doch glücklich wird David dennoch nicht, denn er ist unglücklich verliebt ohne Aussicht dass dieser Zustand sich ändert. Auch das Schreiben befriedigt ihn nicht und als ein mysteriöser Verleger ihm für eine immense Summe einen Auftrag für ein Buch erteilt, nimmt er diesen an.
Damit nimmt das Verhängnis seinen Lauf: Dieser Auftrag und der auf merkwürdige Weise verstorbene Vorbesitzer seiner Wohnung scheinen miteinander in Zusammenhang zu stehen. David beginnt nachzuforschen und wird in ein verworrenes Komplott verstrickt, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint.
Zafóns Sprache ist unverkennbar: bilderreiche Beschreibungen, eine Wortvielfalt die ihresgleichen sucht. Doch im Vergleich zu 'Der Schatten des Windes' fehlen die Geschehnisse und Erzählungen, die Ausführungen und Anekdoten zu allem und jedem, die zeitweise beinahe märchenhaft anmuteten. Stattdessen gibt es eine durchgängige Geschichte, die an Düsternis und Trostlosigkeit fast nicht zu überbieten ist. Kaum ist dem Protagonisten etwas Glück hold, trifft ihn bereits der nächste Schicksalsschlag. Und Zafón handelt diesmal auch , zumindest ansatzweise, eine der großen Fragen der Menschheit ab: Was ist Religion, wie entsteht der Glaube an Gott? Keine Angst, auch für Atheisten ist dies durchaus lesenswert. Zudem nimmt dieser Teil nur einen kleinen (zu kleinen?) Raum des Buches ein. Ich persönlich hätte gerne mehr darüber gelesen.
Fazit: Wieder sehr gute Unterhaltung, diesmal sogar mit etwas Tiefgang :-), wenn auch insgesamt die düstere Stimmung fast etwas überhand nimmt.
Weniger
Antworten 14 von 16 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 14 von 16 finden diese Rezension hilfreich
Das Spiel des Engels - C. Ruiz Zafon
Immer besser gefällt mir die gruselige Art und Weise mit der Zafon die Leser fesselt und langumwobende Geheimnisse in seinen dicken Büchern lüftet.
Ganz besonders in "Spiel des Engels", das mich vom Anfang bis zur letzten Seite fesselt, …
Mehr
Das Spiel des Engels - C. Ruiz Zafon
Immer besser gefällt mir die gruselige Art und Weise mit der Zafon die Leser fesselt und langumwobende Geheimnisse in seinen dicken Büchern lüftet.
Ganz besonders in "Spiel des Engels", das mich vom Anfang bis zur letzten Seite fesselt, und ich fast gar traurig bin, als die letzte Seite verschlungen.
Sagenhaft wie dieses geheimnisvolle Haus mit dem Turm aus "Schatten des Windes" wieder auftaucht, ein gewisser A. Corelli, der seine Fäden spinnt, unheimlich, um tausende Ecken treibt er sein Spiel, als Teufel holt er sich die Seelen der anderen, der beste Gruselkrimi den ich je gelesen, am Stück, bis ich nur noch Buchstaben sah, die vielen verschiedenen Personen, und zu guter letzt das große Feuer!!
Wie das fantastischte Puzzle, das ich je gelegt, und dann erschrecke als es fertig ist: am Resultat.
Für mich das beste von 4 die ich von Zafon gelesen habe, sagenhaft zieht es einen in den Bann und man ist mittendrin statt nur dabei! Die eigenen Phantasie wird dermaßen angekurbelt, dass es fast an fürhkindliche Erfahrungen erinnert.
Bitte lieber Zafon, schreibe unbedingt nochmal so ein wahnsinns Buch, und dann mit 966 Seiten!
Weniger
Antworten 12 von 13 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 12 von 13 finden diese Rezension hilfreich
Ich kann die Begeisterung leider nicht teilen. "Das Spiel des Engels" erreicht meiner Meinung nach bei weitem nicht das Niveau des Vorgängerromans "Der Schatten des Windes". Zu oft erscheinen Passagen einfach heruntergeschrieben, Szenerien platt und klischeehaft, auch die …
Mehr
Ich kann die Begeisterung leider nicht teilen. "Das Spiel des Engels" erreicht meiner Meinung nach bei weitem nicht das Niveau des Vorgängerromans "Der Schatten des Windes". Zu oft erscheinen Passagen einfach heruntergeschrieben, Szenerien platt und klischeehaft, auch die ständige Wiederholung eines "blutroten Himmels" und "schwarzer Wolken", die ständig über Barcelone schweben, langweilt den Leser irgendwann gewaltig. Das erinnert mehr an das Drehbuch eines düsteren Psycho-Trillers. Die Dialoge in ihrer Originalität fallen aus dieser Grundstimmung völlig heraus, sie sind in sich sehr meisterhaft gestrickt, aber passen sich schwer in die Umgebung ein und wirken hineingeproft. Die Handlung selbst ist zwar eine spannende Geschichte, aber bleiben am Ende so viele Fragen offen, daß eine "Moral der Geschicht" schwer zufinden ist. Am Ende ist man als Leser verwirrt, man hat sich ordentlich gegruselt an den Gruselstellen, man hat gelächelt bei den Dialogen, man hat dem Ende entgegengefiebert. Aber alle Mechanismen erscheinen zu sehr vom Autor berechnet, als daß man sich als Leser nicht manipuliert vorkäme - und zwar nicht in einer wohligen, angenehmen und intelligenten Weise, sondern in einer billigen und abgedroschenen. Auf mich wirkt dieses neue Buch von Carlos Ruiz Zafon wie ein Stück- und Flickwerk, dem man die Drehbuch-Vergangenheit des Autors zu sehr anmerkt, auch vermutet man bald, der Autor habe - beabsichtigt oder unbeabsichtigt - wie sein Protagonist David Martin einen schnellen Schundroman heruntergeschrieben, bei dem es nicht auf Qualität, sondern auf Verkaufszahlen ankommt. Sehr, sehr schade, ich hatte mich auf diesen Neuling von Carlos Ruiz Zafon gefreut, jetzt ärgere ich mich, daß ich so viel Geld für die gebundene Ausgabe bezahlt habe. Ein gebundenes Buch, das man nach dem Lesen nicht in den Bücherschrank stellen mag, stimmt traurig.
Weniger
Antworten 8 von 10 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 8 von 10 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Dies ist der zweite Roman der Trilogie von Carlos Ruiz Zafon. In diesem Teil geht es um den 17jährigen David Martin. Nach seiner unglücklichen Jugend entdeckt er die Leidenschaft für das Schreiben. Er hat das Glück, seine ersten Artikel in einer Zeitung zu veröffentlichen …
Mehr
Dies ist der zweite Roman der Trilogie von Carlos Ruiz Zafon. In diesem Teil geht es um den 17jährigen David Martin. Nach seiner unglücklichen Jugend entdeckt er die Leidenschaft für das Schreiben. Er hat das Glück, seine ersten Artikel in einer Zeitung zu veröffentlichen und erhält dafür viel Lob von anderen. Dies jedoch ruft bei einigen Kollegen Neid und Missgunst hervor. Zu dieser Zeit lernt er seinen späteren Förderer Vidal kennen und dieser vermittelt ihn an zwei Verleger, die ihn ausbeuten. Er kommt nicht mehr aus der Wohnung, er muss nur noch arbeiten. Auch mit diesen nicht so anspruchsvollen Geschichten ist er sehr erfolgreich. Martin schreibt die Geschichten unter falschen Namen. Durch seinen Erfolg kann er sich jetzt den Traum von einer eigenen Wohnung erfüllen. Auch das Schreiben der vielen Geschichten befriedigt ihn nicht und dann taucht ein mysteriöser Verleger auf. Dieser bietet ihm sehr viel Geld an, wenn er für ihn ein Buch schreibt. Damit beginnt der Verlauf von verworrenen Geschehnissen. Es scheinen der Verleger und der Vorbesitzer seiner Wohnung in Zusammenhang zu stehen.<br />Das Buch beginnt sehr gut. Und auch den Schreibstil von Zafon mag ich, jedoch hat mich der zweite Teil nicht so überzeugt. Die Geschehnisse zum Ende hin finde ich zu verworren.
Weniger
Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Ich würde gerne eine kurze Inhaltsangabe zu diesem Buch geben - aber ich kann es nicht ... obwohl ich das Buch gelesen habe.
Der Inhalt ist so verwirrend, dass ich tatsächlich keine Ahnung habe, worum es eigentlich ging. Da ist der junge Schriftsteller, aus dessem langweiligen Leben …
Mehr
Ich würde gerne eine kurze Inhaltsangabe zu diesem Buch geben - aber ich kann es nicht ... obwohl ich das Buch gelesen habe.
Der Inhalt ist so verwirrend, dass ich tatsächlich keine Ahnung habe, worum es eigentlich ging. Da ist der junge Schriftsteller, aus dessem langweiligen Leben erzählt wird. Aber ansonsten: Es taucht dieser mysteriöse Verleger auf. Was es genau mit ihm auf sich hat, wird nicht näher erläutert. Eine unglückliche Liebesgeschichte wird angedeutet, die vollkommen verwirrend ist. Es gibt eine mysteriöse Bibliothek - auf die auch nicht näher eingegangen wird ... Todkranke sind von einem Tag auf den anderen geheilt, andere sterben ...
Ich habe mich durch das Buch gequält. Ich habe mich gezwungen, es zu lesen, weil ich dachte, es muss doch einen Grund haben, dass dieser Mann Bestseller-Autor ist, und weil ich immer auf der Suche war nach irgendwelchen Erklärungen, nach einer Auflösung ... Aber es gibt keine. Es gibt auch keinen tieferen Sinn im Buch, es gibt nichts zum Nachdenken.
Schade um die wertvollen Rohstoffe, die für dieses Werk verschwendet wurden. Ich würde statt Sternen zu verteilen gerne welche abziehen, denn selbst mit einem Stern ist das Buch vollkommen überbewertet.
Weniger
Antworten 4 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Es ist einfach wahnsinn. Ich habe das Buch gerade erst fertig gelesen und kann das nächste Buch von Carlos Ruiz Zafon kaum abwarten. Ursprünglich hatte ich es mir gekauft, da ich das erste Buch von ihm sehr gut fand und hoffte, dieses würde genau so gut oder besser werden. Beim Kauf …
Mehr
Es ist einfach wahnsinn. Ich habe das Buch gerade erst fertig gelesen und kann das nächste Buch von Carlos Ruiz Zafon kaum abwarten. Ursprünglich hatte ich es mir gekauft, da ich das erste Buch von ihm sehr gut fand und hoffte, dieses würde genau so gut oder besser werden. Beim Kauf spielte der Titel und die Handlung eine untergeordnete Rolle. MIr ging es eigentlich eher um den Autor. Aber ich muss sagen, mit diesem Buch hat er das letzte - und vor allem auch meine Erwartungen - um Meilen übertroffen. Selten habe ich ein Buch mit einem solchen Spannungsbogen gelesen. Ich bin jetzt noch total euphorisch und auch etwas enttäuscht, dass ich schon durch bin.
Das Buch handelt eigentlich von der Lebensgeschichte eines Jungen und dessen steinigem Weg zum erfolgreichen Schriftsteller. Allein diese Geschichte finde ich nicht uninteressant, da der Junge sehr begabt ist und auch einen Gönner hat, der ihn untestützt. Insgesamt sind hier drei unterschiedliche Handlungen in einem Buch zusammen gefasst, oder besser gesagt ineinander verwoben. Aber keine Angst: Es ist kein bisschen verwirrend! Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, die Zafon aus meiner Sicht mit Bravur gemeistert hat.
Insgesamt ist das Buch in Drei große Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel war für mich schon sehr interssant und ich wollte das Buch nicht mehr weg legen. Im zweiten Kapitel wurde das Weglegen noch schwieriger, da mich das Buch bereits komplett in seinen Bann gezogen hatte. Aber das dritte Kapitel übertraf alles. Ich habe das dritte Kapitel in einer Nacht durchgelesen. Ich hatte das Gefühl ich bin in das Buch geschlüpft und folge der Hauptperson auf Schritt und Tritt. Selten habe ich so etwas erlebt. Ich habe die Handlung und alle Gefühle mit der Hauptperson geteilet.
Eigentlich kann ich das ganze nicht richtig in Worte fassen. Ich werde das Buch auf jeden Fall weiter empfehlen und bestimmt auch manchen Leuten aufschwatzen, da ich so davon begeistert bin!
Also....kaufen und lesen....
Weniger
Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Ein Leben zwischen Traum, Magie und Wirklichkeit
In diesem Roman erfahren kundige Leser die Vorgeschichte von Isabella Gispert, also Daniel Semperes Mutter und von David Martin, Protagonist aus „Der Gefangene des Himmels“. Zentraler Ruhepunkt in der an Aktionen reichen Geschichte ist …
Mehr
Ein Leben zwischen Traum, Magie und Wirklichkeit
In diesem Roman erfahren kundige Leser die Vorgeschichte von Isabella Gispert, also Daniel Semperes Mutter und von David Martin, Protagonist aus „Der Gefangene des Himmels“. Zentraler Ruhepunkt in der an Aktionen reichen Geschichte ist der Buchladen Sempere. Inhaber ist der Opa von Daniel Sempere; Daniels Vater ist zu dieser Zeit noch ein junger Mann. Auch der magische „Friedhof der vergessenen Bücher“ spielt wieder eine Rolle.
Isabella ist ein forsches intelligentes Mädchen mit markanten Charakterzügen und damit die schillernde Gestalt dieses Romans. Hauptakteur ist zweifelsohne der Schriftsteller David Martin. David verkuppelt Isabella mit Sempere junior. Bei dieser Aktion zeigt er Charme und Humor, wie in den anderen Büchern dieser Reihe Fermin. Er selbst ist in Christina, der Tochter des Fahrers seines Freundes Pedro Vidal, ebenfalls Schriftsteller, verliebt.
David Martin macht einen existenziellen Reifungsprozess durch. Von einem sympathischen jungen Mann entwickelt er sich hin zu einem Antihelden. Schuld ist Andreas Corelli, der ihm den Auftrag erteilt, ein geheimnisvolles religiöses Buch (über dessen Inhalt nichts verraten wird) zu schreiben. Die Verbindung zu Corelli gleicht einem Pakt mit dem Teufel. Hier gleitet der Roman über ins Fantastische.
Während der ersten zweihundert Seiten ahnt der Leser noch nicht, wie sich die Geschichte entwickeln wird. Der Roman ist spannend. „Das Spiel des Engels“ ist auch ein magischer Krimi mit vielen Toten. David Martins Wege und Entscheidungen sind schicksalhaft. Realität und Traumwelt vermischen sich. Der Leser wird verwirrt, aber die losen Fäden werden nicht sauber zusammengeführt. Dies ist die größte Schwäche des recht komplexen Romans. Er ist mysteriös und unterhaltsam, aber auch rätselhaft, ohne dass diese Rätsel abschließend gelöst werden. „Das Spiel des Engels“ ist nicht vergleichbar mit den perfekt konstruierten Romanen eines Leo Perutz. Es bleiben zu viele Fragen offen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
MP3-CD
Als Hörbuch keine Empfehlung
Mittlerweile habe ich alle Bände vom „Friedhof der vergessenen Bücher“ gelesen bzw. gehört. „Das Spiel des Engels“ ist m.E. der schwächste Band der Reihe. Leider ist er zum Verständnis der weiteren Handlung …
Mehr
Als Hörbuch keine Empfehlung
Mittlerweile habe ich alle Bände vom „Friedhof der vergessenen Bücher“ gelesen bzw. gehört. „Das Spiel des Engels“ ist m.E. der schwächste Band der Reihe. Leider ist er zum Verständnis der weiteren Handlung notwendig, so dass man ihn eigentlich nicht auslassen kann. Inhaltlich liest es sich wie das Werk eines anderen Autors, es fehlen fast gänzlich der Charme und der Humor der anderen Bände der Reihe.
Ich habe es als Hörbuch gehört, was ich aber niemandem empfehlen kann. Zwischen dem fantastischen Erzähler von Band 1 und 4 (Uve Teschner) und dem Sprecher hier (Gerd Wameling) liegen Welten. Er spricht zwar klar und deutlich, aber fast immer mit der gleichen Betonung und der gleichen Satzmelodie. Das ist durchweg anstrengend und keine Freude beim Anhören. Auch ist dieses Hörbuch leider nur eine gekürzte Lesung, keine Ahnung in welchem Umfang hier Teile des Buches dem Hörer vorenthalten werden. Es ist mir unverständlich, wie man gerade bei einem solchen Roman, der nicht nur von der Handlung und den Fakten, sondern eher von der Stimmung und dem ganzen Drumherum lebt, Kürzungen vornehmen kann.
Dennoch lohnt es sich, durchzuhalten, denn Band 3 und 4 sind wieder auf dem Niveau von „Der Schatten des Windes“. Im Nachhinein hätte ich Band 2 jedoch lieber als ganz normales Buch gelesen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Nach dem Bestseller "Der Schatten des Windes" hat man sehr hohe Erwartungen an das neue Werk von Carlos Ruiz Zafón, die aber schon nach den ersten Seiten erfüllt werden. Es ist sehr spannend und nimmt einen mit in eine vergangene Zeit zu misteriösen Orten und Begegnungen …
Mehr
Nach dem Bestseller "Der Schatten des Windes" hat man sehr hohe Erwartungen an das neue Werk von Carlos Ruiz Zafón, die aber schon nach den ersten Seiten erfüllt werden. Es ist sehr spannend und nimmt einen mit in eine vergangene Zeit zu misteriösen Orten und Begegnungen mit Personen, von denen man sich im nach hinein nicht mal mehr sicher ist, ob sie für den Protagonisten real oder fiktion waren. Am Ende gibt es eine Überraschung, mit der ich beim besten Willen nicht gerechnet habe, die Zafón die ein oder andere offene Frage und das teilweise Fehlen eines roten Fadens verzeiht. Zafón überzeugt wie schon in "Der Schatten des Windes" mit einer Sprache, die bewusst Empfindungen trifft und man das, was er vermitteln will förmlich in sich aufsaugen kann.
"Das Spiel des Engels" ziehlt nicht darauf ab, den "Schatten des Windes" zu übertrumpfen, sondern bringt den Leser zurück zu der Stelle, an der er den "Schatten des Windes" erneut beginnen könnte.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote