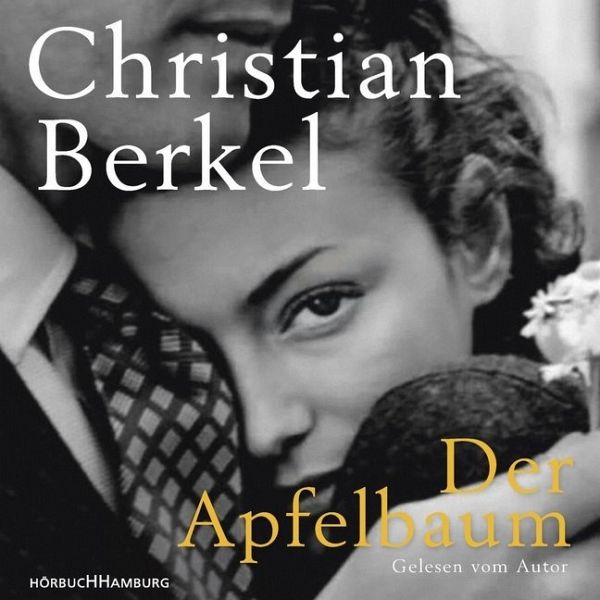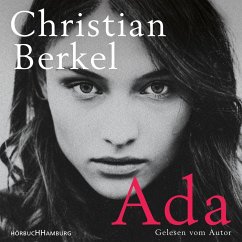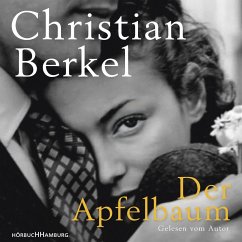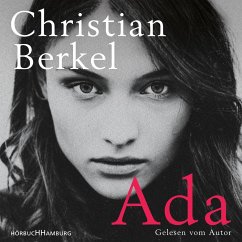Christian Berkel
Audio-CD
Der Apfelbaum
10 CDs. 736 Min.. CD Standard Audio Format.Lesung.Ungekürzte Ausgabe
Gesprochen: Berkel, Christian
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





»Jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen. Dann erfand ich sie neu.«Für den Roman seiner Familie hat der Schauspieler Christian Berkel seinen Wurzeln nachgespürt. Er hat Archive besucht, Briefwechsel gelesen und Reisen unternommen. Entstanden ist ein großer Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte, die Erzählung einer ungewöhnlichen Liebe.»Wenn wieder einmal jemand fragt, wo es denn bleibt, das lebensgesättigte, große Epos über deutsche Geschichte, dann ist von jetzt an die Antwort: Hier ist es, Christian Berkel hat es geschrieben...
»Jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen. Dann erfand ich sie neu.«
Für den Roman seiner Familie hat der Schauspieler Christian Berkel seinen Wurzeln nachgespürt. Er hat Archive besucht, Briefwechsel gelesen und Reisen unternommen. Entstanden ist ein großer Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte, die Erzählung einer ungewöhnlichen Liebe.
»Wenn wieder einmal jemand fragt, wo es denn bleibt, das lebensgesättigte, große Epos über deutsche Geschichte, dann ist von jetzt an die Antwort: Hier ist es, Christian Berkel hat es geschrieben. Dieser Mann ist kein schreibender Schauspieler. Er ist Schriftsteller durch und durch. Und was für einer.« Daniel Kehlmann
Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben. Er stammt aus der Arbeiterklasse, sie aus einer intellektuellen jüdischen Familie. 1938 muss Sala ihre deutsche Heimat verlassen, kommt bei ihrer jüdischen Tante in Paris unter, bis die Deutschen in Frankreich einmarschieren. Während Otto als Sanitätsarzt mit der Wehrmacht in den Krieg zieht, wird Sala bei einem Fluchtversuch verraten und in einem Lager in den Pyrenäen interniert. Dort stirbt man schnell an Hunger oder Seuchen, wer bis 1943 überlebt, wird nach Auschwitz deportiert. Sala hat Glück, sie wird in einen Zug nach Leipzig gesetzt und taucht unter. Kurz vor Kriegsende gerät Otto in russische Gefangenschaft, aus der er 1950 in das zerstörte Berlin zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit dem Frieden eine Odyssee, die sie bis nach Buenos Aires führt. Dort versucht sie, sich ein neues Leben aufzubauen, scheitert und kehrt zurück. Zehn Jahre lang haben sie einander nicht gesehen. Aber als Sala Ottos Namen im Telefonbuch sieht, weiß sie, dass sie ihn nie vergessen hat.
Mit großer Eleganz erzählt Christian Berkel den spannungsreichen Roman seiner Familie. Er führt über drei Generationen von Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau bis nach Buenos Aires. Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch ihr Leben lang nicht voneinander lassen.
Für den Roman seiner Familie hat der Schauspieler Christian Berkel seinen Wurzeln nachgespürt. Er hat Archive besucht, Briefwechsel gelesen und Reisen unternommen. Entstanden ist ein großer Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte, die Erzählung einer ungewöhnlichen Liebe.
»Wenn wieder einmal jemand fragt, wo es denn bleibt, das lebensgesättigte, große Epos über deutsche Geschichte, dann ist von jetzt an die Antwort: Hier ist es, Christian Berkel hat es geschrieben. Dieser Mann ist kein schreibender Schauspieler. Er ist Schriftsteller durch und durch. Und was für einer.« Daniel Kehlmann
Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben. Er stammt aus der Arbeiterklasse, sie aus einer intellektuellen jüdischen Familie. 1938 muss Sala ihre deutsche Heimat verlassen, kommt bei ihrer jüdischen Tante in Paris unter, bis die Deutschen in Frankreich einmarschieren. Während Otto als Sanitätsarzt mit der Wehrmacht in den Krieg zieht, wird Sala bei einem Fluchtversuch verraten und in einem Lager in den Pyrenäen interniert. Dort stirbt man schnell an Hunger oder Seuchen, wer bis 1943 überlebt, wird nach Auschwitz deportiert. Sala hat Glück, sie wird in einen Zug nach Leipzig gesetzt und taucht unter. Kurz vor Kriegsende gerät Otto in russische Gefangenschaft, aus der er 1950 in das zerstörte Berlin zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit dem Frieden eine Odyssee, die sie bis nach Buenos Aires führt. Dort versucht sie, sich ein neues Leben aufzubauen, scheitert und kehrt zurück. Zehn Jahre lang haben sie einander nicht gesehen. Aber als Sala Ottos Namen im Telefonbuch sieht, weiß sie, dass sie ihn nie vergessen hat.
Mit großer Eleganz erzählt Christian Berkel den spannungsreichen Roman seiner Familie. Er führt über drei Generationen von Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau bis nach Buenos Aires. Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch ihr Leben lang nicht voneinander lassen.
Christian Berkel, 1957 in West-Berlin geboren, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Er war an zahlreichen europäischen Filmproduktionen sowie an Hollywood-Blockbustern beteiligt und wurde u. a. mit dem Bambi, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Für seine Hörbuch-Interpretation von Daniel Glattauers Roman »Gut gegen Nordwind« wurde ihm zusammen mit Andrea Sawatzki die Goldene Schallplatte verliehen. 2020 erhielt er den Deutschen Hörbuchpreis. Auch als Autor ist Christian Berkel erfolgreich. Seine Romane »Der Apfelbaum« und »Ada« wurden Bestseller.
Produktdetails
- Verlag: Hörbuch Hamburg
- Gesamtlaufzeit: 736 Min.
- Erscheinungstermin: 8. Oktober 2018
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783957131362
- Artikelnr.: 53342366
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
"... eine dramatische Liebes- und Familiengeschichte, hervorragend erzählt." Melanie Mühl Frankfurter Allgemeine Zeitung 20181124
Mehr als ein ganzes Leben - Christian Berkel ist ein toller Schauspieler mit einer angenehmen Stimme und – das weiß ich nach seinem Buch – ein großartiger Schriftsteller.
Ich habe mich für das Hörbuch entschieden, weil der Autor die Geschichte seiner …
Mehr
Mehr als ein ganzes Leben - Christian Berkel ist ein toller Schauspieler mit einer angenehmen Stimme und – das weiß ich nach seinem Buch – ein großartiger Schriftsteller.
Ich habe mich für das Hörbuch entschieden, weil der Autor die Geschichte seiner Familie selbst liest. Das war eine gute Entscheidung, denn ich glaube, kein anderer hätte mehr Emotionen hineinlegen können als er selbst. Grandios!
Als er merkt, dass seine Mutter Sala zunehmend dement wird, denkt er daran, dass es bald keine Chance mehr geben wird, etwas über das Leben seiner Familie und vor allem seiner Mutter zu erfahren. Die Gespräche mit Sala zeichnet er auf und begibt sich mit ihr auf den Weg in die Vergangenheit:
1932 ist es, als Sala, 13 Jahre alt, dem 17-jährigen Otto zum ersten Mal begegnet. Seit dieser ersten Begegnung steht fest, dass diese beiden Menschen zusammengehören. Sala muss durch die politische Lage 1938 Deutschland verlassen. Damit trennen sich ihre Wege für viele Jahre. Otto zieht als Sanitätsarzt in den Krieg und landet in russischer Gefangenschaft. Sala ist in den Kriegsjahren wegen ihrer jüdischen Herkunft voller Angst und immer auf der Flucht in verschiedenen Ländern. Es gibt nur wenige Menschen, die es gut mit ihr meinen und denen sie trauen kann. Hier hat mich die Erzählung über Mopp, die Sala zur Freundin geworden ist, einige Male zum Lächeln gebracht.
Es ist bemerkenswert, wie es Christian Berkel gelungen ist, die Geschichte seiner Eltern, Groß- und Urgroßeltern durch Gespräche mit seiner Mutter und Recherchen in Archiven, durch Briefwechsel und nicht zuletzt durch Reisen an die Orte, von denen seine Mutter erzählt hatte, zu einem runden Abschluss zu bringen.
Aus vielen einzelnen Puzzleteilen hat er nicht nur das Leben seiner Familie zu einem Ganzen zusammengefügt, sondern es ist ein lehrreicher Weg in die Vergangenheit entstanden mit einer realitätsnahen Schilderung der Ereignisse gerade auch des Zweiten Weltkriegs mit all seinen Schrecken und menschenverachtenden Geschehnissen, dass ich voller Hochachtung und dankbar bin, auf diesen Weg mitgenommen worden zu sein.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Kein Hörbuch zum Nebenher-Hören
Der Einstieg in den „Apfelbaum“ fiel mir nicht gerade leicht. Die verschiedenen, oft recht abrupt wechselnden, Zeit- und Erzählebenen fand ich anfangs recht verwirrend und es erforderte einiges an Konzentration, bis ich die …
Mehr
Kein Hörbuch zum Nebenher-Hören
Der Einstieg in den „Apfelbaum“ fiel mir nicht gerade leicht. Die verschiedenen, oft recht abrupt wechselnden, Zeit- und Erzählebenen fand ich anfangs recht verwirrend und es erforderte einiges an Konzentration, bis ich die verwandtschaftlichen Strukturen in diesem Familiengebilde durchschaut hatte. Mit zunehmender Dauer wurde es jedoch geradliniger und klarer, als sich die Geschichte vor allem auf die Hauptfiguren Otto und Sala konzentrierte. Es entwickelt sich eine durchaus packende, mitreißende Erzählung, eine Zeitreise durch etliche Jahrzehnte deutscher Geschichte und ein im Ergebnis wie ich finde wirklich gelungener Familienroman.
Positiv hervorzuheben am Hörbuch sind zwei Dinge: Zum einen handelt es sich hier erfreulicherweise um eine ungekürzte Lesung mit einer Spieldauer von mehr als 12 Stunden, zum anderen liest der Autor selbst. Und wer Christian Berkel schon mal als Sprecher erlebt hat, weiß um dessen Qualität und Ausdrucksfähigkeit.
Sehr gute 4 bis 5 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Als der 17-jährige Einbrecher Otto von der 13-jährigen Halbjüdin Sala in die Bibliothek ihres Vaters beim Stehlen ertappt wird, ist es Liebe auf den ersten Blick zwischen den beiden. Sala hilft ihm, sich zu verstecken, während seine Freunde beim Klauen erwischt werden. Otto …
Mehr
Als der 17-jährige Einbrecher Otto von der 13-jährigen Halbjüdin Sala in die Bibliothek ihres Vaters beim Stehlen ertappt wird, ist es Liebe auf den ersten Blick zwischen den beiden. Sala hilft ihm, sich zu verstecken, während seine Freunde beim Klauen erwischt werden. Otto stammt aus einem ärmlichen Berliner Haushalt, während Sala aus wohlbehüteten Verhältnissen stammt. Eigentlich wollen Sala und Otto für immer zusammen bleiben, doch dann bricht der Krieg aus. Als Halbjüdin muss die schwangere Sala aus Berlin fliehen und erlebt eine wahre Odyssee über Spanien und Frankreich bis nach Argentinien, während Otto eingezogen wird und nach Kriegsende 5 Jahre in russischer Gefangenschaft verbringen muss. So werden die beiden für lange Zeit getrennt. Als Sala 1955 nach Berlin zurückkehrt, trifft sie dort nach vielen Jahren wieder auf Otto und kann nun endlich ein gemeinsames Leben mit ihnen beginnen.
Der Schauspieler Christian Berkel hat mit seinem Buch „Der Apfelbaum“ einen intensiven und berührenden Roman vorgelegt, der auf wahren Begebenheiten beruht, lässt er den Leser doch an seiner ureigenen und sehr persönlichen Familiengeschichte teilhaben. Der Schreibstil ist flüssig und bildgewaltig, voller Emotionen und schwierigen Nachforschungen nach der eigenen Identität. Der Leser springt mit den ersten Zeilen mitten in die Handlung hinein und erlebt eine gefühlvolle Geschichte, die von Verfolgung, Entbehrungen, Flucht und Trennung geprägt ist. Der authentische Berliner Dialekt macht das Ganze noch realer und greifbarer. Berkels Erzählung reicht über drei Generationen hinweg und lässt den Leser über mehrere Ebenen am Leben seiner Eltern, seiner Großeltern sowie seiner Geschwister und sich selbst teilhaben, wobei er einige interessante Nebeninformationen einstreut, die den Leser durchaus zum Staunen bringen. So verzweigt wie die Äste eines Apfelbaums stellt sich die Geschichte von Christian Berkels Familiengeschichte dar mit vielen Umwegen, Trennungen und der Suche nach Menschen und ihrem Schicksal.
Die realen Charaktere wurden sehr individuell und lebendig dargestellt, so dass der Leser sich gut mit ihnen identifizieren kann und mit ihnen das gesamte Gefühlsbarometer erleben darf, während man gleichzeitig immer im Blick hat, dass man den Autor als Schauspieler und öffentliche Person „kennt“ und schätzt. Auf diese Weise kommen einem die Protagonisten noch viel näher. Sowohl mit Sala als auch mit Otto hat der Leser gleich zwei sehr charismatische Charaktere, die Unmenschliches überstanden haben nur aufgrund ihrer inneren Stärke. Aber auch ihre schwachen Momente erlebt der Leser während der Flucht oder in Gefangenschaft, wo sie sich einsam unter Fremden durchschlagen mussten. Dass sich die beiden nach so vielen Jahren der Trennung doch noch einmal wiedersehen werden und dann auch zusammenbleiben, grenzt an ein Wunder, wenn man bedenkt, welche Wendungen ihr Leben genommen hat und wie sehr sich die beiden auch über die Jahre verändert haben.
„Der Apfelbaum“ ist nicht nur ein sehr fesselnder und gefühlvoller Roman über ein Stück Zeitgeschichte, sondern vor allem eine sehr persönliche Familiengeschichte, die ans Herz geht. Absolute Leseempfehlung!
Weniger
Antworten 7 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 7 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Eine Reise in die Vergangenheit. Christian Berkel auf dem Weg, seine Familiengeschichte kennenzulernen.
Otto und Sala kennen sich von Kindesbeinen an. Otto ist sicher: er heiratet Sala. Doch der Krieg hat anderes mit ihnen vor. Sala, Halbjüdin, wird in ein Lager interniert und flieht …
Mehr
Eine Reise in die Vergangenheit. Christian Berkel auf dem Weg, seine Familiengeschichte kennenzulernen.
Otto und Sala kennen sich von Kindesbeinen an. Otto ist sicher: er heiratet Sala. Doch der Krieg hat anderes mit ihnen vor. Sala, Halbjüdin, wird in ein Lager interniert und flieht später nach Argentinien. Otto gerät als Kriegsarzt in russische Gefangenschaft. Auf die Entfernung verlieren sie sich aus den Augen, doch als Sala mit ihrer Tochter Ada wieder nach Deutschland zurückkehrt, trifft sie sich erneut mit Otto.
Eine Lektüre, die mich sehr gefordert hat. Teilweise autobiographische Szenen, teilweise im Romanstil gehalten, ist das Buch nicht einfach zu lesen, weil man zu Beginn eines Kapitels erst ein paar Sätze braucht, um zu wissen, wer hier nun erzählt. Auch die vielen Namen (teilweise doppelt) erschweren es ein wenig, der Handlung zu folgen. Die jedoch hatte mich schnell gepackt. Sala im Lager, Otto in Gefangenschaft. Das entbehrungsreiche Leben, die Verfolgung der Juden. Im Grunde nichts Neues, aber Berkel packt die Geschehnisse in Persönliches, was das Ganze noch anschaulicher wirken lässt.
Ein wenig schwer tat ich mich mit dem Berlinerischen und dem Französischen, aber gerade so wird die Handlung, die über mehrere Länder führt, noch authentischer. Was mir am Ende gefehlt hat, war, was aus Ada wurde.
Fazit: Ein Personenstammbaum wäre hilfreich, damit man sich beim Lesen besser zurechtfindet. Ansonsten solide Romankunst, die aber teilweise etwas verwirrend ist.
Weniger
Antworten 7 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 7 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Dieser Roman beschreibt die Eltern, Groß- und Urgroßeltern, Tanten von Christian Berkel, die dadurch, dass sie teils Juden, teils homosexuell waren, eine Vielzahl von Verfolgungen erlitten haben, Zeiten in Frankreich, Buenos Aires, Schweiz verbracht hatten und sich, ähnlich wie …
Mehr
Dieser Roman beschreibt die Eltern, Groß- und Urgroßeltern, Tanten von Christian Berkel, die dadurch, dass sie teils Juden, teils homosexuell waren, eine Vielzahl von Verfolgungen erlitten haben, Zeiten in Frankreich, Buenos Aires, Schweiz verbracht hatten und sich, ähnlich wie Christian Zeit ihres Lebens zerrissen fühlten. Die beiden Weltkriege sorgten durch ihre Zerstörungen und durch Kriegsgefangenschaft für veränderte Persönlichkeiten und permanent das Gefühl, dass sie in Schwierigkeiten lebten. Selten gab es Leichtigkeit. Auch der Alkohol spielte in der männlichen Linie eine großen Rolle. Trotzdem gelang es vielen, ihr Leben zu meistern. Ein sehr interessantes Buch, aber manchmal verwirrend, so dass ich beim ersten Lesen keinen Familienstammbaum zustande brachte. Weil das Buch aber so interessant geschrieben ist, begann ich es ein zweites Mal und schaffte es, die einzelnen Personen einander zuzuordnen. Allerdings frage ich mich zum Schluss, was mit Ada geschah. Eigentlich müsste sie eine Schwester von Christian Berkel sein, aber das wird nicht ganz deutlich.
Weniger
Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Zum Inhalt:
Christian Berkel erzählt in diesem Roman die erlebsreiche Geschichte seiner famikue über drei Generationen. Es erzählt die Geschichte zwei Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und dennoch nicht voneinander los kommen.
Meine Meinung:
Ich habe mich …
Mehr
Zum Inhalt:
Christian Berkel erzählt in diesem Roman die erlebsreiche Geschichte seiner famikue über drei Generationen. Es erzählt die Geschichte zwei Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und dennoch nicht voneinander los kommen.
Meine Meinung:
Ich habe mich ungeheuer schwer geran in die Geschichte reinzukommen. Gerade auch das ganz starke Berlinern am Anfang fand ich schwer lesbar und teilweise auch richtig schwer verständlich. Nachdem ich aber den Anfang irgendwie überstanden hatte, wurde das Buch immer besser. Man leidet mit den Personen mit, ist wirklich frih, dass man diese Zeiten nicht mitmachen musste. Dabei kommt das Buch dennoch nicht gefühlsduselig rüber, teilweise fast schon ein wenig abgeklärt, aber das passt meiner Meinung nach gut. Der Schreibstil hat mir am Ende trotz der Anfangsschwierigkeiten gut gefallen.
Fazit:
Berührende Familiengeschichte.
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
großartige deutsche Familiengeschichte
Manchmal treffen sich auf meinem Nachttisch Bücher, die kaum besser zusammen passen könnten.
In „Archipel“ wurde eine spanische Familie chronologisch rückwärts erzählt, jetzt eine deutsche Familie in …
Mehr
großartige deutsche Familiengeschichte
Manchmal treffen sich auf meinem Nachttisch Bücher, die kaum besser zusammen passen könnten.
In „Archipel“ wurde eine spanische Familie chronologisch rückwärts erzählt, jetzt eine deutsche Familie in herkömmliche Art und Weise.
Der Vater des Vaters Otto vom Ich-Erzähler, der biografisch dem Autor ähnelt, stirbt in Russland im 1.Weltkrieg, sein Vater wächst mit Mutter und Stiefvater in einem Kreuzberger Hinterhof auf. Otto muss sich im Leben regelrecht durchschlagen. Auf einer Einbruchstour lernt er seine spätere Frau Sala kennen, deren alleinerziehender Vater Reformpädagoge, Bi und Alternativ ist. Die jüdische Mutter kämpft in Spanien gegen Franco. Beide haben sich auf dem Mont Veritate bei Ascona kennengelernt.
Sala und Otto können wegen den Nazis nicht zusammen kommen.
Wie beide den Krieg überstehen, ist der Höhepunkt dieses Buches. Sala überlebt ein Lager im französischen Gurs, lebt dann mit falscher Identität in Leipzig. Otto arbeitet als Frontarzt in Russland und gerät in Kriegsgefangenschaft.
Als er zurückkehrt, heiratet er Waltraud. Sala lebt währenddessen in Argentinien mit ihrer gemeinsamen Tochter Ada.
Letztlich trafen sich Otto und Sala doch noch in Berlin, Otto ließ sich scheiden und alles wäre gut, wenn nicht die Krankenschwester am Sterbebett gewesen wäre, aber das sollt ihr selber lesen.
Erstmals 2019 hat mich ein Buch wirklich gefesselt. 5 Sterne.
Lieblingszitat:
Man weiß nie, wie die Fische küssen, unter Wasser sieht man's nicht, und über Wasser tun sie's nicht. (S.345)
Weniger
Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Die Geschichte der Eltern im Spiegel der Zeit
Christian Berkel besucht seine Mutter. Ihm wird bewusst, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, um die Geschichte seiner Eltern zu erfahren, denn den Erinnerungen seiner Mutter ist immer weniger zu trauen. Also stückelt er die Geschichte zusammen …
Mehr
Die Geschichte der Eltern im Spiegel der Zeit
Christian Berkel besucht seine Mutter. Ihm wird bewusst, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, um die Geschichte seiner Eltern zu erfahren, denn den Erinnerungen seiner Mutter ist immer weniger zu trauen. Also stückelt er die Geschichte zusammen und lässt von seiner Mutter die Lücken auffüllen, so gut es geht. Es ist eine Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen, die durch den historischen Kontext nicht einfacher wird. Sala ist 13, Otto 17 als sie sich kennenlernen und ineinander verlieben. Sala, Halbjüdin mütterlicherseits, stammt aus einer intellektuellen Familie, während sich Otto, das Arbeiterkind, mühsam sein Medizinstudium erarbeitet. Ab 1938 führt Sala ein unstetes Leben, reist von Deutschland nach Spanien zur entfremdeten Mutter, von dort nach Paris zu einer modeschöpfenden Tante und landet schließlich in Argentinien. Währenddessen wird Otto zur Wehrmacht eingezogen und landet schließlich in Kriegsgefangenschaft.
"Der Apfelbaum" ist eigentlich eine sehr tragische Familiengeschichte, die zeigt, was Verfolgung und Krieg Menschen und ihren Beziehungen antun kann. Sala hat seit Jahren keinen Kontakt zu ihrer Mutter, identifiziert sich nicht mit deren Religion und versteht daher nicht, warum sie verfolgt wird. Durch ihre Flucht verliert sie ihre Wurzeln. Otto ist physisch und psychisch von der Kriegsgefangenschaft gezeichnet. Für beide ist es schwer, wenn nicht gar unmöglich, nach dem Erlebten wieder zusammenzufinden. Das ist schon eine sehr anrührende und, durch die Tatsache, dass es sie auf wahren Begebenheiten beruht, hoch interessante Geschichte. Sie gibt viele Denkanstöße, nicht nur aus historischer Betrachtung, sondern auch unter aktuellen Gesichtspunkten.
Dennoch haben mich einige Dinge beim Lesen auch gestört. Regelmäßig ist beispielsweise Dialekt eingestreut. Das ist bei Otto noch glaubhaft, weil es seine Herkunft deutlich macht und auch das Bemühen, sich unter bestimmten Bedingungen gewählter auszudrücken. Leider konnte ich mit Salas regelmäßigem "zum Piiiepen" wenig anfangen. Für mich wollte das einfach nicht zu einer Frau aus intellektuellen Kreisen passen und auch nicht an den Stellen, an denen es vorkam. Was mich aber eigentlich noch mehr gestört hat war, dass manche Szenen irgendwie zu verschwimmen schienen. In einigen Situationen wurde die Bedeutung plötzlich doppeldeutig und schwer greifbar, während der Rest geradlinig und direkt erzählt wurde. Durch den Stil und die Beschreibungen sind viele Szenen durchaus kunstvoll, aber mit manchen von ihnen wusste ich überhaupt nichts anzufangen und konnte sie überhaupt nicht einordnen. Bei mir kam das Gefühl auf, dass der Autor sich möglicherweise an gewisse Erinnerungen nicht herangetraut hat oder dass ihm bei diesen Szenen Informationen fehlten, die er nicht fiktiv auffüllen wollte.
Insgesamt ist "Der Apfelbaum" ein ehrgeiziges "Projekt", die Geschichte der eigenen Eltern zu verstehen, die im Spiegel ihrer Zeit sehr spannend war, aber tiefe Spuren bei den Betroffenen hinterlassen hat. Statt eines großen unterhaltsamen "Abenteuers", wie bei so vielen fiktiven Geschichten, zeigt "Der Apfelbaum" die ganze Tragik eines Lebens in der damaligen Zeit auf zutiefst menschliche Weise auf. Und somit ist das Buch inhaltlich auf jeden Fall etwas Besonderes. Stilistisch hatte es für mich leider ein paar Schwächen.
Weniger
Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Ich mag Christian Berkel als Schauspieler, bin aber an das Buch ein wenig skeptisch herangegangen, da ich dachte „schon wieder ein Prominenter, der sich als Schriftsteller versuchen will“. Doch das Buch hat mich überzeugt.
Die Halbjüdin Sala ist 13 Jahre alt, als sie den …
Mehr
Ich mag Christian Berkel als Schauspieler, bin aber an das Buch ein wenig skeptisch herangegangen, da ich dachte „schon wieder ein Prominenter, der sich als Schriftsteller versuchen will“. Doch das Buch hat mich überzeugt.
Die Halbjüdin Sala ist 13 Jahre alt, als sie den 17-jährigen Einbrecher Otto in der Bibliothek ihres Vaters überrascht. Sie lieben sich von Anfang an. Aber das Leben wird für die beiden nicht einfach. Dass sie aus sehr unterschiedlichen Klassen hindert sie nicht, aber dann sorgen die politischen Verhältnisse dafür, dass sie getrennt werden. Sala muss Deutschland verlassen und kommt in Paris bei einer Tante unter. Doch dann marschieren die Deutschen in Paris ein. Sie wird interniert nachdem sie verraten wurde. Später kann sie untertauchen. Otto dagegen muss als Sanitätsarzt in den Krieg und gerät in russische Gefangenschaft. Auch wenn sie viele Jahre getrennt sind, vergessen können sie nicht.
Man muss schon konzentriert lesen, um der Geschichte zu folgen, denn die Handlungs- und Zeitebenen wechseln sehr häufig. Doch wenn man sich darauf einlassen kann, wird man durch eine spannende Familiengeschichte über drei Generationen gefesselt. Der Berliner Dialekt macht es Lesern, die nicht aus Berlin stammen, anfangs etwas schwer, doch mit der Zeit gewöhnt man sich daran, aber er sorgt auf jeden Fall für Authentizität.
Neben der Geschichte dieser Familie wird ein erschreckendes Stück Zeitgeschichte beschrieben.
Die Charaktere waren interessant und authentisch dargestellt. Jeder hatte seine eigene Persönlichkeit.
Es ist eine interessante und berührende Familiengeschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Ich kann das Buch nur empfehlen!
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Christian Berkel hat sich als Schauspieler einen Namen gemacht, weil ihn seine Familiengeschichte jedoch nicht losgelassen hat, versuchte er, sich ihr schreibend zu nähern. Wie er das Leben seiner teilweise jüdischen Vorfahren über drei Generationen in Zeiten des Nationalsozialismus …
Mehr
Christian Berkel hat sich als Schauspieler einen Namen gemacht, weil ihn seine Familiengeschichte jedoch nicht losgelassen hat, versuchte er, sich ihr schreibend zu nähern. Wie er das Leben seiner teilweise jüdischen Vorfahren über drei Generationen in Zeiten des Nationalsozialismus schildert und mit Inhalten ausschmückt, ist nicht nur berührend zu lesen, es zeigt auch ein authentisches Bild dieser schicksalsträchtigen Zeit.
Mit großem Einfühlungsvermögen, sprachgewandt und mit einigem Berliner Dialekt versehen, erzählt Christian Berkel seine interessante Geschichte. Seine Großeltern stellt er darin in den Mittelpunkt und zeigt damit, wie zwei Liebende unter den Widrigkeiten ihrer Epoche zu kämpfen haben. Ihr Leben wurde wie das von so vielen Menschen zum Spielball der Zeit.
Die Handlungsorte sind weitreichend und führen von Berlin über Stationen in Madrid, Paris, einem Lager in den französischen Pyrenäen, Argentinien bis in die russische Kriegsgefangenschaft Ottos. Das macht deutlich, wie sehr das Leben der Personen dem Einfluss der Judenverfolgung und des Kriegsgeschehens unterworfen war. Flucht, Verfolgung und Gefangenschaft spielte in diesen Leben eine große Rolle.
In diesem Familienepos werden die Figuren genau gezeichnet, sie wirken vor allem durch ihre Sprache authentisch und berühren mit ihren Gefühlen, Ängsten und Sehnsüchten, die im Kriegsgeschehen und auch danach von so vielen äußeren Einflüssen beeinflusst wurden. Es gibt einige Familienangehörige, die mit ihrer Besonderheit auffallen und im Roman auch für unterhaltsame Szenen sorgen. Berkels Großvater war homosexuell und lebte in einer Nudistenkolonie, die Großmutter agierte als Anarchistin in Spanien und die Großtante arbeitete in der Pariser Modeszene mit den Größen ihrer Zeit.
Mich haben die Schicksale von Otto und Sala tief berührt und die geschilderten Kriegsszenen mit Hunger, Gewalt und menschlicher Grausamkeit haben mich mit großer Betroffenheit erfüllt. So etwas darf sich nicht wiederholen und deshalb finde ich Bücher mit dieser Thematik so unglaublich wichtig.
Dieser Roman hat mich berührt und bis zum Ende gefesselt. Hier wird nichts schön geredet, sondern offen gezeigt, wie sich Menschen einer Familie auf verschiedene politische Seiten gestellt haben.
Etwas problematisch sehe ich die häufig wechselnde Zeit- und Ortsperspektive, wenn man das Buch allerdings in einem Rutsch durchliest, verknüpfen sich die Handlungsstränge zu einem kompletten und verständlichen Bild.
Dieser autobiografisch angehauchte Roman zeigt eine bewegend erzählte, schicksalsträchtige Familiengeschichte, die bis zum Ende fesselt. Sie erklärt nachkommenden Generationen diese Zeit und macht den Unsinn von Kriegen an Beispielen fest. Ein Mahnmal gegen den Krieg.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für