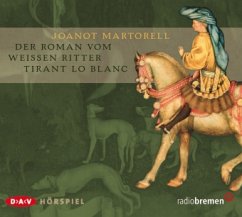Der erste Teil des Werks behandelt die Geschichte der letzten Lebensjahre des Ritters Guillem de Vàroic. Guillem unternimmt eine Pilgerfahrt und kehrt während einer Maureninvasion nach England zurück, wo er sich unerkannt als Einsiedler nach Vàroic zurückzieht. Im Traum erscheint ihm ein Mädchen, das ihm ankündigt, er werde den Widerstand gegen die Invasoren organisieren. Gui gelingt es sodann, die Mauren zurückzuwerfen, worauf er in seine Einsiedelei zurückkehrt. Dorthin gelangt eines Tages der junge, noch unbekannte Ritter Tirant lo Blanc, den der alte Held in einer eindrucksvollen und bedeutsamen Szene in die Regeln des Rittertums einführt. Dieser Handlungsabschnitt wird mit der Erzählung von Tirants Turniererfolgen in London und der Stiftung des Hosenbandordens abgeschlossen.
"Das beste Buch der Welt." - Miguel de Cervantes

Katalanische Weltliteratur: Der "Weiße Ritter" von Joanot Martorell endlich auf Deutsch / Von Hans-Martin Gauger
Bei Cervantes, gleich zu Beginn des "Don Quijote", wird nach dessen erster Ausfahrt die Büchervernichtung geschildert, die, während Don Quijote im Schlafe liegt, der Pfarrer und der Barbier des Orts, in dem der Held zu Hause ist, vornehmen, weil sie in seinen vielen Ritterbüchern den Grund der Zerrüttung des Edelmannes sehen. Aber der kluge und belesene Pfarrer, über den sich der Erzähler gar nicht lustig macht, will doch zuvor die Titel überprüfen. Schließlich wird es ihm zu viel, und er weist die Haushälterin an, alle noch nicht durchgegangenen Bücher auf den Hof zu werfen, damit sie dort verbrannt werden können. Da aber fällt eines aus dem Stoß, der zum Fenster hinaus soll, vor die Füße des Barbiers. Indem dieser es aufhebt, liest er: "Geschichte des berühmten Ritters Tirante el Blanco". Wie elektrisiert ruft da der Pfarrer aus: "Gott steh mir bei! Dass Tirante der Weiße auch hier ist! Gebt ihn mir, Nachbar, denn ich bezeuge, dass ich einen Schatz an Vergnügen und eine wahre Mine an Zeitvertreib in ihm gefunden habe (. . .). Ich sage Euch die Wahrheit, Herr Nachbar: dies ist, aufgrund seines Stils, das beste Buch der Welt."
Mit "Stil" meint der Pfarrer (und gewiss auch Cervantes) das "Realistische", denn er präzisiert sogleich: "Hier essen die Ritter, hier schlafen sie, hier sterben sie auch in ihren Betten und machen, bevor sie sterben, ein Testament. Kurz, hier finden sich all die Dinge, an denen es in den anderen Büchern dieser Art fehlt." Dieses Buch vom "Weißen Ritter", das also im ersten "realistischen" Roman der Weltliteratur, denn dies ist der "Quijote", auf solch enorme Weise ausgezeichnet wird, erschien 1490, somit 115 Jahre vor dem "Quijote", der 1605 herauskam. Und jetzt endlich, zu dieser Buchmesse, nach weit über fünfhundert Jahren, haben wir den "Weißen Ritter" endlich auch auf Deutsch.
Dieser Roman gehört zur katalanischen Literatur, genauer zur valencianischen. Aber auf diesen Streit brauchen wir uns nicht einzulassen - hier nicht und überhaupt nicht, denn das Valencianische ist keine eigene Sprache. Es gibt, als Sprache, nur das Katalanische, beginnend im Norden bereits im Roussillon in Frankreich und in Ostspanien hinunterreichend in einem immer schmaler werdenden Streifen bis Alicante. Und innerhalb dieser Sprache, zu der auch die vorgelagerten Inseln, Mallorca und die übrigen, gehören, gibt es, wie üblich, regionale Varianten. Richtig ist, dass das alte Königreich Valencia, wie gerade auch und bereits in unserem Roman festgehalten wird, "von Menschen aus vielen Nationen bewohnt ist". Das Katalanische blühte vom dreizehnten bis ins fünfzehnte Jahrhundert in höchst eindrucksvoller, vielseitiger Literatur. Dann aber, bald nach der Vereinigung Kastiliens und Aragoniens, verstummte sie für Jahrhunderte. Die Dichter aus diesen Gegenden wechselten zum Spanischen, obwohl das Katalanische in alltäglicher Rede und auch gerade von den "besseren" Leuten weiterhin gesprochen wurde. Erst im neunzehnten Jahrhundert erstand diese Literatur, deren größter Roman ganz ohne Zweifel der "Weiße Ritter" ist, neu.
Altkatalanisch" präzisiert Vogelgsang im Titel also sehr zu Recht, nicht einfach "katalanisch". Und der Held unseres Romans heißt in seiner Sprache "Tirant lo Blanc". Das Eigenschaftswort "Blanc" (weiß) ergab sich vielleicht aus einer Deformierung von "Valachus", denn möglicherweise geht die Figur auf den walachischen Edelmann Johannes Hunyadi aus Siebenbürgen zurück, der historisch ist und zu einem Symbol des Widerstands gegen die Türken wurde. Jedenfalls: In diesen großen zeitgeschichtlichen Zusammenhang gehört der Roman, aus ihm heraus lebt er: Da war die Katastrophe (so wurde sie empfunden) des Falls Konstantinopels im Jahr 1453.
Über dies und anderes informiert Vogelgsang in einem kundigen und lebendigen Vorwort und einem ebensolchen Nachwort im ersten Band. Beide liegen siebzehn Jahre auseinander, denn der erste Band ist schon früher erschienen: "Steckbrief zur Fahndung nach einem tatverdächtigen Erzfabulanten" (1990) und "Pflichtschuldige Auskunft über Fahndungserfolge, die mittlerweile zu verzeichnen sind" (2007). Zudem enthält die Ausgabe im dritten Band den sehr schönen "Fehdebrief zur Verfechtung der Ehre von Tirant lo Blanc" von Mario Vargas Llosa, der bereits 1968 geschrieben wurde und dem es tatsächlich gelang, dieses "Buch ohne Leser" wiederzuerwecken. Dieser Roman sei, sagt Vargas, "einer der ehrgeizigsten" überhaupt, und Martorell sei "der erste vom Stamm der Allmachtserzähler (. . .), die sich an Gottes Stelle setzen und in ihren Romanen eine ,allumfassende Wirklichkeit' zu erschaffen suchen".
Joanot Martorell wurde vermutlich 1410 in Valencia geboren und starb 1465. Sein Roman wurde also erst fünfundzwanzig Jahre nach seinem Tod gedruckt. Vielleicht hat ein anderer Autor, Martí Joan de Galba, der 1490 starb, den Roman weitergeführt und auch in ihn eingegriffen - vielleicht. Martorell kam aus wohlhabender Familie. Er war, ist zu vermuten, in England gewesen, wo sein Roman zunächst spielt, sicher jedoch war er etwa acht Jahre am Hof in Neapel, bei Alfons V. von Aragonien, der einer der mächtigsten Fürsten des östlichen Mittelmeerraums war. Nach dessen Tod kehrte er nach Valencia zurück und starb verarmt - in diesem Punkt dem Cervantes, der freilich aus bescheidenen Verhältnissen kam, nicht unähnlich.
Der Roman, einem portugiesischen Prinzen gewidmet, gibt vor, eine Übersetzung aus dem Englischen zu sein - erst ins Portugiesische, dann zusätzlich noch ins Katalanische (auch Erzähler Cervantes gab ja seinen Roman als eine Übersetzung aus). Der Roman beginnt also in England, wohin Tirant, der an Geist und Körper wunderbare Held, der aus der Bretagne stammt, gezogen ist, um an einer Hochzeitsfeier am Königshof teilzunehmen. Hier trifft er den seltsamen "Einsiedelkönig", der ihm die Regeln der Ritterschaft erklärt. Dann geht es nach Rhodos, welches Tirant von den Türken, die es belagern, befreit. Danach erobert er im Heiligen Land die Stadt Tripolis für den König von Frankreich. Sodann hilft er dem byzantinischen Reich - wieder gegen die Türken. Hier nun verliebt er sich in die Königstochter Carmesina: Die beiden heiraten heimlich. Bevor sie es wirklich und also öffentlich tun - da ist nun eine schöne und gar nicht unsinnliche und sogar lustige Liebesgeschichte -, kämpft Tirant im nördlichen Afrika. Er stirbt nach kurzer Krankheit in Adrianopel. Carmesina folgt ihm, weil sie ohne ihn nicht leben will. Die Leichname werden in die Bretagne gebracht.
Fritz Vogelgsangs gelegentlich recht freie Übersetzung ist vorzüglich: eine außerordentliche Leistung und also diesem außerordentlichen Roman angemessen. Und der ist nun wirklich erstaunlich. Er liest sich gut in seinen kurzen Abschnitten dank seines Stils und dem Vogelgsangs, noch dazu in der formidablen Ausstattung hier. Er hat etwas Leichtes und mediterran Helles, bleibt rational auf dem Boden, ist auch nicht eigentlich exuberant, kein wucherndes selbstvergessenes Fabulieren, vielmehr erzählt er heiter, direkt oder indirekt belehrend, und ist auf diese Weise auch etwas wie ein narratives Handbuch des sich verabschiedenden Mittelalters. Fromm natürlich ist das Buch auch - da ist die Welt noch christlich, ja geradezu kardinalmeisnerisch in Ordnung. Das hindert es freilich nicht, auch unter den Muslimen höchst edelmütige Menschen zu finden.
Eigentlich hat Vargas den Roman sehr gut gekennzeichnet: ein "Ritterroman", aber, wie schon Cervantes' Pfarrer wusste, ganz anders als die anderen, ein "historischer" Roman, aber überaus großzügig in Chronologie und anderem, ein "Sittenroman", ein "erotischer" Roman (ja, durchaus, und es geht bis ins Sexuelle), ein "psychologischer", schließlich ein "totaler Roman", nämlich "ein Wortgebilde, das den gleichen Eindruck von Vieldeutigkeit vermittelt wie das reale Sein". So ist es. Und - es ist erstaunlich.
Joanot Martorell: "Der Roman vom Weißen Ritter Tirant lo Blanc". Aus der altkatalanischen Sprache des Königreichs Valencia erstmals ins Deutsche gebracht von Fritz Vogelgsang. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007. Drei Bände, insgesamt 1587 Seiten, geb., Kassette 98,- [Euro]; Subskr.-Preis bis 31. 12. 2007 78,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main