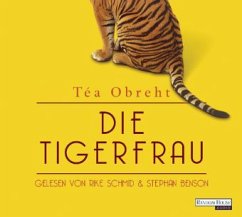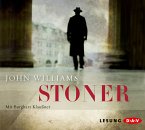Unvergessliche Figuren und erzählerische Virtuosität
Natalia arbeitet in einem Waisenhaus irgendwo in Südosteuropa, als sie vom rätselhaften Tod ihres geliebten Großvaters erfährt. Nach Erklärungen suchend, erinnert sich die junge Ärztin an jene Geschichten aus seinem Leben, die sich um zwei seltsame, fatale Gestalten drehen - die Tigerfrau, eine schöne Taubstumme in seinem Heimatdorf, die einen geflüchteten Tiger pflegte; und einen charmanten, obskuren Mann, der nicht sterben kann. Während Natalia auf den Spuren des Großvaters durch idyllische und kriegsverwüstete Landschaften reist, werden ihr diese Figuren immer gegenwärtiger. Bald entspinnt sich ein ganzer Kosmos an Mythen und Gestalten, und Natalia begreift, welche Wahrheit über die Lebensrätsel ihrer Familie und ihre versehrte Heimat in ihnen steckt ...
Natalia arbeitet in einem Waisenhaus irgendwo in Südosteuropa, als sie vom rätselhaften Tod ihres geliebten Großvaters erfährt. Nach Erklärungen suchend, erinnert sich die junge Ärztin an jene Geschichten aus seinem Leben, die sich um zwei seltsame, fatale Gestalten drehen - die Tigerfrau, eine schöne Taubstumme in seinem Heimatdorf, die einen geflüchteten Tiger pflegte; und einen charmanten, obskuren Mann, der nicht sterben kann. Während Natalia auf den Spuren des Großvaters durch idyllische und kriegsverwüstete Landschaften reist, werden ihr diese Figuren immer gegenwärtiger. Bald entspinnt sich ein ganzer Kosmos an Mythen und Gestalten, und Natalia begreift, welche Wahrheit über die Lebensrätsel ihrer Familie und ihre versehrte Heimat in ihnen steckt ...

Rike Schmids fahle, leicht raue Stimme passt wunderbar zu Natalia, der nüchternen Beobachterin. Sie spiegelt Natalias Lakonie und lässt sie manchmal plötzlich schmelzen. Die Erzählungen des Großvaters, eines skeptischen, reservierten Arztes, liest Stephan Benson mit einer Großvaterstimme, alt und ausdrucksvoll. Etwas so Schönes wie dieses Hörbuch entsteht dann, wenn alle Beteiligten intuitiv wissen, was sie tun.
© BÜCHERmagazin, Elisabeth Dietz (ed)

Bewundernswert frühreif und weise. Oder schwül träumerisch und schrecklich unentschlossen: "Die Tigerfrau", der erste Roman der 26-jährigen Amerikanerin Téa Obreht verzaubert den Balkan
Wer über ein Buch schreiben soll und nirgendwo anzufangen weiß, der sucht nach einem Satz, der die Essenz in wenige Worte fasst, nach einem Zweizeiler, nach ein paar klärenden Worten aus dem Mund einer handelnden Figur. In manchen Büchern wird man auf jeder Seite fündig. Im Debüt von Téa Obreht, deren Namen man, weil sie im ehemaligen Jugoslawien geboren ist, mit rollendem "R" und feuchtem "ch" ausspricht, gibt es nur eine einzige solche Stelle -, die aber grinst den Leser dafür aus der ansonsten von der Erziehung in amerikanischen "Creative Writing"-Workshops glattgeschmirgelten Prosa heraus umso frecher an.
Im siebten Kapitel, in einer der vielen vom Ursprungsplot in die jüngere und nicht mehr ganz so junge Vergangenheit abzweigenden Geschichtchen, geht es um den sensiblen Metzgersjungen Luka. Er wandert aus dem Bergdorf Galina in die Hafenstadt Sarobor, um sein Können auf der Gusla, einer traditionellen, einsaitigen Mischung aus Laute und Bratsche, zur Schau zu stellen. Als ihm ein Mädchen beim Spielen in einer Kneipe zuschaut und fragt, warum seine "arme kleine Fiedel" nur eine Saite habe, da brennt Luka zwar einen Moment lang das Gesicht, doch er erwidert, ganz der Dichter, der er werden will: "Fünfzig Saiten singen ein Lied, aber eine einzelne kennt tausend Geschichten." Das Mädchen fragt nicht weiter nach, die beiden freunden sich an, wollen später - trotz Lukas Interesse an jungen Männern - heiraten und setzen so etwas in Gang, das dann erst irgendwann ganz am Ende des Buchs doch wieder etwas mit der Geschichte zu tun haben soll, bei der man eigentlich angefangen hatte.
Schreibweisheiten.
Dieser Satz, der von den "tausend Geschichten", fasst das ganz gut zusammen, was man an dem Erstling der erst 26-jährigen Autorin entweder bewundernswert frühreif und weise oder schwül träumerisch und schrecklich unentschlossen finden kann.
Obreht hält sich nämlich einerseits an die Weisheit der "Creative Writing"-Professoren "to write what you know", was in Fällen von Einwandererkindern meistens heißt, etwas über das Herkunftsland der Eltern zu schreiben, ob man darüber nun wirklich etwas weiß oder nicht - und andererseits an die Weisheit des Schlachtersprösslings Luka. Mit ihrer einen, gutgestimmten sprachlichen Saite, den kurzen, rundredigierten Raymond-Carver-Sätzen aus dem Uniworkshop, erzählt sie Geschichten, die etwas mit dem Balkan zu haben, auf dem sie 1985 geboren wurde. Es sind vielleicht nicht tausend, aber doch viel mehr als eine. Zuerst ist da die von der Ich-Erzählerin Natalia, einer jungen, in einen der vielen Kriege hineingeborenen Medizinstudentin, die von dem Tod ihres Großvaters erfährt, als sie gerade Waisenkinder eines entlegenen Klosters mit Impfstoffen versorgt. (Überhaupt liegen hier die allermeisten Tatorte "abgelegen" oder "ab vom Schuss" und befinden sich allesamt in einem auffällig namenlosen Balkanland.)
Sobald berichtet ist, dass der Großvater, zeitlebens nüchterner Mediziner, liebevoller Ehemann und überzeugter Nicht-Radikaler, unter falschen Vorwänden zum Sterben in ein ("hinter dem Mond" gelegenes) Krankenhaus gefahren ist, beginnt Natalia die Suche nach der Vergangenheit dieses Mannes, der sie aufgezogen hat. Nur kurz sieht es aus, als wäre diese Suche eine tatsächliche, ein ernsthaftes Wühlen in der Geschichte und den Geschichten dieser Region, der ehrliche Versuch, sich als mehr oder weniger Außenstehende und Nichthistorikerin in die Gefühlswelt eines Weltteils einzugraben. Doch der erste Satz des ausgerechnet mit "Der Krieg" überschriebenen zweiten Kapitels lautet eben nicht: "Alles was nötig ist, um meinen Großvater zu verstehen, liegt in der Geschichte", sondern: "Alles was nötig ist, um meinen Großvater zu verstehen, liegt in zwei Geschichten: der von der Tigerfrau und der von dem Mann, der nicht sterben konnte."
Und in den beiden Geschichten, die danach nicht an einem Stück, sondern immer mal wieder erzählt werden, wird es dann genau so jugendbuch- und märchenhaft, wie es ihre Titel vermuten lassen. Die eine erzählt aus der Kindheitserinnerung des Großvaters, von einer taubstummen jungen Frau aus dessen (weit hinterwäldlerischem) Heimatdorf. Die Taubstumme freundet sich nach dem nicht besonders mysteriösen Tod ihres Ehemanns mit einem menschelnden, aus dem Zoo entlaufenen Tiger an, wird schwanger und ist den phantasielosen Dörflern nun vor allem deswegen und nur am Rande auch wegen ihrer türkischen Herkunft und ihrer Behinderung verhasst.
Die andere Geschichte, die von dem Mann, der nicht sterben konnte, kommt ebenfalls aus der Erinnerung des Großvaters. Als gelungene, aber leider einzige formale Reaktion überhaupt auf das ständige Mal-hier-mal-da-Erzählen ist sie im spröderen, mit regelmäßigen Du-weißt-ja-Natalias gespickten Ton des Großvaters gehalten. "Der Mann, der nicht sterben konnte" kann tatsächlich im ganz wörtlichen Sinne nicht sterben, was damit zu tun hat, dass er tatsächlich im ganz wörtlichen Sinne mit dem Tod verwandt ist, ihn zum Onkel hat, um genau zu sein. Von eben jenem Onkel mit Unsterblichkeit bedacht, zieht er mit einem Kaffeebecher durchs Land und warnt Sterbende vor ihrem baldigen Ende.
Und das sind noch nicht alle Märchen. Es geht auch um einen Jäger, der sich möglicherweise in einen Bären verwandeln kann, und eine unfachmännisch bestattete Leiche, die möglicherweise Unheil über Dorfbewohner bringt. Nur zwischendrin taucht immer mal wieder der Krieg auf und was er mit alten und jungen Menschen anstellt - außer sie umzubringen.
Wassergeister.
Téa Obrehts früher Erfolg wurde möglich, weil einflussreiche Literaturredakteure des "New Yorker" ihre Kurzgeschichten abdruckten und sie 2010 zur jüngsten Autorin in dem vieldiskutierten Generationsdefinierungsversuch "20 under 40" machten. Auch in diesen Geschichten gibt es Wassergeister und Ähnliches, auch hier wird immer wieder betont die Grenze zwischen Wirklichkeit und Märchen überschritten. In diesen kurzen Geschichten, die im Gegensatz zur "Tigerfrau" gar nicht erst behaupten oder andeuten, sie könnten zum Verständnis von irgendetwas außerhalb ihrer selbst beitragen, liegt Obrehts Stärke: Hier kann man sich zwar auch fragen, was es über eine Generation sagt, wenn eine ihrer ersten lauten, literarischen Stimmen es grundsätzlich vermeidet, etwas vom Jugendlichsein zu erzählen. Aber man kann sie auch ohne unangenehmes Gefühl annehmen, die Einladung in den Märcheneskapismus.
Glaubt man den vielen Interviews, die Obreht nach dem Gewinn des wichtigen Orange Prize for Fiction gegeben hat, war "Die Tigerfrau" auch zuerst einmal viele verschiedene Kurzgeschichten, einige noch aus den Seminaren der Studienzeit, einige aus dem Hinterkopf, die dann nachträglich "verwebt" wurden. Aber warum nur mussten diese grundverschiedenen Geschichten so unbedingt aneinandergetackert werden? Nur durch ihre Zwangsheirat löst dieses Buch seine seltsame Mischung aus Sympathie und Ärger aus. Für sich genommen, ist die Charakterstudie des langsam zurückverwildernden Zootigers berührend. Aber kann man sie in die Pflicht nehmen, die wahrere Wahrheit der Nato-Bomben zu sein? Der wichtige amerikanische Kritiker Ron Charles hat in seiner Kritik der "Tigerfrau" geschrieben, das Buch offenbare Wahrheiten, von der die amtliche Geschichte nichts wissen könne, "truths that history can't touch". Es gibt aber auch einen Raum, der zwischen amtlicher Geschichte und Tigern, Bären und dem Neffen des Todes liegt. So gesehen, wird der ganze Hokuspokus zur Entschuldigung, es nicht auch mal geradeaus versucht zu haben mit den Wahrheiten, die abseits der Geschichtsbücher liegen.
Lebende Tote.
Es wird nicht besser dadurch, dass Obreht es allem Anschein nach anders könnte. Nicht nur der phantastische Teil stünde für sich allein viel besser da. Auch auf die zaghaften Versuche, sich der Generation zu nähern, der Obreht vor dem Umzug nach Amerika mal angehörte, könnte man sich besser konzentrieren, wenn nicht an jeder Kreuzung ein paar lebende Tote stünden. Eine der stärksten Stellen im Buch berichtet von einer Jugendliebe der Erzählerin Natalia, einem jungen Musikkassettenhändler: "Als ich ein paar Wochen lang gespart hatte und mir ,Graceland' kaufen wollte, sagte er: ,Es ist Krieg, dein Geld ist nichts wert . . .' Wir küssten uns noch drei Monate lang, in denen sich mein Besitz an Musik verdreifacht haben muss, und dann war Ori, wie viele Jungen in seinem Alter, plötzlich verschwunden."
Für einige Vertreter des lateinamerikanischen magischen Realismus der sechziger Jahre, einer Gattung, zu der alle möglichen Kritiker Obreht engste Verwandtschaft bescheinigen, mag es durchaus überlebensnotwendig gewesen sein, politische Analyse und Aufmüpfigkeit mit einem Schleier aus Legende und Zauberei unzensierbar zu machen. Doch in einer Situation, in der die größten Märchen über die Kriege auf dem Balkan immer noch aus Den Haag kommen, hätte sich auch eine Künstlerin vielleicht an das erinnern können, was einer ihrer eigenen Charaktere in den letzten Zeilen der "Tigerfrau" lernen muss: "Auch der blinde Orlo mit seinen . . . Tricksereien hatte Macht, gewiss; aber wahre Macht lag, wie der Apotheker jetzt begriff, im Eindeutigen und Konkreten."
GREGOR QUACK.
Téa Obreht: "Die Tigerfrau". Übersetzt von Bettina Abarbanell. Rowohlt, 416 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Eines der erstaunlichsten Debüts der jüngeren amerikanischen Literatur. FAZ.NET