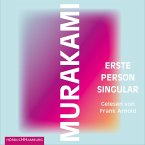Christian Krachts neuer Roman führt uns mitten in die wilden, fiebrigen Jahre der Weimarer Republik, als die Filmkultur ihre frühe Blüte erlebte. In Berlin versucht ein Schweizer Filmregisseur, angestachelt von Siegfried Kracauer und Lotte Eisner, den UFA-Tycoon Hugenberg zur Finanzierung eines Film zu überreden, genauer gesagt: eines Gruselfilms, genauer gesagt: in Japan. Das überschneidet sich mit ebensolchen Plänen im dortigen Kaiserreich, mit denen man dem entstehenden Hollywood-Imperium Paroli bieten will. Plänen, die durch den Nationalsozialismus, der am Himmel von Berlin dämmert, eine völlig neue Wendung bekommen. Ein Roman, der das Geheimnis des Films als Kunstwerk der Moderne genauso feiert wie seine großen Meister - von Charlie Chaplin über Heinz Rühmann bis Fritz Lang.Ungekürzte Lesung mit Wanja Mues4 CDs ca. 5 h 16 min

© BÜCHERmagazin, Michael Knoll (kn)

Christian Krachts neuer Roman "Die Toten" bohrt sich in die Vergangenheit. Und findet Furcht und Schrecken
Manchmal, wenn man diesen Text sehr aufmerksam und völlig nüchtern liest, noch unberauscht und kaum beeindruckt von der Geschichte, den Figuren und der leicht verzögert eintretenden suggestiven Wirkung dieser Prosa, manchmal glaubt man hinter diesen Sätzen deren Autor zu sehen und zu hören, den längst auch aus dem Fernsehen bekannten Schriftsteller Christian Kracht, wie er grinst und kichert, womöglich auch mal lacht, laut und dreckig, über die Lektoren, die Kritiker, die Leser, die Fans, die ihm, da er eben allseits als sicherer Stilist bewundert wird, noch den schrecklichsten Stuss als fein gedrechselte Prosa abkaufen.
Manchmal, wenn man wieder ein paar sehr elegant geschriebene Absätze gelesen hat, meist im Tempo und im Rhythmus des späten Thomas Mann, felixkrullhaft leicht und ein bisschen redundant, mit einer absolut unmodernen Fülle von Adjektiven, die aber alle so präzise gewählt und so geschickt plaziert sind, dass immer offen bleibt, ob Christian Kracht hier seine Figuren verspottet oder vor allem sich selbst; und ob er mit dieser altmodischen Ironie sich seine Figuren und deren Schicksale nur deshalb vom Hals hält, weil er viel zu empfindsam ist, mehr Nähe zu verkraften - manchmal kommt dann wieder so ein schiefer, falscher, fast schon vulgärer Satz, dass man denkt: Das kann doch gar nicht sein, dass einem Autor wie Kracht solche Sätze unterlaufen sind. Aber wenn er sie geplant hat: Was ist das für ein Plan?
Das war ja schon in "Imperium", Krachts letzten Roman, die Frage: Warum der insgesamt so feingestimmten Prosa dieses Buchs ein so hässlicher, kaputter, völlig unbrauchbarer erster Satz im Weg stand. Als Warnung womöglich, dieser Sprache nicht jedes Wort zu glauben? Das ist im neuen Buch, das "Die Toten" heißt, noch heftiger: "Es war der nasseste Mai seit Jahrzehnten in Tokio; das schlierige Grau des bewölkten Himmels hatte sich seit Tagen in ein tiefes, tiefes Indigo verfärbt, kaum jemand vermochte sich jemals an derartig katastrophale Wassermengen zu erinnern; kein Hut, kein Mantel, kein Kimono, keine Uniform saß noch, wie sie sollte . . ." - der Satz ist noch lange nicht zu Ende, und schon hat er sich drei krasse Verstöße gegen die Regeln der Grammatik erlaubt: Und erst wenn man "Die Toten" zu Ende gelesen hat, glaubt man zu spüren, dass in der Form dieses ersten, absolut unironischen Satzes und in seinem Misslingen schon das Thema des ganzen Buchs gewissermaßen aufgehoben ist. Die Sehnsucht und die Anstrengung, in der Sprache nicht nur die Beschreibung, sondern den gültigen Ausdruck, ja die Wahrheit eines Gefühls zu finden. Und die Erkenntnis, dass das nur scheitern kann.
Das Buch erzählt von zwei Männern, einem Schweizer und einem Japaner, die, auch wenn sie hier Protagonist und Antagonist sind, sich erst auf Seite 167 treffen werden, im Tokio des Jahres 1932. Der Schweizer heißt Emil Nägeli, ist Filmregisseur und berühmt für Werke von geradezu heiliger Langeweile - und Alfred Hugenberg, der Besitzer der Ufa, hat ihn mit sehr viel Geld ausgestattet und nach Japan geschickt, damit er (den die Ufa kurzerhand ins deutsche Kino eingebürgert hat) dort einen Film drehe und den Japanern einen Eindruck von der Überlegenheit deutscher Filmkunst und deutscher Filmtechnik vermittle. Der Japaner heißt Masahiko Amakasu, ist hoher Beamter eines ungenannten Ministeriums, welches anscheinend für Japans Kultur und deren Selbstbehauptung zuständig ist, spricht Deutsch und kennt die deutsche Kultur und hat einen Brief an Hugenberg geschrieben, in welchem er die Deutschen um Beistand gebeten, ja sogar eine kinematographische Achse vorgeschlagen hat, weil man sich anders gegen die kommerzielle Überlegenheit der Amerikaner nicht wehren können werde. Zum Zeichen, wie ernst es ihm damit ist, hat Amakasu seiner Post einen kleinen Dokumentarfilm beigelegt; ein junger Offizier hat sepukku, den rituellen Selbstmord begangen, und die Kamera hat ihn durch ein Loch in der Wand beobachtet. Es ist eine Szene, die das Buch, gleich am Anfang, sehr genau beschreibt. Um eigentlich nicht mehr darauf zurückzukommen.
Was aber, als Trick und ästhetisches Verfahren, schon darauf hinweist, dass Kracht hier vom Kino nicht nur erzählt; dass sein Schreiben vom Kino hier geradezu durchdrungen ist. Der Satz, wonach ein Revolver, der im Text erwähnt wird, irgendwann einmal abgefeuert werden müsse, ist ja ein bisschen spießig und gilt eigentlich nur für Agatha-Christie-Romane. Ein Film dagegen, der in der ersten Szene in den Lauf einer Schusswaffe schaut oder ein Schwert sieht, das die Eingeweide des Selbstmörders durchschneidet, muss im Folgenden kein großes Drama daraus machen, wie es weitergeht mit dem Revolver, dem Schwert. Das Bild wird sich über die Wahrnehmung aller folgenden Bilder legen.
So scheint auch Kracht diese Anfangsszene zu meinen: Es geht, aller Ironie zum Trotz, immer um Leben und Tod in diesem Text. Er erzählt von seinen Figuren so, als wäre jeder Tag, den sie haben, nur dem aufgeschobenen Selbstmord abgerungen.
In einem insgesamt eher dämlichen Fernsehinterview hat Christian Kracht einen Satz gesagt, den man ihm gerne glauben mag: dass er gerne Filmregisseur geworden wäre; immerhin hat er ein paar Semester Film studiert in Amerika; und für "Finsterworld", den Film seiner Frau Frauke Finsterwalder, hat er das Drehbuch geschrieben. Früher, als die Schocks des Kinos neu waren, maß sich der Einfluss, den die neue Kunst auf das Schreiben hatte, an der Lakonie, der Ungerührtheit einer Sprache, die nur noch protokollieren, registrieren wollte, quasi wie eine Kamera: Aktion, Dialoge, Oberflächen. Kein Blick hinein in die Köpfe, keine Mitschrift von Gedanken und Gefühlen.
Kracht betreibt das genaue Gegenteil. Man kann ihm, zumindest was den ersten, längsten Teil des Buches angeht, gern vorwerfen, dass sein Stil hier einen Hang ins Gespreizte, Gekünstelte, Gesuchte habe. Man kann diesen Teil, der aufgebaut ist wie eine Parallelmontage im Film, Nägeli hier, Amakasu dort, wie sie wurden, was sie dann sind, wenn sie sich begegnen - man kann das aber auch so lesen, als kostete der Autor hier alles aus, was die Sprache kann, die Kamera aber nicht. Er schaut in die Köpfe hinein. Und erschrickt. Er kommentiert, suggeriert, lässt ironisch in der Schwebe, was im Film nur als Eindeutigkeit denkbar wäre. Und all die Adjektive, die vielen Adjektive, über die keine Kamera verfügen kann. In "bürgerlicher Symmetrie", schreibt Kracht, stünden die Tische in einem protestantischen Pfarrhaus.
Sie sind keine sympathischen Männer, Emil Nägeli und Masahiko Amakasu, der Autor selbst scheint sie nicht besonders zu mögen, seine Ironie wird eisig, wenn er die Schwächen, die Selbst- und die Weltverachtung beschreibt, Nägeli hat keine Idee von sich selbst und keine für den nächsten Film, nur einen lächerlichen Stolz auf längst überholte Werke seiner früheren Jahre, Amakasu hält sich für klüger als alle anderen und verachtet sich selbst für seine Einsamkeit. Den Kampf uns Eigene, um kulturelle Selbstbehauptung gegen die Übermacht Amerikas, den haben sie beide längst verloren gegeben. Charlie Chaplin, der eine wichtige Nebenrolle spielt in diesem Buch, tourt durch Japan, erobert das Publikum und demonstriert ganz lässig die Überlegenheit einer Kultur, der es nicht ums Eigene, schon gar nicht ums Heilige, sondern um dessen Gegenteil, das Profane, das Menschliche, das Allgemeine geht.
Und das war ja schon, unterschwellig zwar, aber doch deutlich spürbar, in "Imperium" das Motiv dafür, dass Kracht sich nicht nur mit seinen Sujets, sondern mit der Sprache, der Form, der ganzen geistigen Haltung hineinbohrt in eine Vergangenheit vor der Amerikanisierung, der Universalisierung und Globalisierung unserer Kultur. Es ist wohl so, dass Kracht, der Empfindsame, ein tiefes Unbehagen und einen Überdruss spürt an der Massenkultur der Gegenwart, was ja, wenn wir ehrlich sind, schon das wirkliche Thema von "Faserland" war. Es ist wohl auch so, dass er in der noch nicht amerikanisierten Vergangenheit der Sprache und des Denkens und Fühlens etwas sucht, eine Wahrheit und womöglich ein Glück, die er in der Gegenwart nicht finden kann. Aber das Bewundernswerte an dieser Suche ist der Umstand, dass Kracht weder sich selbst noch seine Leser belügt. Man kann nicht graben nach einer Hölderlinschen Schönheit, nach Thomas-Mannschem Geist. Und die Furcht, den Schrecken, die Unfreiheit einfach liegen lassen im Vergangenheitsschutt.
Es sind ja zwei Bohrungen, die Kracht hier versucht. Er schaut zurück auf die frühen Dreißiger. Und von dieser Zeit aus blendet der Text sich in die Kindheit seiner beiden Helden. Was so traurig ist, dass man manchmal heulen möchte, weil Kracht, das große, verrückte 49-jährige Kind, kaum etwas so gut skizzieren kann wie die Verrücktheit und die Sensibilität dieser beiden Jungs. Und das Erwachsenwerden als Vertrocknen und Verdorren. Es mag sein, dass ihm das eher unterlaufen ist, als dass er es so angelegt hätte - aber eine der besten Pointen seiner Erzählung ist doch die, dass Charlie Chaplin, der hier die amerikanische Kultur verkörpert, seine Überlegenheit dem Umstand verdankt, dass er Kind geblieben ist als Charlie, der Tramp und Clown und größte Star des amerikanischen Kinos.
Wenn die Erzählung in ihrer eigenen Gegenwart angekommen ist, wechselt Kracht den Tonfall und das Tempo, erzählt im Präsens, knapp und handlungsreich, filmisch möchte man fast sagen, und es ist spannend und schrecklich zugleich. Nägeli fährt nach Berlin, trifft Hugenberg, läuft Heinz Rühmann über den Weg, wird von Putzi Hanfstaengl, dem frühen Mentor Hitlers, in einen Stripteaseladen mitgenommen, macht dann die Nacht durch mit Lotte Eisner und Siegfried Kracauer, den Filmkritikern, mit denen der Text dann eine kleine Abschweifung macht, in den Zug, der sie nach Paris, ins Exil bringt, wo auch Fritz Lang schon im Speisewagen sitzt und eine Flasche Wein trinkt, und in einer der schönsten Passagen, der Zug ist schon auf französischem Terrain, beschimpft Lotte Eisner den deutschen Wald dafür, dass er so deutsch ist, lobt den französischen Wald dafür, dass er bloß Wald und kein mythischer Ort ist. Und dann ist Nägeli in Tokio, trifft Amakasu, der ihm die Freundin ausspannt. Und statt mit all dem deutschen Geld einen Riesenfilm zu drehen, besorgt sich Nägeli eine leichte Handkamera, filmt, was ihn gerade reizt und fasziniert. Und geht dann in Japan verloren.
Ach, Krachts neues Buch ist kein Thesenroman, dessen Botschaft sich so einfach auf den Satz bringen ließe, dass jene, die so dringend die eigene Kultur definieren und behaupten wollen, die Deutschen und die Japaner, ein paar Jahre später den Krieg und das Verbrechen als ihr Allereigenstes bestimmen. Dafür sind die Verhältnisse zu kompliziert, und zum Schluss hin fährt der Text mit dem Schiff nach Hollywood, das dem Autor, dem Leser und den Figuren des Textes auch wenig Trost zu bieten hat.
Nägeli aber taucht wieder auf und hat einen Film, so leicht und improvisiert, beweglich und bewegend, mitgebracht - sein Meisterwerk. Der Film, der hierfür das reale Vorbild war, wurde allerdings am Wannsee gedreht, er heißt "Menschen am Sonntag", ist sehr deutsch und sehr schön und wahrhaftig. Seine Schöpfer, Billy Wilder, Edgar Ulmer, Fred Zinnemann und Eugen Schüfftan sind dann auch nach Hollywood gegangen. Und haben dort ihre nächsten Filme gemacht. Sehr amerikanisch und sehr schön.
CLAUDIUS SEIDL
Christian Kracht: "Die Toten", Kiepenheuer und Witsch, 212 Seiten, 20 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Kracht schreibt das kristallklarste Deutsch seit Gottfried Benn.« STERN
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Zum "raffinierten Realismus" adelt Moritz Baßler die kontrastreiche Prosa Christian Krachts, der komplex und doch süffig Fakten und Fiktion mische, den "Glauben ans Unechte" mit der Liebe zum obskuren Detail verbinde und dabei auch noch alle Gegenstimmen zu Wort kommen lasse. Für Baßler ist das große Kunst und vor allem ein Kontrapunkt zu dem, was er als den "banalen Realismus" der Nachkriegsliteratur brandmarkt. Wem dagegen der literaturgeschichtlich und popkulturell aufgeladene Plot um Nazis und Film, Japan und Seppuku in den dreißiger Jahren nicht geheuer ist, der verwechsele Literatur mit Identitätspolitik, bescheidet Baßler möglichen Verächtern. Kracht nämlich verweigere dem Wirklichen das Anrecht auf die Sprache, stellt der Kritiker klar, der dies auch "links-politisch-korrekten" oder "pegidesk-empörten" Lesern empfiehlt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH