Nicht lieferbar
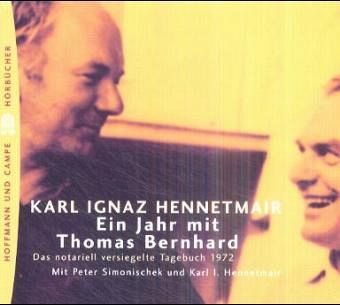
Ein Jahr mit Thomas Bernhard
Das notariell versiegelte Tagebuch 1972. Auswahl. Hörstück. 120 Min.
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Ein Jahr mit Thomas Bernhard
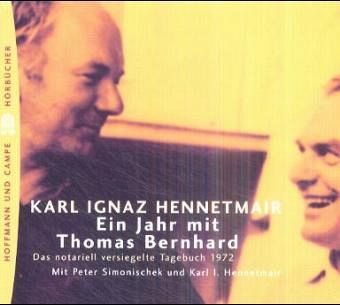
Das notariell versiegelte Tagebuch 1972. Auswahl. Hörstück. 120 Min.
Rechnungen
Bestellstatus
Retourenschein
Storno