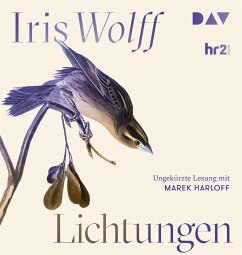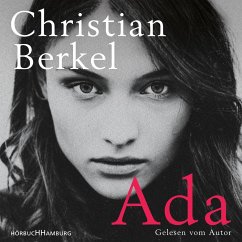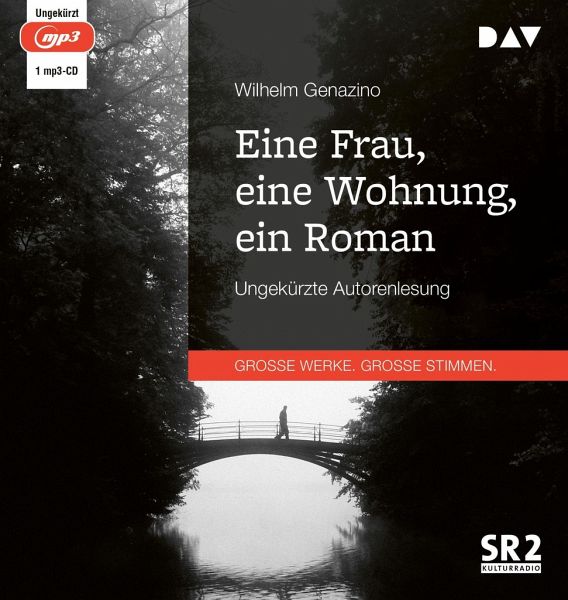
Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman
Ungekürzte Autorenlesung (1 mp3-CD), Lesung. 284 Min.
Gesprochen: Genazino, Wilhelm
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
15,45 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!
Mit ironischem Blick auf die Sechzigerjahre beschreibt Genazino den Weg eines jungen Mannes: Weigand, der siebzehnjährige Ich-Erzähler ohne Vornamen, der wegen schlechter Noten vom Gymnasium fliegt und der Mutter zuliebe eine Lehrstelle bei einer Spedition annimmt. Eigentlich träumt Weigand aber von einem Leben als Schriftsteller. Und so beginnt er ein Doppelleben, angetrieben von drei Dingen, die es für ihn im Leben braucht: eine Frau, eine Wohnung und einen selbst geschriebenen Roman. Gelesen vom Autor selbst, haftet seiner Geschichte eine charmante Beiläufigkeit an.Ungekürzte Autorenl...
Mit ironischem Blick auf die Sechzigerjahre beschreibt Genazino den Weg eines jungen Mannes: Weigand, der siebzehnjährige Ich-Erzähler ohne Vornamen, der wegen schlechter Noten vom Gymnasium fliegt und der Mutter zuliebe eine Lehrstelle bei einer Spedition annimmt. Eigentlich träumt Weigand aber von einem Leben als Schriftsteller. Und so beginnt er ein Doppelleben, angetrieben von drei Dingen, die es für ihn im Leben braucht: eine Frau, eine Wohnung und einen selbst geschriebenen Roman. Gelesen vom Autor selbst, haftet seiner Geschichte eine charmante Beiläufigkeit an.Ungekürzte Autorenlesung mit Wilhelm Genazino1 mp3-CD ca. 5 h 36 min