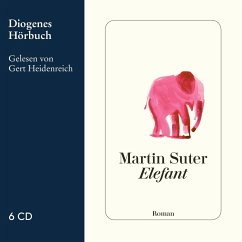Ein Wesen, das die Menschen verzaubert: ein kleiner rosaroter Elefant, der in der Dunkelheit leuchtet. Plötzlich ist er da, in der Höhle des Obdachlosen Schoch. Wie das seltsame Geschöpf entstanden ist und woher es kommt, weiß nur einer: der Genforscher Roux. Er möchte eine weltweite Sensation daraus machen. Allerdings wurde es ihm entwendet. Denn es gibt auch Leute, die es beschützen wollen, etwa der burmesische Elefantenflüsterer Kaung.

Wie man einem Elefanten die Prostata massiert: Martin Suter stellt im ausverkauften Schauspiel Frankfurt seinen neuen Roman vor.
Von Florian Balke
Der Titelheld ist klein, der Erfolg des Romans groß. Nicht einmal drei Kilo wiegt das Tier, von dem Martin Suter in "Elefant" erzählt, erst seit drei Wochen ist das Buch auf dem Markt und schon führt es die Bestsellerliste des "Spiegels" an. "Ich fühle mich prima", sagt Suter im Schauspiel Frankfurt. Vermutlich auch, weil die Sitzreihen vor ihm bis auf den letzten Platz gefüllt sind. Aber das mit den ausverkauften Häusern kennt er schon. Und das mit den Spitzenplätzen auch: "Ich versuche, mich nicht daran zu gewöhnen."
Gut geht es mit Suter vorne auf der Bühne aber auch dem Publikum. Denn der Autor tut alles dafür, dass seinen Büchern ihr gewohnter Erfolg erhalten bleibt, auch wenn er bisher nie über tapfere kleine Zwergelefanten mit rosafarbener Haut geschrieben hat, deren Erbmaterial ein böser Gentechniker so manipuliert hat, dass sie auch noch im Dunkeln leuchten. Dass Leuchten stammt aus den Erbanlagen der Glühwürmchen, das Rosa aus den Genen, die für die Hautpigmentierung des Mandrills zuständig sind. Suter versorgt seine Leser aber nicht nur mit unterhaltsamem Stoff zum Nachdenken, sondern achtet auch live darauf, dass sie bekommen, was sie wollen. Darüber, wie bewusst dosiert er dem allgemeinen Bedürfnis nach Spannung und Humor entgegenkommt, war an diesem Abend einiges zu erfahren, gerade weil die charmant nachfragende ZDF-Moderatorin Petra Gerster ihrem Gesprächspartner alles Persönliche immer wieder mühsam abringen musste.
Denn in die Karten schauen lässt Suter sich gar nicht gerne. Die Gentechnik? Ist für ihn Fluch und Segen zugleich. Wäre ein süßer kleiner rosa Elefant wie der im Buch für ihn in Wirklichkeit eine moralische Grenzüberschreitung? Suter spricht lieber über die Mini-Schweine, die es in China schon gebe. Hat er beim Schreiben eine Lieblingsfigur gehabt? "Das ist eine Frage, die ich mir nie stelle." Die emotionale Bindung der Buchkäufer an Suters Werk wirkt an diesem Abend gelegentlich größer als die des Autors.
Mag sein, das ist nicht mehr ist als die Reserviertheit des schnell denkenden, aber überaus bedächtig formulierenden Schweizers. Aber da sind weitere Signale der Kühle. Auf die Idee zum "Elefanten" kam Suter vor zehn Jahren bei einem Besuch in Mathias Juckers Hirnforschungsinstitut in Tübingen. Jucker sagte ihm damals, bald sei die Herstellung eines winzigen rosa Leuchtelefanten kein Problem mehr. "Das wäre doch ein hübsches Spielzeug für saudische Prinzenkinder", dachte Suter sich und beschloss, über das Tierchen irgendwann zu schreiben. Auch aus einem anderen Grund allerdings, den er erst später erwähnt: "Ich habe natürlich schon gedacht, dass es ein bisschen drastischer ist, wenn es ein entzückendes Wesen ist und kein Frankenstein."
Suter ist berechnend und weiß es. Und seine Leser wissen es auch. "Er hat es faustdick hinter den Ohren", sagt der Mann auf dem Nebensitz. Den Zuhörern gefällt die kühle Gleichmütigkeit, mit der Suter beschreibt, wie der böse Genforscher Roux der Laborratte Miss Playmate einen Teil der Eierstockrinde einer in Sri Lanka ums Leben gekommenen jungen Elefantenkuh einsetzt, damit die Eizellen in der Ratte heranreifen und er sie für seine Experimente verwenden kann. Sie bewundern ihn für das diebische Vergnügen, mit dem er vorträgt, wie ein junger Mann in Schürze und Handschuhen hinter einen Elefantenbullen tritt, dem Tier beherzt den Dung aus dem Enddarm entfernt und anschließend ungerührt damit beginnt, ihm zur Entnahme seines Samens die Prostata zu massieren. Mit dem gewünschten Erfolg.
Wie er seinem Publikum die Körperstellen massiert, an denen es sich für das Kaufen eines seiner Bücher entscheidet, weiß Suter auch. "In diesem Buch ist nichts Zufall", sagt er und grinst. Der Saal lacht wissend. An E. T. A. Hoffmann, fügt Suter hinzu, schätze er, wie dieser nichts passieren lasse, wenn man etwas erwarte, und viel passieren lasse, wenn man nicht damit rechne. Bei ihm tritt zur kühlen Sicherheit der Ausführung daher die Wärme des Sentiments. Niedlich ist der kleine Elefant, nett der Obdachlose, dem das Tier begegnet. "Immer die Kleinen", sagt Gerster einfühlsam. "Genau", sagt Suter. Die gebrochenen Charaktere habe er wohl lieber? "Da haben Sie mich durchschaut." Auch da lachen die Zuhörer. Nichts ist schöner als das Einverständnis von Fans und Stars über das Befolgen von Erfolgsrezepten.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Martin Suter gilt als Meister einer eleganten Feder, die so fein geschliffen ist, dass man die Stiche oft erst hinterher spürt.«