Nicht lieferbar
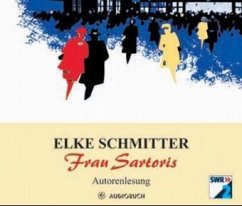
Frau Sartoris
Gelesen von der Autorin. Gekürzte Fassung. 210 min.
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Frau Sartoris lebt in der Provinz, ist verheiratet und hat eine Tochter. Alles geht seinen gewohnten Gang. Das höchste Ziel ist Gemütlichkeit. Doch eines Tages verliebt sich Margarete Sartoris in einen anderen Mann. Diese Amour fou ist bald schon mehr als nur eine Flucht. Sie soll der endgültige Aufbruch zu einem neuen Leben sein.



