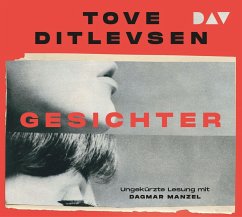Kopenhagen, 1968: Lise Mundus, Kinderbuchautorin und Mutter dreier Kinder, entgleitet ihr Alltag. Sie meint, Stimmen zu hören und Gesichter zu sehen. Sie ist überzeugt, dass ihr Mann sie verlassen wird, vor allem aber hat sie Angst, dass sie nie wieder schreiben wird. Als sie in die Klinik geht und sich behandeln lässt, beginnt sie sich zu fragen, ob Wahnsinn wirklich etwas ist, wovor sie sich fürchten muss - oder ob er nicht auch eine Form von Freiheit für sie bereithält. In »Gesichter« macht Ditlevsen die Verschiebungen in der Wahrnehmung einer Frau, die seelisch erkrankt, meisterlich erfahrbar.Ungekürzte Lesung mit Dagmar Manzel4 CDs ca. 4 h 38 min

Die dänische Autorin Tove Ditlevsen kämpfte ihr Leben lang mit Abhängigkeiten. Besonders intensiv erzählt sie davon in ihrem neu aufgelegten Psychiatrie-Roman "Gesichter".
Stellen Sie sich vor: Es ist das Ende eines langen Arbeitstages. Sie kommen nach Hause, essen, waschen sich. Kurz vor der Nachtruhe fehlt ein letzter Schritt: Sie nehmen Ihr Gesicht ab, legen es auf die Kleidung, "denn Gesichter mussten sich ausruhen und waren beim Schlafen auch nicht dringend notwendig". In Tove Ditlevsens bekanntestem Roman "Gesichter" ist dieses Bild noch das sanfteste, mit dem Gesichter beschrieben werden. Ansonsten werden sie verschlissen, verschludert, den Toten gestohlen.
"Gesichter" erschien 1968 in Dänemark und behandelt die Psychose einer Frau, die vermeintlich alles hat: einen Beruf, der gleichzeitig Berufung ist, Prestige, eine Familie. Als Schriftstellerin sitzt sie nicht nur in einem Zimmer für sich allein, sondern hat eine große Wohnung samt Haushälterin. Doch das, was sie hat, entgleitet ihr: Lises Mann Gert trauert, weil seine Geliebte sich umgebracht hat. Der literarische Erfolg ist ihr lediglich in der Frauen- und Kinderliteratur vergönnt. Die Gesichter geliebter Menschen verzerren sich zu Fratzen. Und der einzige Ort, der ein wenig Freiheit verheißt, ist die Psychiatrie - eine Überdosis Tabletten bringt sie dorthin.
Kunst gegen Depression, Selbstbestimmung gegen Norm: In Tove Ditlevsens "Gesichter" klingt Sylvia Plaths "Die Glasglocke" an. Und tatsächlich finden sich Parallelen zwischen der Amerikanerin und der Dänin. Beide schicken ihre Protagonistinnen nach einem Suizidversuch in eine psychiatrische Einrichtung. Beide erkunden in ihren Texten die Möglichkeiten des Schreibens inmitten männlicher Dominanz. Beide Autorinnen entlassen ihre Protagonistinnen hoffnungsvoll aus ihren Romanen - und sterben später selbst durch Suizid. Doch wo "Die Glasglocke", ähnlich wie Ditlevsen in vielen anderen Werken, kühl von emotionalen Verwerfungen erzählt, entzieht sich "Gesichter" jeder Klarheit.
Fragmentiert und verstörend berichtet der Roman von der Krankheit einer Frau und der Gesellschaft, die sie hervorgebracht hat. Lise befürchtet, ihr Mann sei in seine Stieftochter verliebt, ihre Haushälterin in ihren Sohn. Sie sieht ihr Bett in Flammen stehen, wird angeblich vergiftet - oder stimmt das doch? Das Nachwort zu "Gesichter" informiert darüber, dass das Vorbild für die Figur des Psychiaters von Lise Einar Geert-Jørgensen ist, der in den 1960ern LSD-Versuche an unwissenden Patientinnen durchgeführt hat. Mindestens genauso unheimlich wie die Gedanken und Gesichter sind die Stimmen. Lise hört die gehässigen Kommentare derjenigen, die ihr im Leben eigentlich am nächsten stehen. Flüchten kann sie vor ihnen nicht, sie lauern ihr im Kopfkissen und in den Abwasserrohren auf.
Einmal hört Lise Gert schimpfen: "Du schreibst in einer Sprache, die nur von fünf Millionen Menschen gesprochen wird. Sätze in dieser Sprache zu bilden, ist dir so wichtig, dass sich alles andere deiner perversen Leidenschaft unterordnen muss." Diese Kritik erweist sich in der Wirklichkeit und mit der Zeit als unwahr: Das Werk der 1917 in Kopenhagen geborenen Autorin erlebt derzeit nicht nur in Deutschland eine Renaissance. Ditlevsens Texte werden in 30 Sprachen übersetzt, hierzulande veröffentlicht der Aufbau Verlag ihre wichtigsten Werke teils zum ersten Mal auf Deutsch. Ursel Allenstein hat "Gesichter" neu übertragen und schließt damit an ihre Erstübersetzungen der viel besprochenen "Kopenhagen-Trilogie" an - die ernüchternde Zusammenfassung von Ditlevsens ersten rauschhaften Jahren. Unterteilt ist die Trilogie in die drei autofiktionalen Bände "Kindheit", "Jugend", "Abhängigkeit".
Sie erzählt darin schnörkellos von ihrem Aufwachsen im Arbeiterviertel Vestebro, dem Beginn ihrer schriftstellerischen Karriere und Beziehungen zu Männern. Dabei hält sie eine schwierige Balance: Weder zwängt sie sich rückblickend den naiven Ton eines Mädchens auf, noch sanktioniert sie die Verletzlichkeiten ihres frühen Ichs. Ditlevsens Erinnerungen stehen für sich. Vater Ditlev ist ein so flammender wie enttäuschter Sozialist. Arbeit hat er nur selten. Die junge Mutter Alfrida empfindet ihr Leben als verpfuscht und verbittert infolgedessen in Rekordzeit. Liebe gibt sie ihren Kindern nicht. Tove flüchtet aus der Enge und Einsamkeit in die Welt der Sprache. Als ihr älterer Bruder Edvin ihr Poesiealbum findet, bricht er zuerst in Gelächter aus, dann in Tränen. Statt Phantasie im Kopf hat er giftige Fabrikdämpfe in der Lunge.
Doch Vorstellungskraft allein begleicht keine Rechnungen. Alles Flehen der Lehrerin ist vergebens: Ihre Eltern schicken Tove auf keine weiterführende Schule. Früh fängt sie an, als Hausmädchen oder Schreibkraft Geld zu verdienen, und doch: Nach "Kindheit" und "Jugend" kommt "Abhängigkeit", dann nichts mehr. Im Dänischen trägt der Abschluss der Trilogie den Titel "Gift", zu Deutsch sowohl die toxische Substanz als auch das Wort "verheiratet", und suggeriert ein Dilemma:
Wer als Frau - egal, wie brillant - kaum Bildung genießt, muss heiraten. Wer verheiratet bleiben will, findet zwischen häuslichen Verpflichtungen selten Platz für die eigenen Ambitionen. Vier Mal war Ditlevsen verheiratet, Scheidungen schmerzen sie oft weniger als die Absage eines Literaturmagazins. Trotzdem fühlt sie sich in ihrer Jugend wie ein "herrenloser Hund (...), struppig, verwirrt und allein". Dass ein Hund keine Leine brauchen könnte, scheint undenkbar. Das dürfte heute, in Dänemark wie in Deutschland, anders sein. Warum treffen Ditlevsens Texte im Jahr 2022 also so einen Nerv?
Erstens liegt Ditlevsens Genre im Trend: Neben Lyrik schrieb sie vor allem Autofiktion. Das Mantra, dass, wer im Text "Ich" sagt, nie die Person an der Tastatur meint, löst sich hier auf. Die Bücher von Annie Ernaux, Sheila Heti, aber auch Karl Ove Knausgård zeichnen sich dadurch aus, dass sie erkennbar in einer Realität des Schreibenden verankert sind. So auch bei Ditlevsen. Angaben überlappen sich, sogar "Gesichter" kann autobiographisch gelesen werden. Der Roman ist, anders als die Kopenhagen-Trilogie, in der dritten Person geschrieben, ist bildstark, beweglich: Nicht nur Gesichter lösen sich wie "eine alte Tapete", auch Gedanken werden eingefangen "wie Vögel, die man in einen Käfig lockt". Lise Mundus trägt den Mädchennamen von Ditlevsens Mutter. Mit den Gedichten, die im Buch als Lises Schöpfung dargestellt werden, ist Ditlevsen selbst berühmt geworden. Wie ihre Protagonistin litt die Autorin seit ihrer Jugend unter Psychosen.
Das buchstabiert sie in der Kopenhagen-Trilogie nicht aus. Autofiktion weicht mitunter von Fakten ab. So erinnert sich Ditlevsen in "Kindheit" an die Berichterstattung über den Versailler Vertrag - und auch wenn sie ein begabtes Kind war, ist das für eine 1917 Geborene unmöglich. Doch das macht ihre Erzählung nicht weniger glaubhaft. Vielmehr verdeutlicht diese Passage die Fragilität und Konstruktion der eigenen Erinnerung. Sie zeigt: Interessant ist an Autofiktion nicht, ob sie mit der Realität lückenlos übereinstimmt, sondern wie sie diese reflektiert.
Wie Ernaux schreibt Ditlevsen über Ehe, abgebrochene Schwanger- und Mutterschaften und wie das kreative Schreiben sich dazu verhält. Was als privates Bekenntnis daherkommt, erlaubt größere Schlüsse darauf, wie Geschlecht, psychische Krankheiten und Klasse das Leben einer Person in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext bestimmen. Dass Ditlevsen heute so gelesen wird, ist ebenfalls eine Frage politischer Konstellationen: In der Rezeption zu Sylvia Plaths "Glasglocke" etwa trat die Literaturkritik oft hinter sensationalistischen Berichten im Lichte eines tragischen Todes zurück.
Doch ein politisch relevantes Thema allein macht noch keine gute Literatur. Ditlevsen ist spannend, weil sie den Strukturen in ihrem Leben mit Ambivalenz und Menschlichkeit begegnet. Man kann in doppelter Hinsicht sagen, dass ihre Bücher von einer Frau handeln, die "es geschafft hat". Einerseits hatte sie, als sie 1976 mit 59 Jahren starb, 29 Bücher veröffentlicht und war eine der bekanntesten Autorinnen Dänemarks. Gleichzeitig ließ sie jederzeit durchscheinen, wie sehr dieses Leben wiederum sie geschafft hat.
Was die Kopenhagen-Trilogie andeutete, bringt "Gesichter" auf den Punkt. Dass Abhängigkeit und Autonomie zwei Seiten derselben, sich drehenden Münze sind, die kurz vor dem Fall schlingert. Und dieses Schlingern schaut sie sich ausgiebig und ehrlich an: Die Tatsache, dass die politischen Umwälzungen der 1960er sie nicht interessieren, dass die Stimmen aus dem Abfluss recht haben könnten, dass sie schreiben und dafür, aber nicht nur dafür geliebt werden will. Ihre tatsächliche Medikamentensucht mal ausgenommen - da gibt es nichts zu romantisieren -, liegt die Tragik in Ditlevsens Leben und Schreiben auch darin, wie unvereinbar ihre Abhängigkeiten sind.
Als Lise die Psychiatrie zum Ende des Romans verlässt, ist einer ihrer ersten Gedanken: "Morgen würde sie anfangen zu schreiben und sich um ihre Kinder kümmern." Ditlevsen wollte immer alles, und dann bekam sie es. Dass diese Erfüllung nicht vor den Verletzungen des Lebens schützt, dass Menschen ungeachtet aller Erfolge herrenlose Streuner bleiben können, beschreibt sie dabei so präzise wie niemand sonst.
SUSANNE ROMANOWSKI
Tove Ditlevsen: "Gesichter". Roman. Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein. Aufbau Verlag, 160 Seiten, 20 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Die Zeit für dieses Buch ist jetzt reif.« The Guardian »Von atemberaubender Intensität und Schönheit.« Elke Heidenreich
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Sophie Wennerscheid entdeckt gespannt einen weiteren Roman der dänischen Autorin Tove Ditlevsen, der sich ganz anders lese als ihre erfolgreiche Kopenhagen-Trilogie. Es geht um die Kinderbuchautorin Lise Mundus, die unter starken psychotischen Wahnvorstellungen leidet und ihre Welt nur noch als Bedrohung wahrnimmt: Alle haben sich gegen sie verschworen, ihr untreuer Ehemann, ihre Tochter, das Hausmädchen, deren Gesichter sich dabei absonderlich verformen. Dem vor allem von männlichen Kritikern geäußerten Vorwurf, Ditlevsens Literatur sei "schlicht", kann Wennerscheid sich im Grunde nicht anschließen - so könne man etwa die vielen Vergleiche nicht nur als literarische Schwäche, sondern auch als Versuch der erzählenden Protagonistin lesen, ihre Umgebung irgendwie sinnfällig zu ordnen. Auch in den "szenischen" Passagen glänzt die Autorin, findet Wannerscheid, und die Beschreibung der "Ver-rücktheit" einer psychotischen Wahrnehmung berührt sie. Auch dafür, dass die Autorin in einen "ironischen Hieb" gegen die Literaturkritik und vor allem die dänische Literaturakademie austeilt und selbstbewusst Rilke- oder Baudelaire-Referenzen streut, erntet sie Anerkennung bei der Kritikerin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH