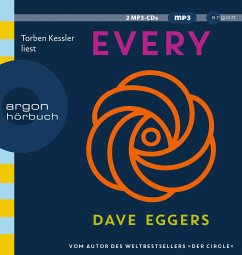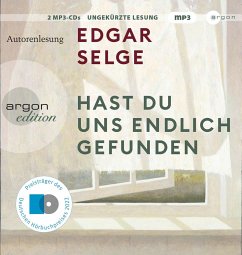Sven Regener
MP3-CD
Glitterschnitter (Restauflage)
Roman. 629 Min.. Lesung. Ungekürzte Ausgabe
Gesprochen: Regener, Sven
Sofort lieferbar
UVP: 24,00 €**
Als Restexemplar::
Als Restexemplar::
**Frühere Preisbindung aufgehoben
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Neue Bücher, die nur noch in kleinen Stückzahlen vorhanden und von der Preisbindung befreit sind. Schnell sein!





Willkommen in der Welt von Glitterschnitter: Ein großer, wilder Roman über Liebe, Freundschaft, Verrat, Kunst und Wahn in einer seltsamen Stadt in einer seltsamen Zeit.Die Lage ist prekär: Charlie, Ferdi und Raimund wollen mit Glitterschnitter den Weg zum Ruhm beschreiten, aber es braucht mehr als eine Bohrmaschine, ein Schlagzeug und einen Synthie, um auf die Wall City Noise zu kommen. Wiemer will, dass H. R. ein Bild malt, aber der will lieber eine Ikea-Musterwohnung in seinem Zimmer aufbauen. Frank und Chrissie wollen die alte Trinkerstube Café Einfall zur kuchenbefeuerten Milchkaffeeh�...
Willkommen in der Welt von Glitterschnitter: Ein großer, wilder Roman über Liebe, Freundschaft, Verrat, Kunst und Wahn in einer seltsamen Stadt in einer seltsamen Zeit.
Die Lage ist prekär: Charlie, Ferdi und Raimund wollen mit Glitterschnitter den Weg zum Ruhm beschreiten, aber es braucht mehr als eine Bohrmaschine, ein Schlagzeug und einen Synthie, um auf die Wall City Noise zu kommen. Wiemer will, dass H. R. ein Bild malt, aber der will lieber eine Ikea-Musterwohnung in seinem Zimmer aufbauen. Frank und Chrissie wollen die alte Trinkerstube Café Einfall zur kuchenbefeuerten Milchkaffeehölle umgestalten, aber Erwin will lieber einen temporären Schwangerentreff etablieren. Chrissie will, dass Kerstin endlich zurück nach Stuttgart geht, aber die muss erst noch Chrissies neuen Schrank an der Wand befestigen. Die Frage, ob Klaus zwei verschiedene Platzwunden oder zweimal dieselbe Platzwunde zugefügt wurde, ist noch nicht abschließend geklärt, aber bei den Berufsösterreichernder ArschArt-Galerie werden bereits schöne Traditionen aus der Zeit der 1. Ottakringer Shakespeare-Kampfsportgesellschaft wiederbelebt.
Die Lage ist prekär: Charlie, Ferdi und Raimund wollen mit Glitterschnitter den Weg zum Ruhm beschreiten, aber es braucht mehr als eine Bohrmaschine, ein Schlagzeug und einen Synthie, um auf die Wall City Noise zu kommen. Wiemer will, dass H. R. ein Bild malt, aber der will lieber eine Ikea-Musterwohnung in seinem Zimmer aufbauen. Frank und Chrissie wollen die alte Trinkerstube Café Einfall zur kuchenbefeuerten Milchkaffeehölle umgestalten, aber Erwin will lieber einen temporären Schwangerentreff etablieren. Chrissie will, dass Kerstin endlich zurück nach Stuttgart geht, aber die muss erst noch Chrissies neuen Schrank an der Wand befestigen. Die Frage, ob Klaus zwei verschiedene Platzwunden oder zweimal dieselbe Platzwunde zugefügt wurde, ist noch nicht abschließend geklärt, aber bei den Berufsösterreichernder ArschArt-Galerie werden bereits schöne Traditionen aus der Zeit der 1. Ottakringer Shakespeare-Kampfsportgesellschaft wiederbelebt.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Sven Regener ist Musiker (Element of Crime) und Autor von: Herr Lehmann (2001), Neue Vahr Süd (2004), Der kleine Bruder (2009), Meine Jahre mit Hamburg-Heiner (2011), Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt (2013) und zuletzt Wiener Straße (2017). Seine Bücher sind allesamt als ungekürzte Autorenlesungen bei tacheles! erschienen. Sven Regener ist Musiker (Element of Crime) und Autor von: Herr Lehmann (2001), Neue Vahr Süd (2004), Der kleine Bruder (2009), Meine Jahre mit Hamburg-Heiner (2011), Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt (2013) und zuletzt Wiener Straße (2017). Seine Bücher sind allesamt als ungekürzte Autorenlesungen bei tacheles! erschienen.

© Charlotte Goltermann
Produktdetails
- Verlag: Roof Music
- Anzahl: 2 MP3-CDs
- Gesamtlaufzeit: 629 Min.
- Erscheinungstermin: 10. September 2021
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783864846977
- Artikelnr.: 66302039
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Da kann
jeder mitmachen
Sven Regener kehrt in „Glitterschnitter“ mal wieder
ins Westberlin der 80er-Jahre zurück
VON VERENA MAYER
Sven Regener wäre gern in die Ankerklause gegangen. Die Ankerklause ist eine Kneipe, die eingerichtet ist wie ein Schiff und in jenem Teil von Kreuzberg liegt, in dem die Figuren aus Regeners Romanen unterwegs sind. Außerdem war die Ankerklause eines der ersten Lokale im alten Westberlin, in denen man Kaffee mit geschäumter Milch bekam, und zwar in diesen weißen Schüsseln, wie in Paris. Das ist wichtig, weil in Regeners neuem Buch der Milchkaffe zu einer Art Dingsymbol wird. Die einen wollen ihn konsumieren, die anderen versuchen, sich eine Existenz damit aufzubauen. So wie
jeder mitmachen
Sven Regener kehrt in „Glitterschnitter“ mal wieder
ins Westberlin der 80er-Jahre zurück
VON VERENA MAYER
Sven Regener wäre gern in die Ankerklause gegangen. Die Ankerklause ist eine Kneipe, die eingerichtet ist wie ein Schiff und in jenem Teil von Kreuzberg liegt, in dem die Figuren aus Regeners Romanen unterwegs sind. Außerdem war die Ankerklause eines der ersten Lokale im alten Westberlin, in denen man Kaffee mit geschäumter Milch bekam, und zwar in diesen weißen Schüsseln, wie in Paris. Das ist wichtig, weil in Regeners neuem Buch der Milchkaffe zu einer Art Dingsymbol wird. Die einen wollen ihn konsumieren, die anderen versuchen, sich eine Existenz damit aufzubauen. So wie
Mehr anzeigen
die Mitarbeiter einer heruntergerockten Kiezkneipe, die mit Milchkaffee endlich mal mehr Publikum anziehen wollen.
Allerdings hat die Ankerklause an diesem Spätsommermorgen zu, und auch sonst machen viele Läden in Kreuzberg derzeit erst spätnachmittags auf. Ihnen fehlen die Servicekräfte, die sich wegen der Pandemie etwas anderes suchen mussten. Also ein Treffen im Café Einstein, ebenfalls eine Westberliner Institution. Sven Regener, schwarzes Outfit, schwarze Hornbrille, bestellt, nun ja, Milchkaffee und erzählt, wie er selbst die Corona-Zeit verbracht hat. In der „Pseudoarbeitslosigkeit“ nämlich, weil er mit der Band Element of Crime, seinem ersten künstlerischen Standbein, nicht mehr auftreten konnte. Aber er sei „ein manischer Typ“ und habe dann wieder ein Buch geschrieben. Das heißt „Glitterschnitter“ und bringt einen mit alten Bekannten aus früheren Romanen zusammen. Da sind die vor sich hinwurstelnden Künstler H.R. Ledigt und Karl Schmidt, die jetzt mit einem großformatigen Ölbild beziehungsweise einer Band namens Glitterschnitter (Motto: „Wer übt, ist feige“) ihr Glück versuchen. Da sind Chrissie aus Stuttgart und ihr Onkel Erwin, der nicht einsieht, warum er in seiner Kneipe plötzlich Milchkaffee ausschenken soll statt Flaschenbier. Und da ist natürlich Frank Lehmann, „Ex-Speditionskaufmann, Ex-Bremer, Ex-Wehrpflichtiger, Ex-Selbstmordvortäuscher“. Man kennt ihn seit Regeners Debüt „Herr Lehmann“ (2001), das zum Bestseller und später von Leander Haußmann verfilmt wurde.
Auch das Setting ist wieder dasselbe wie in früheren Regener-Romanen, der Kreuzberger Kiez in den Achtzigerjahren nämlich. Das alte Westberlin beziehungsweise „die Stadt mit einer Mauer drumherum“, wie es bei Regener heißt, wird in Film und Literatur schon seit einiger Zeit als eine Art deutsches Utopia beschworen. Der Kabarettist Rainald Grebe hat in der Schaubühne ein Westberlin-Musical herausgebracht, Oskar Roehler beschrieb in seinem Roman „Mein Leben als Affenarsch“ die Mauerstadt als Ort, der gleichzeitig kaputt und beseelt ist. Der Dokumentarfilm „B-Movie: Lust and Sound in Westberlin 1979 – 1989“ setzt schließlich der damaligen Szene und ihren Treffpunkten ein eindrucksvolles Denkmal mit Archivaufnahmen von Nick Cave, David Bowie oder Martin Kippenberger beim Partymachen, einmal sieht man Tilda Swinton an der Mauer vorbeiradeln.
Und das ist ja auch kein Wunder. Westberlin war die Stadt, in der man einmal im Monat für den Lebensunterhalt kellnerte und sonst frei war zu tun, was man wollte. In der die Subventionen flossen, die Mieten spottbillig waren, und wer kein Haus hatte, besetzte eben eines. Vor allem aber waren auch alle dort, und auf die fiel das Licht der internationalen Aufmerksamkeit, oder wie es Regener ausdrückt: Westberlin war wie „von einer riesigen Glühbirne“ angestrahlt.
Der gebürtige Bremer hat selbst in diesem Umfeld angefangen. „Ich bin als Musiker mit einer Trompete hingekommen und konnte überall mitspielen“. Das „schrägste Zeug“ habe Aufmerksamkeit bekommen, weil man es als Ermutigung genommen habe: Wenn so etwas geht, geht noch viel mehr. „Es gibt immer so Phasen des Anything goes, in denen alles explodiert und etwas Neues entsteht“, sagt Regener, „dieser Punkrock-Ansatz: Natürlich kann der nicht Bass spielen, aber er macht es doch ganz okay, und egal, was du machst, mach es einfach.“ Irgendwann enden diese Phasen, nicht zuletzt weil sie ganz schön anstrengend sind. Aber in der Rückschau entstehen jene Projektionen, mit denen Regener inzwischen sechs Romane bestreiten konnte. Er finde es faszinierend, sich an die Zeit zu erinnern, daran, mit welcher Wildheit und Wut die Leute gerade im Kunstbereich agiert haben, sagt Regener. Aber er wehrt sich dagegen, von Westalgie angetrieben zu sein. Er habe einfach ein Gefühl für die Personen und die Zeit, und die würden sich anbieten, „weil man damit alles erzählen kann“. Geschichten von Liebe, Verrat, Sehnsucht und Enttäuschungen. Vor allem aber wolle er von Menschen Anfang zwanzig erzählen, über diese „Twilight-Zone des Lebens“ und eine ganz bestimmte Art der Unruhe, wenn man in einer Welt klarkommen will, deren Regeln man nicht gemacht hat und die man noch nicht durchschaut. Und in der man immer das Gefühl hat, etwas zu verpassen. Diese Themen lösen sich in „Glitterschnitter“ allerdings fast so schnell auf wie Zucker im Milchkaffee. Das liegt einerseits an der Menge der Figuren, die in Regeners Welt unterwegs sind, Menschen, die Michael 1, Jürgen 3, Kacki, Fräulein Mariandl, Wiemer, Sigi, Enno, Helga, Martha, Sybille oder Nachbar Marko heißen, irgendwo herumsitzen, in einem Plenum etwas sagen (wir sind in Kreuzberg) oder einfach Heimweh haben wie die zahlreichen Österreicher, die neuerdings hier herumschwirren. Regener ist inzwischen auch formal beim Westberliner Lebensgefühl angekommen: Jeder kann mitmachen.
Zum anderen liegt das daran, dass in „Glitterschnitter“ extrem viel geredet, monologisiert oder laut gedacht wird. Hier geht es buchstäblich um Sprecherpositionen, die Figuren definieren sich nicht durch ihr Handeln, sondern durch ihr Labern. Das ist phasenweise lustig, weil Regener ein guter Dialogschreiber ist und selbst Sätze im Dialekt authentisch klingen. Manchmal kommen große Weisheiten dabei herum („Nirgendwo je hatte P. Immel sich so frei gefühlt wie in Westberlin, weil hier alles, aber auch wirklich alles total scheißegal war, aber der Preis dafür waren Kälte und Gnadenlosigkeit.“). Und immer, wenn man denkt, jetzt ist wirklich alles gesagt, kommt noch jemand und die Ecke und „mansplaint“ etwas über Milchkaffee, Aktionskunst oder das richtige Leben im falschen. Irgendwann fühlt man sich in dem Roman wie bei einer WG-Party nachts um drei, wenn alle in der Küche hocken: Man kann sich dem Flow nicht entziehen, aber man fragt sich schon auch, ob man seine Zeit nicht mal in einem etwas fresheren Berlin verbringen möchte.
Im Café Einstein pfeift nun der Milchaufschäumer wie eine Uhr, die einem die Stunde schlägt. Wie nimmt er eigentlich das Berlin von heute wahr, diese internationale Stadt, in der große Politik genauso vorkommt wie große Konzerne? Und wo die Mieten bald das Niveau von München erreichen könnten? Er sei kein Kulturpessimist, sagt Regener, er glaube nicht, dass es heute härter sei, in Berlin zurechtzukommen. Die Leute hätten mehr Geld, anders als früher gebe es auch gute Jobs. Er sage das vielleicht, weil er selbst gut versorgt sei und zwanzig gute Jahre hinter sich habe. „Aber wenn man mich fragt, findet alles auch immer weiter statt, junge Künstler wachsen nach.“ Vielleicht schaffen es die ja dann auch mal in einen Sven-Regener-Roman.
Westberlin, das war das
ewige Gefühl von
„mach es einfach“
Irgendwann fühlt man sich
wie bei einer WG-Party
nachts um drei
Sven Regener:
Glitterschnitter. Roman. Galiani, Berlin 2021.
480 Seiten, 24 Euro.
Sven Regener, eigentlich Bremer und eigentlich Musiker, kam in den Achtzigerjahren nach Berlin und hat inzwischen sechs Bücher geschrieben, alle immer auch Berlin-Romane.
Foto: Charlotte Goltermann
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Allerdings hat die Ankerklause an diesem Spätsommermorgen zu, und auch sonst machen viele Läden in Kreuzberg derzeit erst spätnachmittags auf. Ihnen fehlen die Servicekräfte, die sich wegen der Pandemie etwas anderes suchen mussten. Also ein Treffen im Café Einstein, ebenfalls eine Westberliner Institution. Sven Regener, schwarzes Outfit, schwarze Hornbrille, bestellt, nun ja, Milchkaffee und erzählt, wie er selbst die Corona-Zeit verbracht hat. In der „Pseudoarbeitslosigkeit“ nämlich, weil er mit der Band Element of Crime, seinem ersten künstlerischen Standbein, nicht mehr auftreten konnte. Aber er sei „ein manischer Typ“ und habe dann wieder ein Buch geschrieben. Das heißt „Glitterschnitter“ und bringt einen mit alten Bekannten aus früheren Romanen zusammen. Da sind die vor sich hinwurstelnden Künstler H.R. Ledigt und Karl Schmidt, die jetzt mit einem großformatigen Ölbild beziehungsweise einer Band namens Glitterschnitter (Motto: „Wer übt, ist feige“) ihr Glück versuchen. Da sind Chrissie aus Stuttgart und ihr Onkel Erwin, der nicht einsieht, warum er in seiner Kneipe plötzlich Milchkaffee ausschenken soll statt Flaschenbier. Und da ist natürlich Frank Lehmann, „Ex-Speditionskaufmann, Ex-Bremer, Ex-Wehrpflichtiger, Ex-Selbstmordvortäuscher“. Man kennt ihn seit Regeners Debüt „Herr Lehmann“ (2001), das zum Bestseller und später von Leander Haußmann verfilmt wurde.
Auch das Setting ist wieder dasselbe wie in früheren Regener-Romanen, der Kreuzberger Kiez in den Achtzigerjahren nämlich. Das alte Westberlin beziehungsweise „die Stadt mit einer Mauer drumherum“, wie es bei Regener heißt, wird in Film und Literatur schon seit einiger Zeit als eine Art deutsches Utopia beschworen. Der Kabarettist Rainald Grebe hat in der Schaubühne ein Westberlin-Musical herausgebracht, Oskar Roehler beschrieb in seinem Roman „Mein Leben als Affenarsch“ die Mauerstadt als Ort, der gleichzeitig kaputt und beseelt ist. Der Dokumentarfilm „B-Movie: Lust and Sound in Westberlin 1979 – 1989“ setzt schließlich der damaligen Szene und ihren Treffpunkten ein eindrucksvolles Denkmal mit Archivaufnahmen von Nick Cave, David Bowie oder Martin Kippenberger beim Partymachen, einmal sieht man Tilda Swinton an der Mauer vorbeiradeln.
Und das ist ja auch kein Wunder. Westberlin war die Stadt, in der man einmal im Monat für den Lebensunterhalt kellnerte und sonst frei war zu tun, was man wollte. In der die Subventionen flossen, die Mieten spottbillig waren, und wer kein Haus hatte, besetzte eben eines. Vor allem aber waren auch alle dort, und auf die fiel das Licht der internationalen Aufmerksamkeit, oder wie es Regener ausdrückt: Westberlin war wie „von einer riesigen Glühbirne“ angestrahlt.
Der gebürtige Bremer hat selbst in diesem Umfeld angefangen. „Ich bin als Musiker mit einer Trompete hingekommen und konnte überall mitspielen“. Das „schrägste Zeug“ habe Aufmerksamkeit bekommen, weil man es als Ermutigung genommen habe: Wenn so etwas geht, geht noch viel mehr. „Es gibt immer so Phasen des Anything goes, in denen alles explodiert und etwas Neues entsteht“, sagt Regener, „dieser Punkrock-Ansatz: Natürlich kann der nicht Bass spielen, aber er macht es doch ganz okay, und egal, was du machst, mach es einfach.“ Irgendwann enden diese Phasen, nicht zuletzt weil sie ganz schön anstrengend sind. Aber in der Rückschau entstehen jene Projektionen, mit denen Regener inzwischen sechs Romane bestreiten konnte. Er finde es faszinierend, sich an die Zeit zu erinnern, daran, mit welcher Wildheit und Wut die Leute gerade im Kunstbereich agiert haben, sagt Regener. Aber er wehrt sich dagegen, von Westalgie angetrieben zu sein. Er habe einfach ein Gefühl für die Personen und die Zeit, und die würden sich anbieten, „weil man damit alles erzählen kann“. Geschichten von Liebe, Verrat, Sehnsucht und Enttäuschungen. Vor allem aber wolle er von Menschen Anfang zwanzig erzählen, über diese „Twilight-Zone des Lebens“ und eine ganz bestimmte Art der Unruhe, wenn man in einer Welt klarkommen will, deren Regeln man nicht gemacht hat und die man noch nicht durchschaut. Und in der man immer das Gefühl hat, etwas zu verpassen. Diese Themen lösen sich in „Glitterschnitter“ allerdings fast so schnell auf wie Zucker im Milchkaffee. Das liegt einerseits an der Menge der Figuren, die in Regeners Welt unterwegs sind, Menschen, die Michael 1, Jürgen 3, Kacki, Fräulein Mariandl, Wiemer, Sigi, Enno, Helga, Martha, Sybille oder Nachbar Marko heißen, irgendwo herumsitzen, in einem Plenum etwas sagen (wir sind in Kreuzberg) oder einfach Heimweh haben wie die zahlreichen Österreicher, die neuerdings hier herumschwirren. Regener ist inzwischen auch formal beim Westberliner Lebensgefühl angekommen: Jeder kann mitmachen.
Zum anderen liegt das daran, dass in „Glitterschnitter“ extrem viel geredet, monologisiert oder laut gedacht wird. Hier geht es buchstäblich um Sprecherpositionen, die Figuren definieren sich nicht durch ihr Handeln, sondern durch ihr Labern. Das ist phasenweise lustig, weil Regener ein guter Dialogschreiber ist und selbst Sätze im Dialekt authentisch klingen. Manchmal kommen große Weisheiten dabei herum („Nirgendwo je hatte P. Immel sich so frei gefühlt wie in Westberlin, weil hier alles, aber auch wirklich alles total scheißegal war, aber der Preis dafür waren Kälte und Gnadenlosigkeit.“). Und immer, wenn man denkt, jetzt ist wirklich alles gesagt, kommt noch jemand und die Ecke und „mansplaint“ etwas über Milchkaffee, Aktionskunst oder das richtige Leben im falschen. Irgendwann fühlt man sich in dem Roman wie bei einer WG-Party nachts um drei, wenn alle in der Küche hocken: Man kann sich dem Flow nicht entziehen, aber man fragt sich schon auch, ob man seine Zeit nicht mal in einem etwas fresheren Berlin verbringen möchte.
Im Café Einstein pfeift nun der Milchaufschäumer wie eine Uhr, die einem die Stunde schlägt. Wie nimmt er eigentlich das Berlin von heute wahr, diese internationale Stadt, in der große Politik genauso vorkommt wie große Konzerne? Und wo die Mieten bald das Niveau von München erreichen könnten? Er sei kein Kulturpessimist, sagt Regener, er glaube nicht, dass es heute härter sei, in Berlin zurechtzukommen. Die Leute hätten mehr Geld, anders als früher gebe es auch gute Jobs. Er sage das vielleicht, weil er selbst gut versorgt sei und zwanzig gute Jahre hinter sich habe. „Aber wenn man mich fragt, findet alles auch immer weiter statt, junge Künstler wachsen nach.“ Vielleicht schaffen es die ja dann auch mal in einen Sven-Regener-Roman.
Westberlin, das war das
ewige Gefühl von
„mach es einfach“
Irgendwann fühlt man sich
wie bei einer WG-Party
nachts um drei
Sven Regener:
Glitterschnitter. Roman. Galiani, Berlin 2021.
480 Seiten, 24 Euro.
Sven Regener, eigentlich Bremer und eigentlich Musiker, kam in den Achtzigerjahren nach Berlin und hat inzwischen sechs Bücher geschrieben, alle immer auch Berlin-Romane.
Foto: Charlotte Goltermann
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensent Paul Jandl braucht gar nicht mehr, als sich von Sven Regeners neuem Roman angenehm hin und her schaukeln zu lassen. In dessen Berlin der 80er Jahre dürfen die Leute einfach mal nichts tun, ohne dass das irgendwie relativiert würde, und Jandl findet das super: Gerne beobachtet er Frank Lehman dabei, wie er im Café "Einfall" seinen Milchkaffee aufschäumt, wie die Planung eines neuen Cafés versandet, wie die Menschen durch die schon damals unter "Denkmalschutz" stehende "gemütliche Servicewüste" der Berliner Gastronomie tingeln und dabei viel davon reden, was man tun könnte. Ein bisschen Kulturkampf mit vereinzelt auftretenden Wienern (namens P. Immel oder Kacki, schmunzelt Jandl) darf sein, aber hauptsächlich sind es die "Mikrodialoge berlinerischer Menschenseelen", die den Kritiker in ihrer Unaufdringlichkeit bezaubern.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Dieses Buch macht gute Laune, es ist so, als würde man mit Kacki, P. Immel, H. R. Ledigt und dem ganzen irren Westberliner Haufen in einer WG wohnen. Arg! Jens Uthoff taz am Wochenende 20211211
Gebundenes Buch
Das ist ein bisschen wie bei "Element of Crime":
alle Songs klingen irgendwie ähnlich, aber es gibt welche, bei denen man mitwippt und die man x-mal anhören möchte - und dann gibt es welche, die hört man einmal und dabei bleibt es auch. Das aktuelle Buch von Sven …
Mehr
Das ist ein bisschen wie bei "Element of Crime":
alle Songs klingen irgendwie ähnlich, aber es gibt welche, bei denen man mitwippt und die man x-mal anhören möchte - und dann gibt es welche, die hört man einmal und dabei bleibt es auch. Das aktuelle Buch von Sven Regener gehört leider zur zweiten Kategorie: für Hardcorefans unbedingt zu empfehlen, sonst vielleicht eher nicht.
Weniger
Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Ein seltsames, uriges Figurenensemble, vereint um Kreuzberg um 1980
Die Band ‚GLITTERSCHNITTER‘ um Karl Schmidt, dem Mann an der Bohrmaschine, sucht in vielen Zeitsprüngen mit viel trockener Situationskomik Erfolg neben weiteren Figuren wie Frank Lehmann.
In langen verschachtelten …
Mehr
Ein seltsames, uriges Figurenensemble, vereint um Kreuzberg um 1980
Die Band ‚GLITTERSCHNITTER‘ um Karl Schmidt, dem Mann an der Bohrmaschine, sucht in vielen Zeitsprüngen mit viel trockener Situationskomik Erfolg neben weiteren Figuren wie Frank Lehmann.
In langen verschachtelten Sätzen werden eher belanglose Szenen beschrieben ohne eigentlichen Spannungsbogen, z.B. über Vorträge zur richtigen Kaffeezubereitung. Insgesamt ein seltsamer Roman mit zu wenig ‚Schlagkraft‘.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Kreuzberger Ellenbogengesellschaft
Erstaunlich ist, wie hart und beleidigend der Ton damals in Kreuzberg war. Jeder kämpfte gegen jeden - oft mit angespitzten Ellenbogen.
Da wurde was verwechselt...
Ja, die Senatsknete wurde knapp, die Arbeitslosenzahl stieg! Die Kuschelzeiten waren rum. …
Mehr
Kreuzberger Ellenbogengesellschaft
Erstaunlich ist, wie hart und beleidigend der Ton damals in Kreuzberg war. Jeder kämpfte gegen jeden - oft mit angespitzten Ellenbogen.
Da wurde was verwechselt...
Ja, die Senatsknete wurde knapp, die Arbeitslosenzahl stieg! Die Kuschelzeiten waren rum. Da haute so mancher schnell aus Kreuzberg ab, denn die Leute waren meist schlecht drauf und zogen sich gegenseitig runter. Und soffen sich schon tagsüber die Hucke voll. Und wurden dann noch aggressiver.
Bloß schnell weg!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Ich könnte Sven Regener ewig lauschen
Frank Lehmann befindet sich nun seit drei Wochen in Berlin. Neben seinem Putzjob im Cafe Einfall, übernimmt er auch die ersten Schichten hinter dem Tresen. Charlie möchte mit seiner neuen Band Glitterschnitter auf der Wall City Noise spielen. …
Mehr
Ich könnte Sven Regener ewig lauschen
Frank Lehmann befindet sich nun seit drei Wochen in Berlin. Neben seinem Putzjob im Cafe Einfall, übernimmt er auch die ersten Schichten hinter dem Tresen. Charlie möchte mit seiner neuen Band Glitterschnitter auf der Wall City Noise spielen. H-R könnte auf der Wall City Noise ausstellen, wenn er bereit wäre, dafür ein Bild zu malen. Doch das will er zum Verdruss von Wiemer, seinem Manager, nicht. In der ArschArt-Galerie steuert alles auf eine Meuterei zu, denn Kacki fühlt sich von seinem besten Freund P. Immel hintergangen.
„Glitterschnitter“ führt den Erzählfaden aus der „Wiener Straße“ fort. Doch auch wer die Wiener Straße nicht gelesen oder gehört hat, kann der Erzählung gut folgen, wenn er sich auf die schrägen Charaktere und ihre wirren Gedankengänge einlässt.
Bereits zweimal hatte ich das Vergnügen, Sven Regener auf einer Lesung seines jeweils aktuellen Buches live zu erleben. Beide Male war ich hellauf begeistert, denn ich mag es, wie lebendig er liest. Und genau das kommt auch bei diesem Hörbuch rüber. Es ist einfach ein riesiges Vergnügen, dem Autor beim Lesen zu lauschen. Das könnte ich ewig. Dabei stört es mich überhaupt nicht, dass man deutlich merkt, dass da kein geschulter Hörbuchleser am Werk ist. Regner liest immer einen Tacken zu schnell und seine Herkunft hört man auch immer deutlich heraus.
Den Schreibstil von Sven Regener empfinde ich als schnoddrig und dadurch sehr lebendig. Tempo gewinnt die Geschichte noch mehr dadurch, dass das Buch zu weiten Teilen aus Dialogen bzw. Selbstgesprächen besteht. Die Figuren reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Das Buch ist humorvoll. Und auch dieser Erzählstil macht mir als Hörerin eine Menge Spaß. Dazu kommt, dass mir die Figuren so vertraut sind, dass ich den Eindruck habe, ich treffe alte Bekannte wieder und wir erinnern uns daran, wie es damals in den 80ern war in unseren Leben.
Gefehlt hat mir ein Spannungsbogen. Bei „Glitterschnitter“ hatte ich den Eindruck, dass ich an einem willkürlichen Punkt in das Geschehen eintauche und an einem ebenso willkürlichen Punkt die Geschichte wieder verlasse. Das ein oder andere Mal hatte ich beim Hören auch den Eindruck, allzu alltäglichen Geschehnissen zu lauschen, die im Grunde keine Erzählung wert sind. Wirklich gestört hat das nicht, dafür habe ich „Glitterschnitter“ einfach zu sehr genossen, aber es ist mir aufgefallen.
Besonders gut gefallen hat mir das Shakespeare-Battle zwischen Kacki und P. Immel. Die beiden versuchen ihre Diskussionen im Stile eines Werkes von Shakespeare auszutragen. Das ist einfach super und das Zuhören war die reine Freude für mich.
Fazit: Insgesamt hat mir das Hörbuch sehr gut gefallen. Sven Regener beim Lesen zuzuhören ist ein außerordentlicher Genuss, sodass kleine Schwächen in der Geschichte überdeckt werden. Lediglich auf einen deutlichen Spannungsbogen könnte er in Zukunft gerne achten.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Sven Regeners neuer Roman schließt zeitlich an seinen Vorgänger "Wiener Straße" an. Aber auch wenn man (so wie ich) diesen noch nicht gelesen hat, kann man "Glitterschnitter" gut folgen. Erzählt wird von ein paar wenigen Tagen in der Vorweihnachtszeit 1980. …
Mehr
Sven Regeners neuer Roman schließt zeitlich an seinen Vorgänger "Wiener Straße" an. Aber auch wenn man (so wie ich) diesen noch nicht gelesen hat, kann man "Glitterschnitter" gut folgen. Erzählt wird von ein paar wenigen Tagen in der Vorweihnachtszeit 1980. Allzu weihnachtlich bzw. besinnlich wird es allerdings nicht, denn die West-Berliner Kneipen- und Kunstszene, um die es hier wie so oft in Sven Regeners Romanen geht, dreht sich vorwiegend um sich selbst. Aus verschiedenen Blickwinkeln (leider nicht aus Karl Schmidts – sehr schade) wird von verschiedenen Projekten berichtet: einer Kaffeehauseröffnung, einem Konzert, einer Kunstausstellung.
Die Handlung ist eher übersichtlich, aber das ganze dennoch recht unterhaltsam und witzig. Die Unterhaltungen und Unternehmungen der Protagonisten sind größtenteils wieder einmal so absurd wie nur möglich. Gegen Ende zog es sich für mich dann aber etwas in die Länge – vielleicht fehlt hier dann doch eine etwas konkretere Handlung. An "Magical Mystery" oder "Herr Lehmann" kommt "Glitterschnitter" also leider nicht ran. Dennoch für Fans natürlich ein Muss. Neulingen würde ich aber die beiden genannten Klassiker als Start in das Sven-Regener-Universum empfehlen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Wie ein Wiedersehen mit alten Freunden – lustig, skurril und bunt
Worum geht’s?
Berlin 1980: Während Freddie in einer Klinik an einer Medikamentenstudie teilnimmt, hilft sein kleiner Bruder im Café Einfall aus. Er lebt sich langsam in Berlin ein und hat eine Menge neue …
Mehr
Wie ein Wiedersehen mit alten Freunden – lustig, skurril und bunt
Worum geht’s?
Berlin 1980: Während Freddie in einer Klinik an einer Medikamentenstudie teilnimmt, hilft sein kleiner Bruder im Café Einfall aus. Er lebt sich langsam in Berlin ein und hat eine Menge neue Bekanntschaften geschlossen, ein bunter Haufen aus Künstlern und solchen, die es werden wollen. Während Frank den Milchkaffee einführt, versuchen Glitterschnitter einen Platz auf der Wall City Noise zu ergattern und H.R. Ledigt auf der Wall City Berlin 1980.
Meine Meinung:
Mit „Glitterschnitter“ (Kiepenheuer & Witsch, Ausg. 2021) schreibt Sven Regener die Geschichte um seinen Protagonisten Frank Lehman weiter. Es ist inzwischen der 6. Teil und immer wieder schön, von allen zu lesen. Ein bisschen, als würde man alte Bekannte wiedersehen. Besonders Sven Regeners Schreibstil gefällt mir sehr. Er wechselt von einem zum anderen Abschnitt die Sicht, aus der er schreibt. Liest man den eine Abschnitt aus Sicht von Frank, so handelt der nächste aus der Sicht z.B. der ArschArt-Leute. Und neben der eigentlichen Erzählung lässt er parallel zu dem gesprochenen Wort die Gedanken des Sprechers einfließen. Wie im echten Leben! Oft sagt man das eine und denkt das andere. Man hat das Gefühl, der Autor schreibt einfach locker von der Leber weg, was ihm so in den Sinn kommt, und das macht das Ganze so unterhaltsam und amüsant. Man fühlt die Atmosphäre, das bunte Berlin der 1980er Jahre, die Künstler, Punks und all die anderen.
Auf der einen Seite begleiten wir Frank, der gleichzeitig bei allem auch ein bisschen der Beobachter ist, sich seinen Teil denkt. Er kämpft sich durch, hat seine Meinung ist aber durchaus zuverlässig und empathisch. Dann die Leute von ArschArt, das „Gefolge“ von P. Immel, der Möchtegern-Hausbesetzer, der eigentlich Hausbesitzer ist und von irgendwoher Geld hat. Diese Gruppe, die immer ein bisschen Aktionismus betreibt und hier auf Österreicher macht. Ich habe den Dialekt beim Lesen immer im Kopf gehabt. Die ihre Kneipe „Intimfrisur“ – was für ein Name – in ein Wiener Café umwandeln wollen. Und die Gruppe um die Band „Glitterschnitter“, von denen auch der Titel des Buches kommt. Musik vs. Bohrmaschine. Ebenso eine Truppe, die unterschiedlicher nicht sein könnte und dennoch ein geniales Zusammenspiel hat. Und wir haben noch H.R. Ledigt, den Geldgeber hinter dem Ganzen. Der ein Künstler sein will, aber mit Aktionismus und nicht auf Leinwand.
Ich kann nicht genug bekommen von der Art, wie Sven Regener schreibt. Die pragmatischen und dadurch lockeren und amüsanten Dialoge. Das agieren der Charaktere und Gruppen untereinander. Es ist bunt, es ist lustig, es schillert, ist laut und grell. Das Buch ist das reine Leben, auch wenn Frank, mit dem damals alles begann, hier fast ein bisschen zu kurz kommt. Von ihm und auch von Freddie hätte ich gerne noch mehr gelesen. Das Buch hat mich fasziniert. Ich weiß nicht, was es ist, aber P. Immel, Kacki (und ihr Kampf in Versen von Shakespeare), Frank, Erwin und wie sie alle heißen ziehen mich immer wieder in ihren Bann und ich möchte noch mehr und mehr von ihnen erfahren und hoffe, dass dies nicht das letzte Buch war!
Fazit:
Mit „Glitterschnitter“ hat Sven Regener die Reihe um Frank Lehmann & Co fortgesetzt. In dem Buch tobt das Leben im Berlin der 1980er Jahre. Die Künstlerszene, die Hausbesetzer, das Café Einfall – wir treffen alle alten Bekannte wieder. P. Immel und seine Leute von ArschArt, die in diesem Buch Wienerisch reden. „Glitterschnitter“, die als Band groß rauskommen wollen. Und besonders genial: Die Ottakringer Shakespeare-Schlacht zwischen P. Immel und Kacki.
4 Punkte für diese gelungene Fortsetzung, ich hoffe, wir lesen bald mehr von unseren Freunden!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Luft ist raus
Inhalt:
Berlin, 1980. In der Wiener Straße befinden sich das Café Einfall und das „Intimfrisur“ Seite an Seite. Ersteres wollen Erwins Nichte Chrissie und Frank Lehmann von einer Kneipe in ein Café verwandeln, Letzteres wollen die …
Mehr
Die Luft ist raus
Inhalt:
Berlin, 1980. In der Wiener Straße befinden sich das Café Einfall und das „Intimfrisur“ Seite an Seite. Ersteres wollen Erwins Nichte Chrissie und Frank Lehmann von einer Kneipe in ein Café verwandeln, Letzteres wollen die ArschArt-Österreicher zu einem Café umfunktionieren. Beides ist kaum zu erreichen.
Raimund, Ferdi und Karl Schmidt wollen als Band Glitterschnitter auf Teufel komm raus auf der Wall City Noise auftreten. Auch hier sind einige Hürden zu überwinden.
Meine Meinung:
Ich freute mich, nach längerer Zeit wieder die altbekannten Figuren aus Sven Regeners früheren Romanen (und einige neue) zu treffen. Während die ersten drei Bücher um Frank Lehmann noch wirkliche Substanz haben, geht es seit „Magical Mystery: oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt“ bergab. Die Handlung von „Glitterschnitter“ ließe sich auf wenigen Seiten zusammenfassen. Ausgeschmückt ist sie mit sich häufenden Wiederholungen. Doch was beim ersten Mal noch witzig ist, ist es beim zweiten Lesen nicht unbedingt immer noch. Und was beim ersten Mal schon öd war, wird auch durch die Wiederholung nicht unterhaltsamer. Doch zum Glück bleibt immer noch genug, um sich beim Lesen hin und wieder köstlich amüsieren zu können. Insofern war dieser Band für mich ein Wechselbad der Gefühle: Mal war ich begeistert, mal gelangweilt.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für