In dem kleinen Städtchen Bad Guldenberg ist die Welt noch in Ordnung. Jedenfalls bis im alten Seglerheim eine Gruppe minderjähriger Migranten untergebracht wird. Die Guldenberger sind sich einig: Diese Fremden passen nicht in den Ort und sorgen nur für Unruhe. Mehr und mehr heizt sich die Stimmung auf. Als es dann noch heißt, eine junge Frau sei vergewaltigt worden, sind alle überzeugt, dass es einer der jungen Flüchtlinge gewesen sein muss. Und das wollen die guten Bürger von Guldenberg nicht hinnehmen ... Christoph Hein zeichnet das Sittengemälde einer Gesellschaft, die aus den Fugen gerät, - mit bedrückender Intensität gelesen von Johann von Bülow.Ungekürzte Lesung mit Johann von Bülow5 CDs ca. 6 h 17 min
»Ein genau beobachtender Chronist mit großem Gespür für die Verwerfungen der Gesellschaft.« Sächsische Zeitung
In Guldenberg werden nur kleine Brötchen gebacken
Christoph Heins neuer Roman erzählt von Fremdenhass an einem fiktiven Ort der ostdeutschen Provinz im Jahr der Flüchtlingskrise
Manchmal enthält der erste Satz einer Erzählung bereits das Programm der Erzählung selbst. So ist es auch beim neuen Roman von Christoph Hein - einem Spezialisten für die Darstellung deutscher Lebenswege zwischen Ost und West. "Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert."
Guldenberg ist eine erfundene Stadt in der ostdeutschen Provinz. Mit Subventionen der Europäischen Union war nach der Wende alles hübsch herausgeputzt worden. Doch Guldenberg ist trotz einiger prunkvoller Gründerzeitquartiere, einem Jugendstilkonzerthaus und einem Mulde-Heilbad ohne nennenswerte Perspektive. Hier ist schon lange niemand mehr vorbeigekommen, der frischen Wind gebracht hätte. Einer der wenigen Mittelständler vor Ort, der großsprecherische Stefan Haubrich-Becker, baut in einem "Töffli-Werk" motorisierte Dreiräder. Als Einziger einer alten Ost-Männerclique kann er sich als Wendegewinnler definieren. Aber trotz guter Umsätze ist es auch für den selbstbewussten Geschäftsmann nicht leicht, in Guldenberg zu investieren. Haubrich-Becker findet keine Lehrlinge für seinen Betrieb, wie er dem Bürgermeister mitteilt. Die Jungen zögen es vor, von Hartz IV zu leben, resümiert er seine Erfahrung mit dem lokalen Nachwuchs und bittet den Bürgermeister deshalb um Unterstützung.
Bürgermeister Konstantin Kötteritz wiederum hat andere Probleme. Er ist auf der Suche nach einem Mäzen für sein wiederhergestelltes Konzerthaus. Haubrich-Becker soll eine regelmäßige Konzertreihe sponsern. Doch der winkt bloß ab. "Mit eines fremden Mannes Arsch durchs Feuer reiten zu wollen", so teilt er seiner Frau mit, das werde er den Stadträten schon austreiben. "Ein Konzerthaus in Guldenberg", sagt er weniger vulgär dem Bürgermeister, "das ist überkandidelt, dafür ist die Stadt zu klein."
Christoph Hein setzt mit "Guldenberg" einen Ort, der schon deutlich bessere Zeiten gesehen hat - was mehr als siebzig Jahre zurückliegt. "Ja aber wie gesagt, da gab es hier zwölf Großunternehmen und noch ein intaktes Bürgertum. Das alles haben Krieg und die Nachkriegsjahrzehnte ausgelöscht. Jetzt haben wir nur noch sechs größere Unternehmen, aber alle sechs sind nur mittelständisch, keins von ihnen ist von überregionaler oder gar internationaler Bedeutung. In Guldenberg werden nur kleine Brötchen gebacken."
So skizziert Hein die Stimmung in der ostdeutschen Provinz im Jahr der Flüchtlingskrise. Diese trifft im Roman das verhärmte Klima von Guldenberg mit unerwarteter Wucht. Im alten Seglerheim wird eine Gruppe minderjähriger Geflüchteter untergebracht. Das hat der Bund so entschieden. Ein Dutzend junger Männer aus Syrien und Afghanistan wird das habituelle Ressentiment vieler Guldenberger gegen alles Fremde zu einem politischen Problem mit überregionaler Bedeutung vergrößern - denn bald schon fliegen Steine durch die Fenster der Unterkunft für Migranten. Wobei die jungen Männer bei Christoph Hein nur skizzenhaft eingeführt werden. Vielmehr sind sie als Kollektivsingular die Schützlinge einer guten Seele namens Frau Marikke Brummig. Im Seglerheim soll sie dafür Sorge tragen, dass keiner etwas anstellt, dass die Jungen sich an die Regeln halten und ihre Deutschkurse besuchen, die es ihnen später ermöglichen sollen, einen Lehrberuf anzustreben. Das wäre doch ein Fangbecken für den Unternehmer Haubrich-Becker, meint Bürgermeister Kötteritz.
Er hofft, die fremdenfeindliche Stimmung in der Stadt mit wirtschaftspositivem Aktionismus im Keim zu ersticken. Aber weit gefehlt! Bald gibt es allerlei Gerüchte um die jungen Männer. Ein Vergewaltigungsvorwurf steht, nicht nachgewiesen, im Raum. Ein Brandanschlag wird hingegen bewiesen, aber die Suche nach den Tätern bleibt erfolglos. Selbst der Pfarrer, der die jungen Männer in seine Kirche eingeladen hat, muss sich von aufgebrachten Guldenbergern nun vorhalten lassen, er habe das Gotteshaus in eine Moschee verwandelt. Er wolle jedenfalls nicht auf den gleichen Stühlen sitzen wie ein Islamist, krakeelt der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Woraufhin Pfarrer Fuschel für einmal die Façon verliert: "Ein friedfertiger Mensch? Ein stolzer Guldenberger? Nein, Herr Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, Sie sind ein Arschloch."
Christoph Hein hat einen Roman geschrieben, in dem die Dynamiken des Fremdenhasses wie bei einem Kunstfeuerwerk Schritt für Schritt entfesselt werden: die hilflosen Versuche der Wohlmeinenden, mit dem Ressentiment zu leben; die aggressive Abwehr angeblicher Demokraten; die Gewalteinbrüche der Fremdenhasser; und die Verzweiflungstaten innerhalb der Migrantengruppe, die von Messerstechereien untereinander bis hin zu Kontakten zu deutschen Dschihadisten reichen. Das alles ist so richtig wie bekannt und wird im Roman pflichtschuldig abgearbeitet. Auch rührende Nebenstränge werden verfolgt. So ist die Haushälterin des Herrn Hochwürden Fuschel eine Jüdin, deren Eltern die Flucht vor Hitler gelungen war. Jetzt führt sie mit kessem Temperament den Haushalt des Pfarrers und soll den Lesern in dieser Funktion dazu dienen, deutsche Geschichte zu veranschaulichen. Ebenso der Verweis eines Guldenberger Bürgers beim Stammtisch, die eigenen Eltern seien ja aus Schlesien geflohen. Wobei das natürlich was anderes gewesen sei, weil man anders als "diese Orientalen" ja "hierher" gehört habe.
Christoph Hein, und das ist der wunde Punkt seines Romans, will alles richtig machen. Alle erdenklichen Haltungen zur aktuellen Lage im Land werden im Roman aufgeführt. Und zwar auf so vorhersehbare Weise, dass man im jedem seiner Sätze die Bundeszentrale für politische Bildung am Werk wähnt. Das ist sehr schade. Und kaum verständlich, wenn man sich an Heins letzten Roman "Verwirrnis" erinnert. Dort hat der Autor in bewundernswert feinsinniger Weise den Werdegang eines jungen schwulen Intellektuellen in der DDR nachgezeichnet. Mit so viel Diskretion und stilistischer Eleganz, dass dagegen dieser Roman über den habituellen Rassismus in der ostdeutschen Provinz läppisch wirkt.
"Guldenberg" lässt einen auch deshalb gleichgültig zurück, weil jede Geschichte, die darin ausgefaltet wird, wieder in die Verpackung zurück muss, sobald sie ihre Funktion erfüllt hat. So werden wir nie erfahren, ob Hakim Kontakt zu einem deutschen Islamisten hatte. Wir erfahren auch nicht, was aus der schwangeren minderjährigen Bärbel wird, die aus Angst vor ihren Eltern behauptet, ein Migrant habe sie vergewaltigt. Und achselzuckend nehmen wir zur Kenntnis, dass Guldenberg seine Probleme nicht löst, sondern die paar Minderjährigen in der Region umverteilt werden. Aus dem Seglerheim wird ein Pflegeheim. Das mag alles genau so zugehen. Und doch ist man jetzt erst da, wo die Erzählung "Guldenberg" anfangen müsste.
Um noch einmal den ersten Satz zu zitieren: "Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert." Das ist die These des Romans. In Wahrheit belegt er aber nur ihr Gegenteil: dass alles beim Alten geblieben ist. KATHARINA TEUTSCH.
Christoph Hein: "Guldenberg". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 284 S., geb., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Christoph Heins neuer Roman erzählt von Fremdenhass an einem fiktiven Ort der ostdeutschen Provinz im Jahr der Flüchtlingskrise
Manchmal enthält der erste Satz einer Erzählung bereits das Programm der Erzählung selbst. So ist es auch beim neuen Roman von Christoph Hein - einem Spezialisten für die Darstellung deutscher Lebenswege zwischen Ost und West. "Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert."
Guldenberg ist eine erfundene Stadt in der ostdeutschen Provinz. Mit Subventionen der Europäischen Union war nach der Wende alles hübsch herausgeputzt worden. Doch Guldenberg ist trotz einiger prunkvoller Gründerzeitquartiere, einem Jugendstilkonzerthaus und einem Mulde-Heilbad ohne nennenswerte Perspektive. Hier ist schon lange niemand mehr vorbeigekommen, der frischen Wind gebracht hätte. Einer der wenigen Mittelständler vor Ort, der großsprecherische Stefan Haubrich-Becker, baut in einem "Töffli-Werk" motorisierte Dreiräder. Als Einziger einer alten Ost-Männerclique kann er sich als Wendegewinnler definieren. Aber trotz guter Umsätze ist es auch für den selbstbewussten Geschäftsmann nicht leicht, in Guldenberg zu investieren. Haubrich-Becker findet keine Lehrlinge für seinen Betrieb, wie er dem Bürgermeister mitteilt. Die Jungen zögen es vor, von Hartz IV zu leben, resümiert er seine Erfahrung mit dem lokalen Nachwuchs und bittet den Bürgermeister deshalb um Unterstützung.
Bürgermeister Konstantin Kötteritz wiederum hat andere Probleme. Er ist auf der Suche nach einem Mäzen für sein wiederhergestelltes Konzerthaus. Haubrich-Becker soll eine regelmäßige Konzertreihe sponsern. Doch der winkt bloß ab. "Mit eines fremden Mannes Arsch durchs Feuer reiten zu wollen", so teilt er seiner Frau mit, das werde er den Stadträten schon austreiben. "Ein Konzerthaus in Guldenberg", sagt er weniger vulgär dem Bürgermeister, "das ist überkandidelt, dafür ist die Stadt zu klein."
Christoph Hein setzt mit "Guldenberg" einen Ort, der schon deutlich bessere Zeiten gesehen hat - was mehr als siebzig Jahre zurückliegt. "Ja aber wie gesagt, da gab es hier zwölf Großunternehmen und noch ein intaktes Bürgertum. Das alles haben Krieg und die Nachkriegsjahrzehnte ausgelöscht. Jetzt haben wir nur noch sechs größere Unternehmen, aber alle sechs sind nur mittelständisch, keins von ihnen ist von überregionaler oder gar internationaler Bedeutung. In Guldenberg werden nur kleine Brötchen gebacken."
So skizziert Hein die Stimmung in der ostdeutschen Provinz im Jahr der Flüchtlingskrise. Diese trifft im Roman das verhärmte Klima von Guldenberg mit unerwarteter Wucht. Im alten Seglerheim wird eine Gruppe minderjähriger Geflüchteter untergebracht. Das hat der Bund so entschieden. Ein Dutzend junger Männer aus Syrien und Afghanistan wird das habituelle Ressentiment vieler Guldenberger gegen alles Fremde zu einem politischen Problem mit überregionaler Bedeutung vergrößern - denn bald schon fliegen Steine durch die Fenster der Unterkunft für Migranten. Wobei die jungen Männer bei Christoph Hein nur skizzenhaft eingeführt werden. Vielmehr sind sie als Kollektivsingular die Schützlinge einer guten Seele namens Frau Marikke Brummig. Im Seglerheim soll sie dafür Sorge tragen, dass keiner etwas anstellt, dass die Jungen sich an die Regeln halten und ihre Deutschkurse besuchen, die es ihnen später ermöglichen sollen, einen Lehrberuf anzustreben. Das wäre doch ein Fangbecken für den Unternehmer Haubrich-Becker, meint Bürgermeister Kötteritz.
Er hofft, die fremdenfeindliche Stimmung in der Stadt mit wirtschaftspositivem Aktionismus im Keim zu ersticken. Aber weit gefehlt! Bald gibt es allerlei Gerüchte um die jungen Männer. Ein Vergewaltigungsvorwurf steht, nicht nachgewiesen, im Raum. Ein Brandanschlag wird hingegen bewiesen, aber die Suche nach den Tätern bleibt erfolglos. Selbst der Pfarrer, der die jungen Männer in seine Kirche eingeladen hat, muss sich von aufgebrachten Guldenbergern nun vorhalten lassen, er habe das Gotteshaus in eine Moschee verwandelt. Er wolle jedenfalls nicht auf den gleichen Stühlen sitzen wie ein Islamist, krakeelt der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Woraufhin Pfarrer Fuschel für einmal die Façon verliert: "Ein friedfertiger Mensch? Ein stolzer Guldenberger? Nein, Herr Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, Sie sind ein Arschloch."
Christoph Hein hat einen Roman geschrieben, in dem die Dynamiken des Fremdenhasses wie bei einem Kunstfeuerwerk Schritt für Schritt entfesselt werden: die hilflosen Versuche der Wohlmeinenden, mit dem Ressentiment zu leben; die aggressive Abwehr angeblicher Demokraten; die Gewalteinbrüche der Fremdenhasser; und die Verzweiflungstaten innerhalb der Migrantengruppe, die von Messerstechereien untereinander bis hin zu Kontakten zu deutschen Dschihadisten reichen. Das alles ist so richtig wie bekannt und wird im Roman pflichtschuldig abgearbeitet. Auch rührende Nebenstränge werden verfolgt. So ist die Haushälterin des Herrn Hochwürden Fuschel eine Jüdin, deren Eltern die Flucht vor Hitler gelungen war. Jetzt führt sie mit kessem Temperament den Haushalt des Pfarrers und soll den Lesern in dieser Funktion dazu dienen, deutsche Geschichte zu veranschaulichen. Ebenso der Verweis eines Guldenberger Bürgers beim Stammtisch, die eigenen Eltern seien ja aus Schlesien geflohen. Wobei das natürlich was anderes gewesen sei, weil man anders als "diese Orientalen" ja "hierher" gehört habe.
Christoph Hein, und das ist der wunde Punkt seines Romans, will alles richtig machen. Alle erdenklichen Haltungen zur aktuellen Lage im Land werden im Roman aufgeführt. Und zwar auf so vorhersehbare Weise, dass man im jedem seiner Sätze die Bundeszentrale für politische Bildung am Werk wähnt. Das ist sehr schade. Und kaum verständlich, wenn man sich an Heins letzten Roman "Verwirrnis" erinnert. Dort hat der Autor in bewundernswert feinsinniger Weise den Werdegang eines jungen schwulen Intellektuellen in der DDR nachgezeichnet. Mit so viel Diskretion und stilistischer Eleganz, dass dagegen dieser Roman über den habituellen Rassismus in der ostdeutschen Provinz läppisch wirkt.
"Guldenberg" lässt einen auch deshalb gleichgültig zurück, weil jede Geschichte, die darin ausgefaltet wird, wieder in die Verpackung zurück muss, sobald sie ihre Funktion erfüllt hat. So werden wir nie erfahren, ob Hakim Kontakt zu einem deutschen Islamisten hatte. Wir erfahren auch nicht, was aus der schwangeren minderjährigen Bärbel wird, die aus Angst vor ihren Eltern behauptet, ein Migrant habe sie vergewaltigt. Und achselzuckend nehmen wir zur Kenntnis, dass Guldenberg seine Probleme nicht löst, sondern die paar Minderjährigen in der Region umverteilt werden. Aus dem Seglerheim wird ein Pflegeheim. Das mag alles genau so zugehen. Und doch ist man jetzt erst da, wo die Erzählung "Guldenberg" anfangen müsste.
Um noch einmal den ersten Satz zu zitieren: "Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert." Das ist die These des Romans. In Wahrheit belegt er aber nur ihr Gegenteil: dass alles beim Alten geblieben ist. KATHARINA TEUTSCH.
Christoph Hein: "Guldenberg". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 284 S., geb., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Katharina Teutsch zeigt sich enttäuscht von Christoph Heins neuem Roman. Das liegt laut Rezensentin daran, dass der Autor in seiner in der ostdeutschen Provinz spielenden Geschichte um Wendeverlierer, Migranten und Fremdenhass alles richtig machen will. Für Teutsch klingt das leider so, als hätte sich die Bundeszentrale für politische Bildung die Story und die Figuren ausgedacht, derart "pflichtschuldig", meint sie, werden die "Dynamiken des Fremdenhasses" thematisiert, funktionalisiert und abgehakt. Interesse und Empathie für die Figuren kommen so bei Teutsch nicht auf.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Christoph Heins neuer Roman erzählt von Fremdenhass an einem fiktiven Ort der ostdeutschen Provinz im Jahr der Flüchtlingskrise
Manchmal enthält der erste Satz einer Erzählung bereits das Programm der Erzählung selbst. So ist es auch beim neuen Roman von Christoph Hein - einem Spezialisten für die Darstellung deutscher Lebenswege zwischen Ost und West. "Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert."
Guldenberg ist eine erfundene Stadt in der ostdeutschen Provinz. Mit Subventionen der Europäischen Union war nach der Wende alles hübsch herausgeputzt worden. Doch Guldenberg ist trotz einiger prunkvoller Gründerzeitquartiere, einem Jugendstilkonzerthaus und einem Mulde-Heilbad ohne nennenswerte Perspektive. Hier ist schon lange niemand mehr vorbeigekommen, der frischen Wind gebracht hätte. Einer der wenigen Mittelständler vor Ort, der großsprecherische Stefan Haubrich-Becker, baut in einem "Töffli-Werk" motorisierte Dreiräder. Als Einziger einer alten Ost-Männerclique kann er sich als Wendegewinnler definieren. Aber trotz guter Umsätze ist es auch für den selbstbewussten Geschäftsmann nicht leicht, in Guldenberg zu investieren. Haubrich-Becker findet keine Lehrlinge für seinen Betrieb, wie er dem Bürgermeister mitteilt. Die Jungen zögen es vor, von Hartz IV zu leben, resümiert er seine Erfahrung mit dem lokalen Nachwuchs und bittet den Bürgermeister deshalb um Unterstützung.
Bürgermeister Konstantin Kötteritz wiederum hat andere Probleme. Er ist auf der Suche nach einem Mäzen für sein wiederhergestelltes Konzerthaus. Haubrich-Becker soll eine regelmäßige Konzertreihe sponsern. Doch der winkt bloß ab. "Mit eines fremden Mannes Arsch durchs Feuer reiten zu wollen", so teilt er seiner Frau mit, das werde er den Stadträten schon austreiben. "Ein Konzerthaus in Guldenberg", sagt er weniger vulgär dem Bürgermeister, "das ist überkandidelt, dafür ist die Stadt zu klein."
Christoph Hein setzt mit "Guldenberg" einen Ort, der schon deutlich bessere Zeiten gesehen hat - was mehr als siebzig Jahre zurückliegt. "Ja aber wie gesagt, da gab es hier zwölf Großunternehmen und noch ein intaktes Bürgertum. Das alles haben Krieg und die Nachkriegsjahrzehnte ausgelöscht. Jetzt haben wir nur noch sechs größere Unternehmen, aber alle sechs sind nur mittelständisch, keins von ihnen ist von überregionaler oder gar internationaler Bedeutung. In Guldenberg werden nur kleine Brötchen gebacken."
So skizziert Hein die Stimmung in der ostdeutschen Provinz im Jahr der Flüchtlingskrise. Diese trifft im Roman das verhärmte Klima von Guldenberg mit unerwarteter Wucht. Im alten Seglerheim wird eine Gruppe minderjähriger Geflüchteter untergebracht. Das hat der Bund so entschieden. Ein Dutzend junger Männer aus Syrien und Afghanistan wird das habituelle Ressentiment vieler Guldenberger gegen alles Fremde zu einem politischen Problem mit überregionaler Bedeutung vergrößern - denn bald schon fliegen Steine durch die Fenster der Unterkunft für Migranten. Wobei die jungen Männer bei Christoph Hein nur skizzenhaft eingeführt werden. Vielmehr sind sie als Kollektivsingular die Schützlinge einer guten Seele namens Frau Marikke Brummig. Im Seglerheim soll sie dafür Sorge tragen, dass keiner etwas anstellt, dass die Jungen sich an die Regeln halten und ihre Deutschkurse besuchen, die es ihnen später ermöglichen sollen, einen Lehrberuf anzustreben. Das wäre doch ein Fangbecken für den Unternehmer Haubrich-Becker, meint Bürgermeister Kötteritz.
Er hofft, die fremdenfeindliche Stimmung in der Stadt mit wirtschaftspositivem Aktionismus im Keim zu ersticken. Aber weit gefehlt! Bald gibt es allerlei Gerüchte um die jungen Männer. Ein Vergewaltigungsvorwurf steht, nicht nachgewiesen, im Raum. Ein Brandanschlag wird hingegen bewiesen, aber die Suche nach den Tätern bleibt erfolglos. Selbst der Pfarrer, der die jungen Männer in seine Kirche eingeladen hat, muss sich von aufgebrachten Guldenbergern nun vorhalten lassen, er habe das Gotteshaus in eine Moschee verwandelt. Er wolle jedenfalls nicht auf den gleichen Stühlen sitzen wie ein Islamist, krakeelt der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Woraufhin Pfarrer Fuschel für einmal die Façon verliert: "Ein friedfertiger Mensch? Ein stolzer Guldenberger? Nein, Herr Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, Sie sind ein Arschloch."
Christoph Hein hat einen Roman geschrieben, in dem die Dynamiken des Fremdenhasses wie bei einem Kunstfeuerwerk Schritt für Schritt entfesselt werden: die hilflosen Versuche der Wohlmeinenden, mit dem Ressentiment zu leben; die aggressive Abwehr angeblicher Demokraten; die Gewalteinbrüche der Fremdenhasser; und die Verzweiflungstaten innerhalb der Migrantengruppe, die von Messerstechereien untereinander bis hin zu Kontakten zu deutschen Dschihadisten reichen. Das alles ist so richtig wie bekannt und wird im Roman pflichtschuldig abgearbeitet. Auch rührende Nebenstränge werden verfolgt. So ist die Haushälterin des Herrn Hochwürden Fuschel eine Jüdin, deren Eltern die Flucht vor Hitler gelungen war. Jetzt führt sie mit kessem Temperament den Haushalt des Pfarrers und soll den Lesern in dieser Funktion dazu dienen, deutsche Geschichte zu veranschaulichen. Ebenso der Verweis eines Guldenberger Bürgers beim Stammtisch, die eigenen Eltern seien ja aus Schlesien geflohen. Wobei das natürlich was anderes gewesen sei, weil man anders als "diese Orientalen" ja "hierher" gehört habe.
Christoph Hein, und das ist der wunde Punkt seines Romans, will alles richtig machen. Alle erdenklichen Haltungen zur aktuellen Lage im Land werden im Roman aufgeführt. Und zwar auf so vorhersehbare Weise, dass man im jedem seiner Sätze die Bundeszentrale für politische Bildung am Werk wähnt. Das ist sehr schade. Und kaum verständlich, wenn man sich an Heins letzten Roman "Verwirrnis" erinnert. Dort hat der Autor in bewundernswert feinsinniger Weise den Werdegang eines jungen schwulen Intellektuellen in der DDR nachgezeichnet. Mit so viel Diskretion und stilistischer Eleganz, dass dagegen dieser Roman über den habituellen Rassismus in der ostdeutschen Provinz läppisch wirkt.
"Guldenberg" lässt einen auch deshalb gleichgültig zurück, weil jede Geschichte, die darin ausgefaltet wird, wieder in die Verpackung zurück muss, sobald sie ihre Funktion erfüllt hat. So werden wir nie erfahren, ob Hakim Kontakt zu einem deutschen Islamisten hatte. Wir erfahren auch nicht, was aus der schwangeren minderjährigen Bärbel wird, die aus Angst vor ihren Eltern behauptet, ein Migrant habe sie vergewaltigt. Und achselzuckend nehmen wir zur Kenntnis, dass Guldenberg seine Probleme nicht löst, sondern die paar Minderjährigen in der Region umverteilt werden. Aus dem Seglerheim wird ein Pflegeheim. Das mag alles genau so zugehen. Und doch ist man jetzt erst da, wo die Erzählung "Guldenberg" anfangen müsste.
Um noch einmal den ersten Satz zu zitieren: "Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert." Das ist die These des Romans. In Wahrheit belegt er aber nur ihr Gegenteil: dass alles beim Alten geblieben ist. KATHARINA TEUTSCH.
Christoph Hein: "Guldenberg". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 284 S., geb., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Beschreiben, was ist - diesem seinem Grundsatz treubleibt Christoph Hein auch in diesem Roman treu. ... Die deutsche Wirklichkeit - nicht nur in Guldenberg - ist leider so ...« Peter Henning neues deutschland 20210616

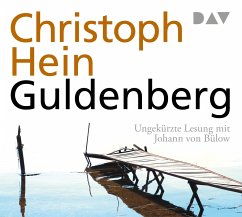

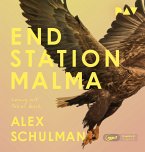





heike-s.jpg)