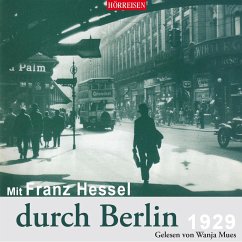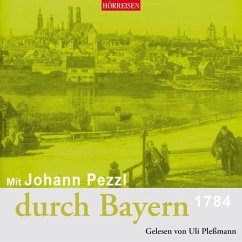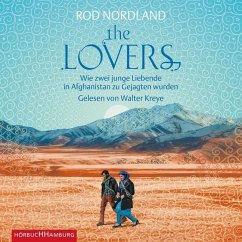-14%20)

Ich habe auch gelebt!
Briefe einer Freundschaft. 471 Min.. CD Standard Audio Format.Lesung
Herausgegeben: Andersen, Jens; Glargaard, Jette;Übersetzung: Kutsch, Angelika; Allenstein, Ursel; Jakobeit, Brigitte
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Statt: 14,00 €**
11,99 €
inkl. MwSt.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
Mit ihrer deutschen Freundin Louise Hartung tauschte Astrid Lindgren sich über viele Fragen aus, die sie bewegten. Im Herbst 1953 lernten die beiden sich in Berlin kennen und begleiteten einander von da an durchs Leben. Ihre Briefe sind das Porträt der engen Freundschaft zweier kluger, eigenwilliger und mutiger Frauen und spiegeln ein sehr persönliches Bild vom Leben in Deutschland und Schweden in einer Zeit des Wiederaufbaus und gesellschaftlichen Umbruchs wider.
Großartig interpretiert von Eva Mattes, der Synchronstimme von Pippi Langstrumpf, und Oda Thormeyer.
Großartig interpretiert von Eva Mattes, der Synchronstimme von Pippi Langstrumpf, und Oda Thormeyer.




 buecher-magazin.de1953 lernte Astrid Lindgren Louise Hartung kennen, mit der sie einen zwölf Jahre langen, intensiven Briefwechsel führte. Louise Hartung war Sängerin, deren Karriere mit Hitlers Machtergreifung endete. Nach dem Krieg arbeitete sie in der Berliner Verwaltung und engagierte sich für die Leseförderung. Sie lud Lindgren daher nach Berlin ein und brachte sie in ihrer Wohnung in Wilmersdorf unter. Es entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, die in Liebe umschlug. Louise verliebte sich in Astrid, die diese Liebe nicht entgegnete. In den Briefen balancieren sie zwischen Freundschaft und Liebe, Zurückhaltung und Überschwang. Gleichzeitig sind diese Briefe ein Blick in die 50er- und 60er-Jahre. Eva Mattes und Oda Thormeyer lesen diesen Briefwechsel brillant. Oda Thormeyer liest in einem ausgeglichenen, zurückhaltenden Ton die sachliche, zupackende Hartung. Eva Mattes die melancholische, im Herzen immer ein Kind gebliebene Astrid Lindgren. Sie erwecken mit ihren Stimmen und ihrer Lesekunst diese außergewöhnliche Beziehung zum Leben.
buecher-magazin.de1953 lernte Astrid Lindgren Louise Hartung kennen, mit der sie einen zwölf Jahre langen, intensiven Briefwechsel führte. Louise Hartung war Sängerin, deren Karriere mit Hitlers Machtergreifung endete. Nach dem Krieg arbeitete sie in der Berliner Verwaltung und engagierte sich für die Leseförderung. Sie lud Lindgren daher nach Berlin ein und brachte sie in ihrer Wohnung in Wilmersdorf unter. Es entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, die in Liebe umschlug. Louise verliebte sich in Astrid, die diese Liebe nicht entgegnete. In den Briefen balancieren sie zwischen Freundschaft und Liebe, Zurückhaltung und Überschwang. Gleichzeitig sind diese Briefe ein Blick in die 50er- und 60er-Jahre. Eva Mattes und Oda Thormeyer lesen diesen Briefwechsel brillant. Oda Thormeyer liest in einem ausgeglichenen, zurückhaltenden Ton die sachliche, zupackende Hartung. Eva Mattes die melancholische, im Herzen immer ein Kind gebliebene Astrid Lindgren. Sie erwecken mit ihren Stimmen und ihrer Lesekunst diese außergewöhnliche Beziehung zum Leben.