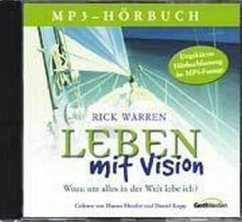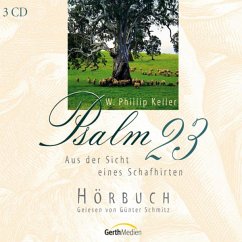-19%20)

Ich war BILD. Ein Leben zwischen Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandalen
Ungekürzte Autorenlesung mit Kai Diekmann (2 mp3-CDs). 912 Min.. Lesung
Gesprochen: Diekmann, Kai
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Statt: 34,00 €**
27,45 €
inkl. MwSt.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
14 °P sammeln!
16 Jahre, so lange wie kein anderer, hat Kai Diekmann als Chefredakteur der BILD bestimmt, worüber Deutschland spricht - jetzt spricht er erstmals selbst und gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Europas größter Boulevardzeitung. Er erzählt von Wulffs legendärem Anruf, von der Abhöraffäre Wallraff, von Putins Badehose und Erdogans Ausfälligkeiten, von der tiefen Freundschaft zu Helmut Kohl und dem einzigen Interview, das Trump je einem deutschen Journalisten gab. Auf Basis bislang unbekannter Dokumente entsteht eine überraschend andere Geschichte der Berliner Republik -...
16 Jahre, so lange wie kein anderer, hat Kai Diekmann als Chefredakteur der BILD bestimmt, worüber Deutschland spricht - jetzt spricht er erstmals selbst und gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Europas größter Boulevardzeitung. Er erzählt von Wulffs legendärem Anruf, von der Abhöraffäre Wallraff, von Putins Badehose und Erdogans Ausfälligkeiten, von der tiefen Freundschaft zu Helmut Kohl und dem einzigen Interview, das Trump je einem deutschen Journalisten gab. Auf Basis bislang unbekannter Dokumente entsteht eine überraschend andere Geschichte der Berliner Republik - eine rasante Erzählung voller Enthüllungen.Ungekürzte Autorenlesung mit Kai Diekmann2 mp3-CDs ca. 15 h 12 min