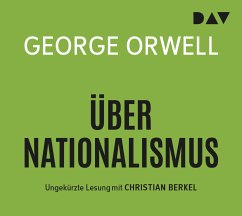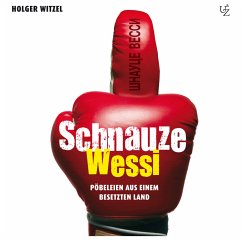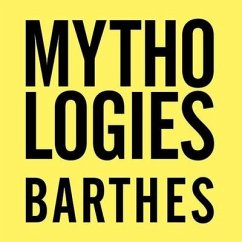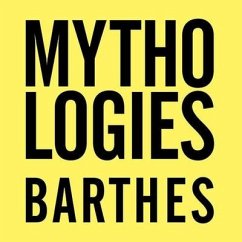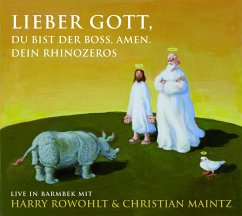-13%20)

Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel
Ausgewählte Reden und Aufsätze. 220 Min.. CD Standard Audio Format.Lesung
Gesprochen: Müller, Herta
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Statt: 19,99 €**
17,45 €
inkl. MwSt.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!
Mit ihren Romanen ist Herta Müller berühmt geworden - in ihren Essays gibt sie Auskunft über sich und ihre Zeit. Wohl nirgends ist ihr bizarrer Weg aus einem Dorf in Rumänien in die Welt der Literatur so gut nachvollziehbar. In den ausgewählten Texten erzählt sie von Kindheit und Jugend, berichtet von den Verfolgungen durch die Geheimpolizei, aber sie widmet sich auch Fragen ihres eigenen Schreibens, seinen literarischen und politischen Seiten.
Mit der Stockholmer Rede zur Nobelpreisverleihung und der Tischrede im Originalton.
Mit der Stockholmer Rede zur Nobelpreisverleihung und der Tischrede im Originalton.