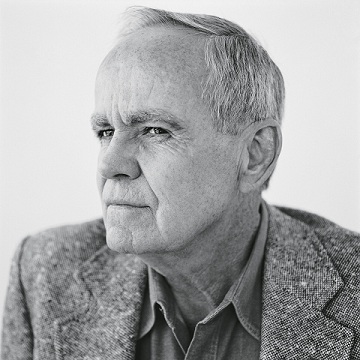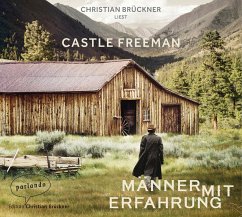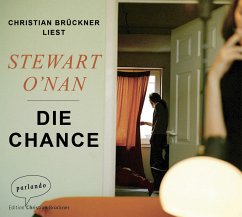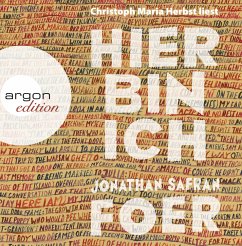-69%25)

Kein Land für alte Männer, 7 Audio-CDs (Restauflage)
Ungekürzte Lesung. 508 Min.
Gesprochen von Brückner, Christian
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
UVP: 34,95 €**
Als Restexemplar::
Als Restexemplar::
10,89 €
inkl. MwSt.
**Frühere Preisbindung aufgehoben
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Ein packender literarischer Thriller von Pulitzerpreisträger Cormac McCarthy über Drogen, Geld und den Sinn der Gerechtigkeit.Hobby-Jäger Bill Moss stößt bei einem morgendlichen Ausflug in die texanische Wüste auf die Überreste eines Massakers. Zerschossene Autos, mehrere Leichen, kiloweise Drogen und ein Koffer voller Dollars. Ein außer Kontrolle geratener Drogendeal, wie er in dieser Gegend häufiger vorkommt. Moss schnappt sich den Koffer und haut ab. Als er in der Nacht zurückkehrt, um seine Spuren zu verwischen, warten bereits mit MPs bewaffnete Gangster auf ihn. Noch kann er ent...
Ein packender literarischer Thriller von Pulitzerpreisträger Cormac McCarthy über Drogen, Geld und den Sinn der Gerechtigkeit.
Hobby-Jäger Bill Moss stößt bei einem morgendlichen Ausflug in die texanische Wüste auf die Überreste eines Massakers. Zerschossene Autos, mehrere Leichen, kiloweise Drogen und ein Koffer voller Dollars. Ein außer Kontrolle geratener Drogendeal, wie er in dieser Gegend häufiger vorkommt. Moss schnappt sich den Koffer und haut ab. Als er in der Nacht zurückkehrt, um seine Spuren zu verwischen, warten bereits mit MPs bewaffnete Gangster auf ihn. Noch kann er entkommen, aber die Killer jagen ihn. Gejagt wird er auch von Provinzsheriff Bell, der mit dem modernen Verbrechen nicht mehr zurechtkommt, ja nicht einmal mehr weiß, was gut, was böse ist. Ein Inferno der Gewalt beginnt...
Einmal mehr zeigt sich hier McCarthys radikaler Kulturpessimismus, der in die Abgründe menschlichen Verhaltens führt.
Hobby-Jäger Bill Moss stößt bei einem morgendlichen Ausflug in die texanische Wüste auf die Überreste eines Massakers. Zerschossene Autos, mehrere Leichen, kiloweise Drogen und ein Koffer voller Dollars. Ein außer Kontrolle geratener Drogendeal, wie er in dieser Gegend häufiger vorkommt. Moss schnappt sich den Koffer und haut ab. Als er in der Nacht zurückkehrt, um seine Spuren zu verwischen, warten bereits mit MPs bewaffnete Gangster auf ihn. Noch kann er entkommen, aber die Killer jagen ihn. Gejagt wird er auch von Provinzsheriff Bell, der mit dem modernen Verbrechen nicht mehr zurechtkommt, ja nicht einmal mehr weiß, was gut, was böse ist. Ein Inferno der Gewalt beginnt...
Einmal mehr zeigt sich hier McCarthys radikaler Kulturpessimismus, der in die Abgründe menschlichen Verhaltens führt.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.