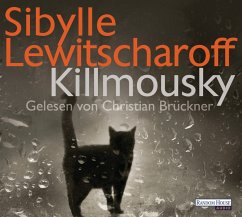Ein Mann, ein Kater, ein Mord.
Was jetzt? Frauen? Zigaretten? Whiskey? Den lieben langen Tag? Richard Ellwanger ist es ein Rätsel, wie er von nun an seine Zeit verbringen soll. Den Dienst als Kriminalhauptkommissar hat er quittiert, nachdem er, der "Verhör-Ellwanger", die raffinierteste Verhörbegabung Münchens, einem Verdächtigen gegenüber die Beherrschung verloren hat. Da winkt ein Auftrag im fernen New York: Eine begüterte Frau ist zu Tode gekommen, und ihre Schwester und ihr Vater beschuldigen den trauernden Ehemann, ein anderer zu sein, als er vorgibt. Sie beauftragen Ellwanger mit privaten Ermittlungen. Und das heißt für den Mann aus dem Hohenlohischen nicht nur, seinen schwarzfelligen Hausgenossen Killmousky den Nachbarn anzuvertrauen. Es heißt auch, sich in einer Metropole zurechtzufinden, in der ihm die Sprache nicht behagt, die Gepflogenheiten der oberen Zehntausend fremd sind und ein möglicher Mörder lebt, der vielleicht aus Ellwangers Heimat stammt und dessen Persönlichkeit den Ex-Kommissar zunehmend fasziniert.
Die Sprachvirtuosin Sibylle Lewitscharoff nimmt sich eines Genres an, das mit ihr Millionen lieben: Killmousky ist ein grandioser Kriminalroman, in dem New York und die hohenlohische Provinz gleichermaßen unter Schneebergen begraben liegen, und zugleich ein Hörgenuss höchster Güte.
(5 CDs, Laufzeit: 6h)
Was jetzt? Frauen? Zigaretten? Whiskey? Den lieben langen Tag? Richard Ellwanger ist es ein Rätsel, wie er von nun an seine Zeit verbringen soll. Den Dienst als Kriminalhauptkommissar hat er quittiert, nachdem er, der "Verhör-Ellwanger", die raffinierteste Verhörbegabung Münchens, einem Verdächtigen gegenüber die Beherrschung verloren hat. Da winkt ein Auftrag im fernen New York: Eine begüterte Frau ist zu Tode gekommen, und ihre Schwester und ihr Vater beschuldigen den trauernden Ehemann, ein anderer zu sein, als er vorgibt. Sie beauftragen Ellwanger mit privaten Ermittlungen. Und das heißt für den Mann aus dem Hohenlohischen nicht nur, seinen schwarzfelligen Hausgenossen Killmousky den Nachbarn anzuvertrauen. Es heißt auch, sich in einer Metropole zurechtzufinden, in der ihm die Sprache nicht behagt, die Gepflogenheiten der oberen Zehntausend fremd sind und ein möglicher Mörder lebt, der vielleicht aus Ellwangers Heimat stammt und dessen Persönlichkeit den Ex-Kommissar zunehmend fasziniert.
Die Sprachvirtuosin Sibylle Lewitscharoff nimmt sich eines Genres an, das mit ihr Millionen lieben: Killmousky ist ein grandioser Kriminalroman, in dem New York und die hohenlohische Provinz gleichermaßen unter Schneebergen begraben liegen, und zugleich ein Hörgenuss höchster Güte.
(5 CDs, Laufzeit: 6h)
| CD 1 | |||
| 1 | Killmousky | 00:09:19 | |
| 2 | Killmousky | 00:09:28 | |
| 3 | Killmousky | 00:10:20 | |
| 4 | Killmousky | 00:08:48 | |
| 5 | Killmousky | 00:10:30 | |
| 6 | Killmousky | 00:09:00 | |
| 7 | Killmousky | 00:08:29 | |
| 8 | Killmousky | 00:07:44 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Killmousky | 00:06:07 | |
| 2 | Killmousky | 00:07:36 | |
| 3 | Killmousky | 00:07:16 | |
| 4 | Killmousky | 00:06:01 | |
| 5 | Killmousky | 00:05:52 | |
| 6 | Killmousky | 00:05:04 | |
| 7 | Killmousky | 00:07:12 | |
| 8 | Killmousky | 00:05:29 | |
| 9 | Killmousky | 00:06:13 | |
| 10 | Killmousky | 00:09:42 | |
| 11 | Killmousky | 00:05:36 | |
| CD 3 | |||
| 1 | Killmousky | 00:08:27 | |
| 2 | Killmousky | 00:09:16 | |
| 3 | Killmousky | 00:07:54 | |
| 4 | Killmousky | 00:07:12 | |
| 5 | Killmousky | 00:07:07 | |
| 6 | Killmousky | 00:08:21 | |
| 7 | Killmousky | 00:08:03 | |
| 8 | Killmousky | 00:08:21 | |
| 9 | Killmousky | 00:08:53 | |
| CD 4 | |||
| 1 | Killmousky | 00:06:00 | |
| 2 | Killmousky | 00:08:06 | |
| 3 | Killmousky | 00:05:28 | |
| 4 | Killmousky | 00:08:06 | |
| 5 | Killmousky | 00:05:37 | |
| 6 | Killmousky | 00:05:56 | |
| 7 | Killmousky | 00:04:31 | |
| 8 | Killmousky | 00:09:07 | |
| 9 | Killmousky | 00:07:18 | |
| 10 | Killmousky | 00:07:16 | |
| 11 | Killmousky | 00:04:33 | |

Mit ihrem ersten Krimi wagt sich Sibylle Lewitscharoff auf ein neues Terrain. "Killmousky" ist ein literarisches Spiel. Aber kennt die Autorin auch die Regeln?
Sibylle Lewitscharoff hat eine Art Kriminalroman geschrieben. Kurz, worum es geht: Ein Kommissar ist vorzeitig aus dem Dienst ausgeschieden, weil er einem Entführer zweier Kinder Gewalt angedroht hat. Lewitscharoff spielt auf den Fall Gäfgen an. Als der Kommissar eines Abends fernsieht, steht ein Kater, den er soeben noch in einem Fernsehkrimi gesehen hat, plötzlich in seiner Wohnung. Lewitscharoff spielt auf ihren Roman "Blumenberg" und die dortige Erscheinung eines Löwen an. Der Kommissar, der sich trotz Katers langweilt, bekommt als Privatdetektiv einen Fall in New York, wo eine Millionenerbin vom Balkon fiel, deren Vater nicht an Selbstmord glaubt, sondern daran, dass der Ehemann ein Heiratsschwindler mit eventuell deutscher Herkunft ist. Lewitscharoff spielt auf den Fall Gerhartsreiter an. Der Ermittler ermittelt hin und her, aber viel mehr als eine Nacht mit der reizvollen älteren Schwester des Opfers will ihm nicht gelingen. Lewitscharoff spielt auf Raymond Chandler an.
Sibylle Lewitscharoff spielt also überhaupt auf viel an. Mit ihrem Buch könnte man es sich insofern ganz einfach machen. Es will ein Kriminalroman sein, aber es ist nur eine Anspielung auf einen Kriminalroman. Die Figuren sind Abziehbilder: der orientierungsarme Ermittler, die treue Seele, der scharfkantige Millionär im Rollstuhl, der kein Wort zu viel sagt, die abgebrühte Schönheit, "reich, verwöhnt, egoistisch". Die Handlung ist vollkommen fade. Der Detektiv steht trotz vielen Stocherns hier und dort sowie mancher Fremdheitserfahrung mit der New Yorker Oberschicht, die so ist, wie wir sie aus dem Kino kennen, nach hundertachtzig Seiten mit völlig leeren Händen da. Da muss der Täter sich ihm praktisch aufdrängen und versuchen, den Ermittler mit dem Argument, irgendwann wäre dieser ja doch draufgekommen - glauben wir nicht -, umzubringen. Die Schwester des Opfers erledigt als "dea ex machina" kurz vor Schluss den Rest.
Also haben wir nun unsrerseits einen rätselhaften Fall. Uninteressante Krimis gibt es viele. Merkwürdig aber ist es, wenn eine Autorin, von der es in der Laudatio zu ihrem Büchnerpreis hieß, ihr sei keine Kühnheit fremd, und die in die Tradition des phantastischen Realismus gestellt wurde, in einem ihr offenbar fremden Genre eine komplett banale Geschichte veröffentlicht, die noch dazu in einer zugleich lustlosen wie prätentiösen Haltung geschrieben ist.
Beweise? Lewitscharoff formuliert Sätze wie diesen: "Sie kannte die Welt viel besser als er und war in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen." Was heißt in diesem Satz "und"? Das Aufwachsen kommt zeitlich und dem Grunde nach vor der Weltkenntnis. Oder es heißt: "Obwohl sie keine habhaften erotischen Beziehungen unterhielten, hätte er sich nicht gescheut, zu sagen, er liebe Frau Kirchschlager." Das schwäbische "habhaft" für "sättigend" oder "reichhaltig" mag auch erotische Beziehungen beschreiben, aber wozu das gespreizte "hätte er sich nicht gescheut"? Muss denn Liebesbekundung eine Scheu überwinden, die daherkommt - "obwohl" -, dass sie nicht auf erotischer Sättigung beruht? Dass eine andere Frau "sich vor ihm wie die Schlange im Garten Eden auf dem Sofa gerekelt hatte", suggeriert nicht nur, dass es im Paradies Sofas gab, sondern dass die Schlange Adam verführt hat, was ebenfalls neu wäre.
Sind das Kleinigkeiten? Sind wir zu pedantisch? Bei einem Debütanten im Selbstverlag wäre das so. Aber bei der "Sprachvirtuosin", als die uns der Verlag die Autorin ankündigt? Wenn eine Frau den Detektiv mustert, heißt es, dass sie "eine Musterung vornahm". Wenn er einen Schönling beurteilt, sagt er "Sieht verflucht gut aus, außerordentlich gut sogar", so, als sei "außerordentlich" die Steigerung von "verflucht". Wenn ihr Detektiv vor der zweiten Tasse Kaffee immer eine Zigarette raucht, heißt es: "Das würde er wahrscheinlich die nächsten Jahre über beibehalten." Wahrscheinlich - also soll es wohl erlebte Rede sein. Aber wer denkt von sich selbst, "das werde ich die nächsten Jahre wahrscheinlich beibehalten", wenn er einer Gewohnheit folgt, zumal wenn es eine ist, der er bislang immer folgte? Nächster Satz: "Aber vielleicht änderten sich seine Gewohnheiten ab jetzt radikal." Die Autorin schreibt also (1) er raucht immer vor dem zweiten Kaffee, (2) wahrscheinlich behält er das bei, (3) vielleicht aber auch nicht.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass hier jemand geschrieben hat, dem jedenfalls ohne Selbst- oder Fremdkontrolle keine besonders durchdachten Sätze gelingen. Oder der findet, dass für einen Krimi keine besondere Mühe nötig ist? Das wirkt umso merkwürdiger, als die Erzählerin von mehr als einer Person im Roman anerkennend vermerkt, dass loses Geschwätz ihre Sache nicht ist. Gewiss, Lewitscharoff schwätzt nicht, aber sie redet vor sich hin. "Das zierliche Männchen war nicht der Typ des jovialen, großgewachsenen amerikanischen Helden" - ja, für manche zierlichen Männchen gilt das, dass sie einfach nicht großgewachsen sind.
Helmut Schelsky hat einmal von den Intellektuellen gesagt, sie beanspruchten "das Recht auf die Freizeit der anderen". Damit ist auch die Verantwortung berührt, die Schriftsteller haben: sich Mühe zu geben wäre das mindeste. Hier ist es nicht geschehen.
Das führt zum eigentlichen Problem dieses Buches. Im Suhrkamp Verlag hat man vor ein paar Jahren erfolgreich begonnen, den Kriminalroman zu pflegen. Es gibt also Wissen über die Standards dieser Gattung im Haus. Es gibt Lektoren, die wissen, dass man den Satz, jemand sei vielleicht berechnend und zugleich verlogen, "aber das machte ihn noch nicht zum Mörder", einem Kommissar nicht als Gedanken unterschieben sollte, wenn man sich nicht beim "Tatort" bewerben möchte, so abgegriffen ist die Phrase. Ein Verlag, der Don Winslow und Reginald Hill im Programm hat, weiß, was ein gut konstruierter Plot ist, wie man mit den Nerven von Lesern spielt, wie man ihren Intellekt nicht beleidigt.
Doch es war offenbar niemand da, um die verführerische Idee, eine Büchnerpreisträgerin schreibe in einem Genre, "das mit ihr Millionen lieben", wie es im Begleittext heißt, einer Wirklichkeitsprüfung auszusetzen. Denn wenn die Autorin das Genre liebt, warum geht sie dann so lieblos mit ihm um? Der Verlag hat vorgezogen, auf das Ergebnis "grandioser Kriminalroman" draufzuschreiben. Bei allem Verständnis für Reklame - auch für Bücher sollte es Normen der Produktinformation geben und also Grenzen der Produktdesinformation. Denn wenn das hier ein grandioser Kriminalroman ist, dann ist Zwieback ein Halluzinogen.
JÜRGEN KAUBE
Sibylle Lewitscharoff:
"Killmousky". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2014. 223 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
""Killmousky" ist ein unterhaltsamer Kriminalroman und zugleich ein Hörgenuss höchster Güte." hoerbuch-aktuell.de