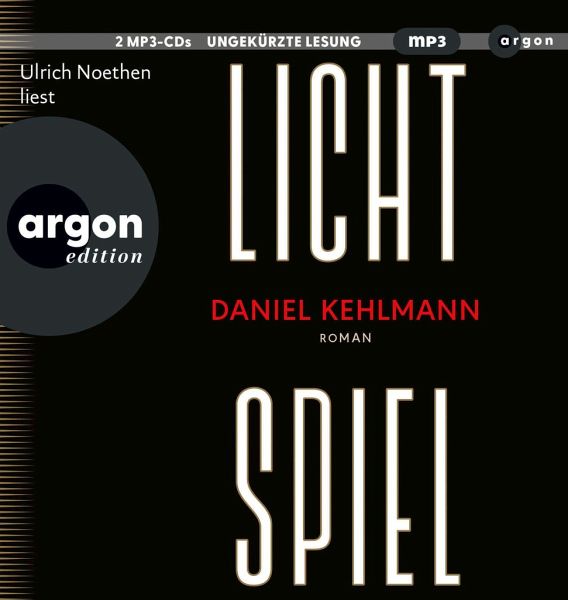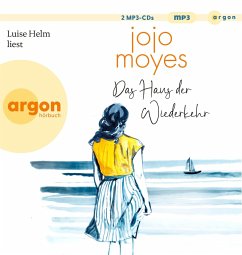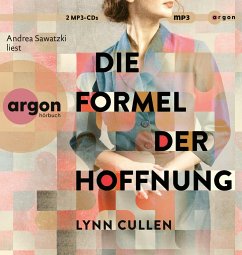Daniel Kehlmann
MP3-CD
Lichtspiel
Roman. 739 Min.. Lesung. Ungekürzte Ausgabe
Gesprochen: Noethen, Ulrich
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Statt: 30,00 €**
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
11 °P sammeln!





Einer der Größten des Kinos, vielleicht der größte Regisseur seiner Epoche: Zur Machtergreifung dreht G.W. Pabst in Frankreich; vor den Gräueln des neuen Deutschlands flieht er nach Hollywood. Aber unter der blendenden Sonne Kaliforniens sieht der weltberühmte Regisseur mit einem Mal aus wie ein Zwerg. Nicht einmal Greta Garbo, die er unsterblich gemacht hat, kann ihm helfen. Und so findet Pabst sich, fast wie ohne eigenes Zutun, in seiner Heimat Österreich wieder, die nun Ostmark heißt. Die barbarische Natur des Regimes spürt die heimgekehrte Familie mit aller Deutlichkeit. Doch der ...
Einer der Größten des Kinos, vielleicht der größte Regisseur seiner Epoche: Zur Machtergreifung dreht G.W. Pabst in Frankreich; vor den Gräueln des neuen Deutschlands flieht er nach Hollywood. Aber unter der blendenden Sonne Kaliforniens sieht der weltberühmte Regisseur mit einem Mal aus wie ein Zwerg. Nicht einmal Greta Garbo, die er unsterblich gemacht hat, kann ihm helfen. Und so findet Pabst sich, fast wie ohne eigenes Zutun, in seiner Heimat Österreich wieder, die nun Ostmark heißt. Die barbarische Natur des Regimes spürt die heimgekehrte Familie mit aller Deutlichkeit. Doch der Propagandaminister in Berlin will das Filmgenie haben, er kennt keinen Widerspruch, und er verspricht viel. Während Pabst noch glaubt, dass er dem Werben widerstehen, dass er sich keiner Diktatur als der der Kunst fügen wird, ist er schon den ersten Schritt in die rettungslose Verstrickung gegangen.
Daniel Kehlmanns Roman über Kunst und Macht, Schönheit und Barbarei ist ein Triumph. Lichtspiel zeigt, was Literatur vermag: durch Erfindung die Wahrheit hervortreten zu lassen.
Ulrich Noethens warmes, dunkles Timbre lässt eine intime und eindrückliche Stimmung entstehen.
Daniel Kehlmanns Roman über Kunst und Macht, Schönheit und Barbarei ist ein Triumph. Lichtspiel zeigt, was Literatur vermag: durch Erfindung die Wahrheit hervortreten zu lassen.
Ulrich Noethens warmes, dunkles Timbre lässt eine intime und eindrückliche Stimmung entstehen.
Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, wurde für sein Werk unter anderem mit dem Candide-Preis, dem Per-Olov-Enquist-Preis, dem Kleist-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Sein Roman Die Vermessung der Welt war eines der erfolgreichsten deutschen Bücher der Nachkriegszeit, und auch sein Roman Tyllstand monatelang auf den Bestsellerlisten und gelangte auf die Shortlist des International Booker Prize. Daniel Kehlmann lebt in Berlin. Ulrich Noethen gehört zu den vielseitigsten und beliebtesten Schauspielern Deutschlands. Sein warmes, dunkles Timbre lässt eine intime und eindrückliche Stimmung entstehen. Für seine Lesung von Friedrich Anis Roman Nackter Mann, der brennt erhielt er den Deutschen Hörbuchpreis 2017.

Produktdetails
- Verlag: Argon Verlag
- Anzahl: 2 MP3-CDs
- Gesamtlaufzeit: 739 Min.
- Erscheinungstermin: 13. Oktober 2023
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783839820827
- Artikelnr.: 67796109
Herstellerkennzeichnung
Argon Verlag AVE GmbH (7%)
Waldemarstr. 33a
10999 Berlin
www.argon-verlag.de
»[Georg Wilhelm Pabsts] unheilvollen Verstrickungen in die Propagandamaschinerie der Nationalsozialisten erzählt Daniel Kehlmann nuanciert und eindrucksvoll. Ulrich Noethens Interpretation macht daraus ein besonderes Kunstwerk: Ob innerer Monolog, Gesprächsszene oder Erzählerpassagen, jeder Situation verleiht Noethen eine passende Atmosphäre. Seine feine Stimmführung beeindrucken ungemein.« hr2 Hörbuchbestenliste 20231130
Perlentaucher-Notiz zur FAS-Rezension
Mit Gewinn liest Rezensent Peter Körte Daniel Kehlmanns Roman, der sich dem Leben des Filmregisseurs Georg Wilhelm Pabst widmet. Pabst hatte in der Stummfilmzeit gefeierte Meisterwerke gedreht, aber er hat auch während der NS-Zeit in Deutschland Filme gedreht, was seinen Ruf nachhaltig beschädigt hat. Kehlmann gelinge es aus diesen - mit fiktionalen Zusätzen angereicherten - "Unglücksjahren" des Regisseurs mit am Kino geschulten literarischen Mitteln ein wichtiges Buch über Kunst und Korruption, und auch über die Verstrickung von Kunst und Leben zu schreiben. Die drei Hauptteile des Romans widmen sich, lernen wir, Pabsts Scheitern in Hollywood Anfang der 1930er, der Arbeit in Nazideutschland,
Mehr anzeigen
sowie der Nachkriegszeit. Tolle Szenen findet Körte in diesen Kapiteln, etwa in den Begegnungen Pabsts mit Goebbels oder Leni Riefenstahl, auch der häufige Wechsel der Perspektive mache das Buch vielschichtig. Besonders wichtig ist der verschollene letzte NS-Film Pabsts, "Der Fall Molander", basierend auf dem Roman eines Naziautors. In Kehlmanns Buch wird dieser Film, heißt es weiter, zu einer Obsession des Regisseurs, der glaubt, ein monumentales Meisterwerk zu fertigen und auch das Ende des Weltkriegs nur als Problem für sein Filmprojekt betrachten kann. Die Zeit nach dem Krieg erscheint hingegen als eine einzige Trostlosigkeit, führt Körte aus, überhaupt kommt Pabst bei Kehlmann insgesamt ziemlich schlecht weg. Allerdings gehe es dem Autor nicht um ein moralisches Urteil, sondern darum, zu zeigen, dass Kunst und Leben stets zusammen zu denken sind.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Schließen
Der Autor hat die Atmosphäre moralischer Zwielichtigkeit, die diesen Roman durchtränkt, perfekt im Griff ... ein überragender Erzähler. David Segal The New York Times 20250430
Gebundenes Buch
Seit seinem Erfolgsroman "Die Vermessung der Welt" schätze ich Daniel Kehlmann als großartigen Erzähler, der historische Figuren mit Witz und Intelligenz zum Leben erweckt. Das ist ihm auch in seinem neuesten Werk gelungen, und er zieht aus seinem literarischen …
Mehr
Seit seinem Erfolgsroman "Die Vermessung der Welt" schätze ich Daniel Kehlmann als großartigen Erzähler, der historische Figuren mit Witz und Intelligenz zum Leben erweckt. Das ist ihm auch in seinem neuesten Werk gelungen, und er zieht aus seinem literarischen Werkzeugkasten so manche Überraschung.
Gleich zu Beginn der Geschichte beeindruckte er mich mit der Darstellung von Pabsts ehemaligem Regieassistenten beim Auftritt in einer Fernseh-Talkshow. Psychologisch einfühlsam zeigt Kehlmann, wie der an Demenz erkrankte ältere Herr verzweifelt versucht, Erinnerungslücken zu füllen, wie ihn seine Krankheit und die Reaktionen der Umgebung verunsichern und er dadurch aggressiv wird. Ein weiteres Glanzstück ist eine geradezu surreal anmutende Szene, in der Pabst vor den NS-Propagandaminister Goebbels zitiert und von diesem vorgeführt wird.
Der Roman gliedert sich in drei große Teile: Pabsts erfolgloser Versuch, in Hollywood Fuß zu fassen, seine Rückkehr ins Deutsche Reich (die eigentlich nur als kurze Stippvisite geplant war und mehr oder weniger erzwungen wurde) sowie die Zeit nach Kriegsende. Neben wirklich großartigen Szenen muss man sich leider auch durch Mittelmäßiges lesen. Kehlmann verliert sich einerseits in biografischen Details und lässt es andererseits an Tiefe fehlen. Vor allem das ethische Versagen seines Protagonisten erschließt sich mir nicht, wodurch dreht sich Pabsts moralischer Kompass von gut zu böse? Und wieso erfindet Kehlmann für das Ehepaar Pabst einen Sohn?
Auch einige Nebenfiguren fand ich recht seltsam dargestellt. Greta Garbo und Louise Brooks wirken schablonenhaft, Leni Riefenstahl gerät zu einem tumben Hanswurst. Kehlmann überträgt viele Filmtechniken ins Literarische, "Lichtspiel" ist voller Überblendungen und Loops, es gibt häufige Perspektivwechsel und Szenen im magischen Realismus. Doch leider zieht sich Vieles zu sehr in die Länge oder bleibt an der Oberfläche, so dass mich die Geschichte leider trotz der abwechslungsreichen Erzähltechnik immer wieder gelangweilt hat.
Fazit: Einige hervorragende Abschnitte, aber als Ganzes doch etwas enttäuschend.
Weniger
Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Daniel Kehlmann entführt die Leser in seinem Buch 'Lichtspiel' in die faszinierende und düstere Welt des Films während einer turbulenten Zeit der Geschichte. Das Buch erzählt die Geschichte von G. W. Pabst, einem der größten Regisseure seiner Zeit, der vor den …
Mehr
Daniel Kehlmann entführt die Leser in seinem Buch 'Lichtspiel' in die faszinierende und düstere Welt des Films während einer turbulenten Zeit der Geschichte. Das Buch erzählt die Geschichte von G. W. Pabst, einem der größten Regisseure seiner Zeit, der vor den Gräueln des neuen Deutschlands flieht und in Hollywood Zuflucht sucht.
Der Roman zeichnet ein lebendiges Bild von Pabsts dramatischer Flucht vor dem aufkommenden Naziregime und seiner Ankunft im sonnigen Kalifornien. Doch trotz seiner internationalen Anerkennung und der unvergesslichen Filme, die er gedreht hat, findet sich Pabst in einer Welt wieder, in der er nicht mehr die gleiche Bedeutung hat. Die Beschreibung seiner plötzlichen Kleinheit und Unsichtbarkeit in der scheinbar glamourösen Welt des Films ist beeindruckend und berührend.
Besonders faszinierend ist die Darstellung der inneren Konflikte, denen Pabst ausgesetzt ist. Die Versuchung, in die Arme des Propagandaministers in Berlin zurückzukehren, der verspricht, ihm viel Macht und Einfluss zu geben, wird auf meisterhafte Weise dargestellt. Die Frage nach der Macht der Kunst und der Kunst des Widerstands gegen eine brutale Diktatur wird in diesem Buch auf tiefgreifende Weise erforscht.
Kehlmanns Schreibstil ist präzise und einfühlsam. Er vermittelt die Atmosphäre der Zeit und die Emotionen der Charaktere auf eine Weise, die den Leser tief in die Geschichte eintauchen lässt. Die innere Zerrissenheit von Pabst, seine Ängste und Hoffnungen, werden lebhaft und einfühlsam dargestellt.
'Lichtspiel' ist ein eindrucksvoller historischer Roman, der nicht nur die Filmgeschichte, sondern auch die politischen und moralischen Herausforderungen einer dunklen Ära beleuchtet. Es ist ein Buch über die Macht der Kunst und die Verlockung der Macht, über das Ringen mit den eigenen Prinzipien und die Suche nach einem Ausweg aus der Verstrickung. Ein fesselndes und tiefgründiges Werk, das zum Nachdenken anregt und den Leser in die Welt des Films und der Geschichte eintauchen lässt.
Weniger
Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Im falschen Film?
„‘Wir bleiben nicht lang‘, sagt sie. ‚Keine Sorge. Wir reisen bald.‘ “
Georg Wilhelm Pabst gehörte während der Weimarer Republik zu den Top – Regisseuren jener Zeit. Der Österreicher konnte sich neben Fritz Lang, F.W. …
Mehr
Im falschen Film?
„‘Wir bleiben nicht lang‘, sagt sie. ‚Keine Sorge. Wir reisen bald.‘ “
Georg Wilhelm Pabst gehörte während der Weimarer Republik zu den Top – Regisseuren jener Zeit. Der Österreicher konnte sich neben Fritz Lang, F.W. Murnau und Ernst Lubitsch einen Namen machen. Als Vertreter der „Neuen Sachlichkeit“ arbeitete er mit (Stummfilm)Stars wie Louise Brooks, Greta Garbo oder Asta Nielsen zusammen. Erfolg hatte er jedoch auch mit dem 1931 gedrehten Tonfilm „Die Dreigroschenoper“. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten emigrierte er in die USA, anders als etwa der großartige Billy Wilder („Eins, Zwei, Drei“) konnte er jedoch nicht an seinen früheren Ruhm anknüpfen, waren es widrige Umstände oder Pabsts Unfähigkeit zur Assimilation, die dazu führten, dass er in Hollywood keinen Fuß auf den Boden bekam?
Daniel Kehlmann geht in seinem Roman „Lichtspiel“ unter anderem der Frage nach, wie es dazu kam, dass der eigentlich ‚linke‘ Filmemacher Pabst zum Werkzeug des NS - Regimes wurde, da er nach einem Heimatbesuch in Österreich 1939 bei der „Bavaria Film“ anheuerte.
„Lichtspiel“ ist nicht nur für Cineasten interessant. Ich war bereits während der Lektüre der Exposition „angefixt“, man begleitet als Leser zunächst den Kamerassistenten Franz Wilzek. Die Geschichte oszilliert zwischen Fakten und Fiktion, der Autor beschreibt wunderbar den ‚Nachkriegsmief‘ und die Rechtfertigungsversuche derjenigen, die Teil der nationalsozialistischen Maschinerie waren. Echte oder vorgetäuschte Gedächtnislücken der Protagonisten werden präsentiert. Ganz nebenbei wird auch die Methodik der Geschichtswissenschaft gestreift. Nach der Lektüre des Romans wird man wissen, weswegen Oral History mit Vorsicht zu genießen ist. Es geht auch um Erinnerungskultur(en) und um das kollektive Gedächtnis im deutschen Sprachraum & natürlich um die Tatsache, dass nach Ende des WKII-Dinge unter den Teppich gekehrt wurden, gar durch (mehr oder minder) kitschige Heimatfilme kaschiert wurden, da ist es nicht verwunderlich, dass bekannte Namen auftauchen. Wer kennt nicht einen Peter Alexander? Daniel Kehlmann gibt sich jedoch nicht mit monokausalen Erklärungsmustern zufrieden. Auch die Figurenzeichnung ist gelungen, sprachlich und stilistisch gibt es nichts zu Meckern. Man kann etwas Neues lernen – ich wusste zwar, dass sich zum Beispiel Leni Riefenstahl in den Dienst der Nazis stellte (ebenso wie Veit Harlan oder der Schauspieler Heinrich George, ganz zu schweigen von Kristina Söderbaum), aber mir war vor der Lektüre tatsächlich nicht klar, dass auch G.W. Pabst nicht auf Distanz zu Goebbels & Co. gegangen war, obwohl mir sein Nachkriegsfilm "Es geschah am 20. Juli" durchaus ein Begriff ist. Biographische Fiktion, historischer Roman, politische Parabel: Für „Lichtspiel“ von Daniel Kehlmann spreche ich eine uneingeschränkte Leseempfehlung aus!
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Gustav Gründgens, Heinz Rühmann, Wilhelm Furtwängler - Geschichten der Stars der NS-Zeit wurden schon viele erzählt. Auf den ersten Blick scheint es, dass DANIEL KEHLMANN ihnen mit der des österreichischen Regisseurs G.W.Pabst eine weitere hinzufügt.
Doch was Daniel …
Mehr
Gustav Gründgens, Heinz Rühmann, Wilhelm Furtwängler - Geschichten der Stars der NS-Zeit wurden schon viele erzählt. Auf den ersten Blick scheint es, dass DANIEL KEHLMANN ihnen mit der des österreichischen Regisseurs G.W.Pabst eine weitere hinzufügt.
Doch was Daniel Kehlmann daraus macht, ist im wahrsten Sinne großes Kino. Bis zur Comicreife überzeichnete Charaktere, scharf- und doppelzüngige Schlagabtausche, Komik, bei der das Lachen schon unterhalb des Halses stecken bleibt, rasante Schnitte, schwindelerregende Perspektivwechsel. Ich hatte das Gefühl, mich in einem Kinosessel festschnallen zu müssen, aber nicht, um einem betulichen Unterhaltungs- oder Durchhaltefilm der nazideutschen Propagandamaschinerie zu folgen, sondern in einem Action-Abenteuer der 2000er Jahre.
Nun kann man sich fragen, ob das der Sache dient. Doch was ist eigentlich die Sache? Zunächst mal die vielleicht einzigartige und auch verstörende Geschichte des österreichischen Regisseurs G.W.Pabst zu erzählen. Pabst machte sich in Zeiten der Weimarer Republik unter dem Spitznamen „Der Rote Pabst“ mit pazifistischen linksorientierten Filmen einen Namen, war nach der Machtübernahme 1933 bereits in Amerika und Frankreich erfolgreich und ist durch eine Verkettung verschiedener Umstände 1939 nach Österreich zurückkehrt und geblieben. Und arbeitete. Drehte auf Wunsch und Geheiß von Joseph Goebbels persönlich Filme mit „subtilen Propagandatendenzen“ (Wikipedia).
Daniel Kehlmann lässt ihn sagen: „Die Zeiten sind immer seltsam. Kunst ist immer unpassend. Immer unnötig, wenn sie entsteht. Und später, wenn man zurückblickt, ist sie das Einzige, was wichtig war.“ S. 366
Warum? Warum, fragt man sich die ganze Zeit und auch Daniel Kehlmann sagt in einem Interview, dass, hätte er EINE Frage, die er G.W.Pabst noch stellen dürfe, es die nach dem Warum seiner Rückkehr wäre. Warum tut er sich und seiner Familie das an? Lässt seinen Sohn unter der Nazipropaganda groß, seine Frau fast verrückt vor Angst und Unwohlsein mit dem täglichen Arrangement werden?
Ein lupenreiner Opportunist? Wie weit ist Opportunismus – gerade in der Kunst - ENTschuldbar? Wie weit darf man gehen – für die Kunst? Wann beginnt Schuld? Wenn die Antwort auf diese Fragen so einfach wäre!
Diese Fragen ins Heute zu holen ist meiner Meinung nach die zweite wichtige Sache an diesem Roman. Wie versetzt man der historischen Kulisse einen Anstrich, mit dem uns das Spiel zwischen Macht und Manipulation vs. Anpassung und Duldung direkt vor die Füße fällt? Durch Fiktion, Überzeichnung, Witz, Slapstik, Magie, Illusion und Desillusion, Licht- und Schattenspiele! Das ist nichts zum Wohlfühlen, keine Geschichte, die einem das Herz öffnet. Das ist eine Geisterbahnfahrt durch die Abgründe der menschlichen Seele unter gruppendynamischen Zwängen – nicht nur in totalitären Systemen. Mitreißend erzählt. Fast 500 Seiten ohne einen Moment der Langeweile, selbst wenn das Personal am Set zuweilen etwas unübersichtlich wird und mir nicht jede Szene ihren Sinn erschließt. Wer Freude am Googlen und Faktencheck beim Lesen hat, wird hier auf seine Kosten kommen. Es geht aber auch ohne und wird zum Genuss, wenn man sich dem Sog dieses Spielfilms … äh … Romans überlässt.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein beeindruckender Roman
Lichtspiel von Daniel Kehlmann begleitet den Regisseur G.W. Pabst durch einen prägenden Abschnitt seines Lebens.
Das Buch kommt in einem schlichten, sehr schicken Umschlag. Der Schreibstil des Autors ist sehr gut, man kommt schnell in einen angenehmen …
Mehr
Ein beeindruckender Roman
Lichtspiel von Daniel Kehlmann begleitet den Regisseur G.W. Pabst durch einen prägenden Abschnitt seines Lebens.
Das Buch kommt in einem schlichten, sehr schicken Umschlag. Der Schreibstil des Autors ist sehr gut, man kommt schnell in einen angenehmen Lesefluss.
Das Thema des Romans, Pabsts Rückkehr nach Nazi-Deutschland und sein dortiger Werdegang, ist natürlich kein Einfaches, hier gelingt Kehlmann ein guter und angemessener Umgang mit dem Stoff.
Die Figuren, allen voran die Mitglieder der Familie Pabst, G.W., seine Frau Trude und der Sohn Jakob, sind sehr gelungen und machen spannende Wandlungen im Verlauf des Romans durch. Gerade der Hauptcharakter, dessen Rückkehr in die Heimat sehr naiv erscheint, macht eine spannende Wandlung zum opportunistischen Regisseur durch, dem am Ende vieles Recht scheint um Filmkunst zu schaffen, die den Krieg überdauert.
Insgesamt hat Daniel Kehlmann mit Lichtspiel einen sehr guten Roman geschaffen, der uneingeschränkt zu empfehlen ist.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Wenig nachhaltiges Biopic
Mit seinem neuesten Roman «Lichtspiel» hat Daniel Kehlmann dem in der Weimarer Zeit äußerst erfolgreichen, österreichischen Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst literarisch ein Denkmal gesetzt. Nach der auch in anderen seiner Romane …
Mehr
Wenig nachhaltiges Biopic
Mit seinem neuesten Roman «Lichtspiel» hat Daniel Kehlmann dem in der Weimarer Zeit äußerst erfolgreichen, österreichischen Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst literarisch ein Denkmal gesetzt. Nach der auch in anderen seiner Romane bewährten Methode erzählt der Autor eine fiktive Geschichte, die sich um die reale Figur seines heute kaum noch bekannten Protagonisten rankt, wobei die Problematik künstlerischen Schaffens in einer unmenschlichen Diktatur den thematischen Schwerpunkt bildet.
Der dreiteilige Roman beginnt unter dem Titel «Draußen» in der Emigration des Regisseurs, der als «Roter Regisseur» wegen seiner politischen Überzeugungen in Nazi-Deutschland keine Zukunft mehr für sich gesehen hat und nach Hollywood gegangen ist, obwohl er von der «Filmkunst» dort wenig hält. Eines Tages bekommt er überraschend Besuch von einem Abgesandten des Propaganda-Ministers Goebbels, der ihn nach Deutschland zurückholen will und ihm künstlerische Freiheit und beste Arbeitsbedingungen verspricht. Trotz verlockendem Angebot lehnt Pabst empört ab. Als ihn ein Telegramm zu seiner kranken Mutter zurückruft, reist er mit Frau und Sohn für drei Tage nach Österreich, das inzwischen Ostmark heißt, um sie in einem Pflegeheim nahe Wiens unterzubringen. Am Tag nach ihrer Ankunft bricht der lange erwartete Krieg tatsächlich aus, die Grenzen werden geschlossen, er kann nicht mehr zurück in die USA. Bald darauf wird er zu Goebbels gerufen, der ihm unmissverständlich klarmacht, dass seine Verweigerungs-Haltung böse Konsequenzen für ihn haben würde in Anbetracht seiner kommunistischen Gesinnung. Pabst steigt also notgedrungen wieder ein ins Filmgeschäft und dreht einige erfolgreiche Filme. Sein letztes Werk unter dem Titel «Der Fall Molander» über einen virtuosen Geiger wird wegen der ständigen Luftangriffe in Prag gedreht, wobei der Produzent für eine Massen-Szene im Konzertsaal als Publikum auf KZ-Häftlinge zurückgreifen muss, weil fast alle Männer im Krieg sind. Im Publikum meint er, seinen früheren Arzt als abgemergelte Gestalt wieder zu erkennen, verdrängt dies aber entsetzt sofort wieder. In «Danach», dem kurzen dritten Teil des Romans, wird die Nachkriegszeit beleuchtet mit ihren trivialen Produktionen, die das Volk von den Traumata des Krieges erlösen sollen.
Der Recherchefleiß von Daniel Kehlmann ist auch in diesem Roman beachtlich, sehr anschaulich führt er seine Leser in die Problematik des Filmgeschäfts ein, schildert die verschiedenen Aufgaben der Beteiligten, vom Produzenten über Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann, Beleuchter, Maskenbildner und all den anderen dienstbaren Geistern, die da tätig sind. Auch die täglichen Pannen, Rückschläge und erforderlich werdenden Improvisationen sind anschaulich beschrieben, alles steht unter Zeit- und Gelddruck, das Chaos ist der Normalzustand. Natürlich trifft man bei der Lektüre des Romans auf die Filmgrößen der damaligen Zeit, so hat Pabst Leni Riefenstahl bei deren Monumentalwerk «Tiefland» unterstützt, hat mit Greta Garbo gedreht und ist unter anderen mit Heinz Rühmann auch privat gut befreundet. Er ist immer noch wer in der Szene und tauscht sich regelmäßig mit Kollegen wie Fritz Lang oder Helmut Käutner aus.
Von den Feuilletons zum Teil euphorisch hochgejubelt, ist dieser Roman des Erfolgsautors über moralisches Versagen - nach «Tyll» vergleichsweise - ziemlich enttäuschend. Slapstickartige Szenen wie die in Goebbels Büro oder der dilettantische Lesekreis der Nazifrauen, an dem Trude Pabst teilnimmt, irritieren eher, als dass sie zum Lesegenuss beitragen. Stilistisch enttäuschend bieder, mit ständig wechselnder Erzählperspektive den Plot regelrecht zerstückelnd, ohne psychologische Tiefenschärfe an der Oberfläche bleibend, ist die Lektüre zwar durchaus interessant, aber alles andere als meisterlich! Sie hinterlässt beim Lesen keine nachhaltigen Spuren, woran auch die schwache Figurenzeichnung Schuld trägt, man hat das Roman-Personal schon vergessen, wenn man das Buch zuschlägt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Virtuos erzählter Roman über G. W. Pabst
Daniel Kehlmanns neuer Roman stellt den einst gefeierten und heute weniger bekannten deutschen Regisseur Georg Wilhelm Pabst ins Rampenlicht, um ihn dann wieder in den Schatten zu stellen, entsprechend seiner Rolle als Regisseur hinter der …
Mehr
Virtuos erzählter Roman über G. W. Pabst
Daniel Kehlmanns neuer Roman stellt den einst gefeierten und heute weniger bekannten deutschen Regisseur Georg Wilhelm Pabst ins Rampenlicht, um ihn dann wieder in den Schatten zu stellen, entsprechend seiner Rolle als Regisseur hinter der Kamera.
Erzählt aus verschiedenen Perspektiven, darunter z.B. die von Pabsts Frau Trude, seinem Sohn Jakob und die seines Assistenten, wird nicht nur ein interessantes Porträt von G. W. Pabst, sondern auch von der damaligen Zeit gezeichnet.
Am Anfang des gewohnt virtuos erzählten Romans steht jedoch der fiktive Franz Wilzek, der mit Pabst zusammen gearbeitet hat und eine bedeutende Rolle im Falle des verschollenen Pabst Film "Der Fall Molander" gespielt hat.
Danach taucht man in die 30er- und 40er-Jahre des 20. Jahrhunderts ein. Zunächst emigriert Pabst nach Hollywood und versucht dort sein Glück, jedoch sein Film "A Modern Hero" scheitert krachend. Er kehrt nach Österreich zurück, um dort sich um seine kranke Mutter auf Schloss Dreiturm zu kümmern. Währenddessen versucht Goebbels Pabst für sich gewinnen, damit er Filme für Nazideutschland dreht. Zunächst versucht Pabst nicht dem Werben von Goebbels nachzugeben, doch mit Kriegsbeginn ändert sich seine Einstellung diesbezüglich.
Ähnlich rasant geschrieben wie ein spannendes Drehbuch, zieht die Handlung, in der geschickt tatsächliche Ereignisse zu einer fiktiven Geschichte verwoben werden, den Lesenden in ihren Bann.
Anfangs noch leicht verwirrend setzen sich nach und nach die einzelnen Erzählperspektiven zu einer Geschichte zusammen, in der es um Kunst, Macht und auch um die Frage nach Verantwortung geht.
Darf man im Namen der Kunst auch für ein menschenverachtendes Regime arbeiten oder wird dadurch das eigene künstlerische Werk unwiderruflich beschmutzt? Beim Lesen stellt man sich diese Fragen, ohne dabei so richtig eine Antwort darauf zu bekommen, wie G. W. Pabst darüber gedacht hat, denn der Roman lässt die Gedanken und Gefühle von Pabst seltsam außen vor. Allen anderen Charaktere sind greifbarer als die Hauptfigur des Romans selbst.
Hätte Kehlmann es geschafft, Pabst noch mehr hervortreten zu lassen, hätte "Lichtspiel" ein großartiges Werk werden können, so ist es besonders sprachlich und stilistisch immer noch großartig, aber inhaltlich hat es nicht die Wucht, die ich mir erwartet habe.
Dennoch hat mir "Lichtspiel" ein tolles Lesevergnügen bereitet und ist nicht nur für Fans von Kehlmann lesenswert.
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Mit sehr gut recherchierten und fundierten Kenntnissen bringt uns Daniel Kehlmann die Welt der Filmschaffenden näher. Georg Wilhelm Pabst war in der Weimarer Republik ein angesehener und erfolgreicher Filmregisseur, sein Film „die freudlose Gasse“ brachte Greta Garbo den Durchbruch. …
Mehr
Mit sehr gut recherchierten und fundierten Kenntnissen bringt uns Daniel Kehlmann die Welt der Filmschaffenden näher. Georg Wilhelm Pabst war in der Weimarer Republik ein angesehener und erfolgreicher Filmregisseur, sein Film „die freudlose Gasse“ brachte Greta Garbo den Durchbruch. In den 30er Jahren verließen immer mehr Künstler Deutschland und Österreich. Auch Pabst ging nun nach Hollywood, doch er blieb nicht lange. Die Geldgeber hatten das Sagen, er kam mit der Sprache und Kultur nicht zurecht. Da auch seine alte und demente Mutter Hilfe benötigte kam er mit Frau und Sohn wieder zurück. Mit Kriegsausbruch gab es keine Chance mehr auf Ausreise und der deutsche Film, der durch die wenigen noch verbliebenen Filmemacher und das Ausbleiben der amerikanischen Filme am Boden lag, musste mit aller Kraft am Leben erhalten werden. So geriet auch Pabst in die Propagandamaschinerie des dritten Reiches.
Wir erfahren viel über die Produktion eines Filmes, über Künstler und Regisseure der damaligen Zeit. Arrangiert man sich mit dem System, leistet man Widerstand oder wird man zum Täter, so wie Jakob, Pabst Sohn, der als Kind zum fanatischen Nazi wird. Oder wie Gertrude, Pabst Frau, die fast daran zugrunde geht.
Aus verschiedenen Perspektiven wird hier ganz hervorragend, teils mit kurzen Abschweifungen, die Zeit vor, während und nach Kriegsende die Welt des Filmemachens erzählt. Das Meisterwerk, das Pabst immer anstrebte ist Daniel Kehlmann gelungen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Opulent und eindringlich
Lichtspiel ist ein Buch über den Filmregisseur G.W.Pabst. Es ist aber nicht nur eine Biografie, sondern vielmehr über den Weg in Verstrickung und innerlicher Korruption.
Es ist ein hochkomplexes, opulentes Werk. Daniel Kehlmann hat sich wirklich mit dem …
Mehr
Opulent und eindringlich
Lichtspiel ist ein Buch über den Filmregisseur G.W.Pabst. Es ist aber nicht nur eine Biografie, sondern vielmehr über den Weg in Verstrickung und innerlicher Korruption.
Es ist ein hochkomplexes, opulentes Werk. Daniel Kehlmann hat sich wirklich mit dem deutschen Film der dreißiger und vierziger Jahre beschäftigt und es gelingt ihm, diese Zeit zu verdeutlichen.
Mich hat der deutsche Film auch immer sehr interessiert und kenne daher Bücher über Fritz Kortner, Heinz Rühmann, über Veit Harlan, Emil Jannungs und mit Klaus Manns Mephisto gibt es schon einen großen Roman über Verführung in dieser Zeit.
Daniel Kehlmann fügt sich gut in diesen Reigen guter Bücher ein.
Es gibt eine folgelogischen Aufteilung in die Abschnitte Draußen, Drinnen und Danach.
Man spürt die Bedrängnis, in der sich G.W.Pabst nach seiner teilweise nur unfreiwilligen Rückkehr nach Österreich befindet. Dazu dient Daniel Kehlmanns Technik, aus den Gedanken der Hauptfigur zu erzählen. Teilweise wird auch aus anderen Perspektiven erzählt. Das formt ein komplettes Bild. Ich denke, dass kann nicht jeder so schreiben.
Eindringlich werden die Szenen, in denen sich Pabst ganz im Schaffen seiner Filme verliert. Manche Passagen werden nicht so schnell vergessen sein.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Großartig! Nachdem ich Daniel Kehlmanns neuen Roman "Lichtspiel" zu Ende gelesen habe, frage ich mich, warum ich eigentlich überhaupt andere Bücher von anderen Autor:innen lese... was wohl nur daran liegen kann, dass ich offensichtlich mehr lesen als Kehlmann schreiben …
Mehr
Großartig! Nachdem ich Daniel Kehlmanns neuen Roman "Lichtspiel" zu Ende gelesen habe, frage ich mich, warum ich eigentlich überhaupt andere Bücher von anderen Autor:innen lese... was wohl nur daran liegen kann, dass ich offensichtlich mehr lesen als Kehlmann schreiben kann. Und seinem neuen Werk merkt man das Ausgereifte in jeder Zeile an. Sprachlich hervorragend, exzellente Komposition und dabei noch absolut filmreif. Und schließlich geht es ja auch um Letzteres. So lautet es im letzten Drittel des Romans: "Die Zeit war aus den Fugen, überall, und man musste einen Weg finden, seine Arbeit zu machen. In diesem Moment bebte die Erde. Ein ziehendes Gefühl lief ihnen durch die Glieder, man glaubte zu fallen." 'Lichtspiel' umfasst die Zeitspanne von der 'Einverleibung' Österreichs ins Reich bis in die frühe Nachkriegszeit. Der deutsche Regisseur G.W.Pabst kehrt aus Sorge um die hilfsbedürftige Mutter und auch wegen seines nur mäßigen Erfolges in Amerika mit Frau und Sohn zurück nach Deutschland / Österreich. Weil schon sehr bald die Grenzen dicht sind, gelingt die Rückreise in die USA nicht mehr und Pabst wird von den Nzis vereinnahmt, ist gezwungen, 'deutsche Filme' zu machen. Kehlmann versteht es - auch unter zuhilfenahme wechselnder Erzählperspektiven - den Konflikt Pabst's, seinen Versuch die Passion des Regieführens nicht der totalen Anpassung an die Forderungen der Nazis zu opfern, präzise zu beschreiben. Dabei überlässt Kehlmann die Bewertung von Pabst's Verhalten der Leserschaft. Was gut und genau richtig ist. Immer wieder tauchen Berühmtheiten des deutschen Films auf und viel Aufmerksamkeit wird Pabst's verschollenem Film aus den letzten Kriegstagen gewidmet - die Welt bastelt an ihrem Untergang und Pabst dreht einfach nur einen Film... Gerahmt wird die eigentliche Geschichte durch Szenen aus der nahen Gegenwart... der ehemalige Kameramann, wegen seiner Demenz inzwischen wohnhaft in einem Seniorenstift, wird in eine populäre Fernsehshow eingeladen, in der es weniger um ihn selbst sondern vielmehr um den Regisseur Pabst und seine Zusammenarbeit mit ihm geht; und natürlich wird es zu einem peinlichen Auftritt, weil der Kameramann die ihm gestellten Fragen nicht beantworten und sich nicht mehr recht erinnern kann... Und so ist die eigentliche Geschichte gerahmt von 'Vergessen'. Und damit dies NICHT geschieht, hat Kehlmann uns mit "Lichtspiel" ein Werk geschenkt, dass uns förmlich zwingt, wieder hinzuschauen, sich nicht nur an ein Damals zurückzuerinnern, welches beinahe das freie Wesen der Kunst der rein propagandistischen, ideologisierten Unterhaltung geopfert hätte, sondern auch das Hier und Heute in den Blick zu nehmen und wachsam zu sein gegenüber Rchtsruck und Populismus. Für mich der bislang beste Roman in diesem Jahr!!!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für