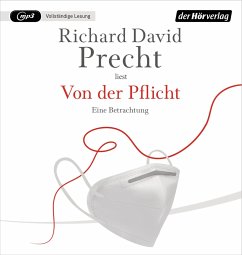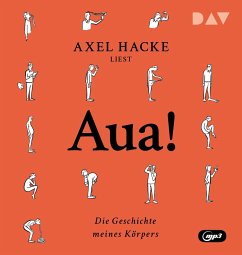-11%20)

Nichts tun - Die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen
477 Min.
Übersetzung: Zettel, Annabel;Gesprochen: Schnöink, Birte
Sofort lieferbar
Statt: 24,00 €**
21,45 €
inkl. MwSt.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

PAYBACK Punkte
11 °P sammeln!
Facebook, Instagram & Co: Ein Großteil des sozialen Lebens mit Verwandten und Freunden, ob nah oder weit entfernt, findet heute über Social Media statt. Das Selfie auf der richtigen Plattform ist zur neuen Visitenkarte geworden. Sich der Online-Präsenz zu entziehen, ist in der modernen Welt kaum noch möglich. Reizüberflutung und die Unfähigkeit, einen Gedankengang zu Ende zu führen, sind zunehmend Probleme, denen sich jeder stellen muss. In ihrem Buch plädiert Jenny Odell für einen achtsamen Umgang mit unserer Aufmerksamkeit. Anstatt sich dem Druck nach konstantem Produktivsein zu beu...
Facebook, Instagram & Co: Ein Großteil des sozialen Lebens mit Verwandten und Freunden, ob nah oder weit entfernt, findet heute über Social Media statt. Das Selfie auf der richtigen Plattform ist zur neuen Visitenkarte geworden. Sich der Online-Präsenz zu entziehen, ist in der modernen Welt kaum noch möglich. Reizüberflutung und die Unfähigkeit, einen Gedankengang zu Ende zu führen, sind zunehmend Probleme, denen sich jeder stellen muss. In ihrem Buch plädiert Jenny Odell für einen achtsamen Umgang mit unserer Aufmerksamkeit. Anstatt sich dem Druck nach konstantem Produktivsein zu beugen, sollten wir alle innehalten und nichts tun!Lesung mit Birte Schnöink1 mp3-CD ca. 7 h 57 min