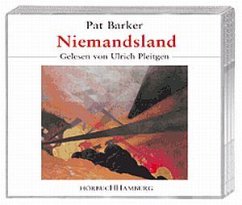Die englische Autorin Pat Barker schreibt über den Ersten Weltkrieg. Aber nicht das Gemetzel auf den Schlachtfeldern wird geschildert, sondern das Leben in einem schottischen Sanatorium. Dort ist der Neurologe Dr. Rivers mit der Behandlung seelisch verkrüppelter Soldaten beauftragt. Anders als seine Kollegen, die ihre Patienten mit Elektroschocks quälen, versucht er im Gespräch, die Erinnerung an die grauenhaften Geschehnisse wachzurufen, den verstörten Menschen Trost zu spenden. Doch auch er hat seine Schwierigkeiten, ein Stotterer von Jugend an, sich seiner sexuellen Neigungen nicht sicher und vor allem: Er weiß, dass er die Soldaten nur heilt, um sie wieder aufs Schlachtfeld und damit wahrscheinlich in den Tod zu schicken.

Feminismus für alle: Pat Barkers Roman "Niemandsland" / Von Peter Demetz
Im Craiglockhart, einem Edinburgher Hospital, hat das britische Heeresamt jene jungen Offiziere versammelt, die in den Schlachten der Westfront psychisch zusammenbrachen, Gelähmte, Sprachlose, neurasthenische Stotterer mit Halluzinationen. Dokumentierte Geschichte und Fiktion halten sich die Waage; und da Pat Barker, die an der London School of Economics Politikwissenschaft studierte, nie sentimental erzählt, berichtet sie die Geschichte des Dichters und ambivalenten Pazifisten Siegfried Sassoon zunächst ohne politische Erregung. Er ist ein prominenter Fall, denn er hat im Juli 1917, ausgerechnet in der "Times", eine Erklärung gegen die Fortsetzung des blutigen Krieges und für die Aufnahme von Verhandlungen veröffentlicht. Dabei ist nicht so wesentlich, daß er einer der reichsten Familien des Landes angehört (die Schicksale seines sephardisch jüdischen Clans, der seinen Weg von Bombay nach London suchte, und seines Vaters, des Handelsherrn, der seine aristokratische Ehefrau wenige Jahre nach der Geburt seines Sohnes verließ, bedürften der barocken Feder Salman Rushdies) - entscheidender ist der Umstand, daß Sassoon, ein Kriegsfreiwilliger, ein kühner Frontoffizier war, für den seine Leute buchstäblich durchs Trommelfeuer gingen (die Auszeichnung, die er für die Rettung von Verwundeten erhielt, warf er demonstrativ in den Mersey-Fluß).
Der Militärpsychiater W. H. R. Rivers (auch eine historische Figur in der Geschichte der englischen Psychiatrie) begreift rasch, daß sich der verwirrte und gefühlskalte Sassoon im Konflikt mit sich selber befindet. Sassoon will die Dinge nicht auf die Spitze treiben, um nicht von den professionellen Pazifisten des Augenblickes, einschließlich Bertrand Russell, manipuliert zu werden oder gar als Kriegsdienstverweigerer vor ein Gericht zu kommen, denn das würden ihm seine Leute in den Schützengräben niemals verzeihen; und indem er in den Gesprächen mit dem Arzt zu sich selber kommt (oder nahezu), entschließt er sich, an die Westfront zurück zu seinen Leuten zu gehen, ohne seine Meinung über den Charakter des Krieges zu ändern. Die Geschichte weiß, daß er noch einmal für seine Kühnheit ausgezeichnet wurde, später fortfuhr, Gedichte zu schreiben, zur katholischen Kirche konvertierte und als alter Mann friedlich starb, 1967.
Die Erzählerin respektiert den kalten Fisch Sassoon, aber ihre epische Zuneigung gilt nicht ihm, sondern einer Gegenfigur, dem Second Lieutenant Prior, plebejischer Herkunft, mit dem Rivers seine Schwierigkeiten hat, weil er überhaupt nicht reden will; Rivers erinnert ihn zu sehr an seinen Vater, den Dockarbeiter, der ihn nach seinem robusten Bilde formen wollte (Ergebnis: Asthma schon vor dem Zusammenbruch an der Front). Prior hat das Glück, in einem Edinburgher Pub die Munitionsarbeiterin Sarah zu finden, gelbe Haut wegen der Dämpfe in der Fabrik, rote Haarkrone, die sprödeste und störrischste Liebesgeschichte, die man sich denken kann, und deshalb einer der wunderbarsten Abschnitte des Romans. Sarah ist keine andere, nach Sprache, Herkunft, und ohne Vater, als die jüngere Pat Barker selbst, die sich dem jungen Manne zum Geschenke darbringt (als er in ihr Zimmer kommt, liegt ein Korsett am Boden, das sie rasch mit dem Fuß unter einen Stuhl stößt und sagt: "Ich bin nicht ordentlich, du mußt keine Angst haben"). Es gibt kleine und lebhafte Gesten, die unseren Blick für Charaktere und menschliche Verhältnisse schärfen, und das ist eine von ihnen.
Der Militärarzt Rivers, der eigentliche Held, hat nichts Heroisches oder Martialisches an sich - zögernd, ein wenig umständlich spielt er mit dem Gedanken, wieder in die Forschung zurückzugehen, und kann sich doch nicht entschließen, seine Kranken zu verlassen (ein Kollege behandelt die Leidenden anders, indem er ihnen Elektroden in den Rachen stößt, um sie zur Sprache zu bringen). "Niemandsland", das ist die Geschichte eines älteren Mannes, der sich immer weiter von den Diktaten der Gesellschaft und den traditionellen Methoden seiner Wissenschaft zu entfernen beginnt. Als junger Anthropologe sah er schon in Melanesien, wie töricht es war, auf den Normen eines "großen weißen Gottes" zu beharren, und als Psychiater, der als einer der ersten in England eben an Freud zu kauen beginnt, entwickelt er Heilmethoden und Hypothesen, welche den Schulmeinungen strikt zuwiderlaufen. Nicht der plötzliche Schock explodierender Granaten, glaubt er, ist der Grund der Zusammenbrüche und traumatischen Schädigungen, sondern der fortgesetzte "Verschleiß", der "Druck, wochenlang, monatelang in einer Situation zu sein, aus der man nicht herauskommt".
Der Krieg sollte das große maskuline Abenteuer sein, er brachte aber "in Wahrheit ,weibliche' Passivität" zum Vorschein, und zwar in einem Maße, "wie sich das die Mütter und Schwestern kaum vorstellen konnten" - deshalb, im Wechsel von Aktivität zur Passivität, brechen die Männer zusammen. Rivers sieht auch im Falle Sassoons tiefer als seine Kollegen; er glaubt, daß sich in den Schützengräben eine neue "Familiarität" oder gar "Mütterlichkeit" (nicht Kameradschaft) zwischen Offizieren und Soldaten zu entwickeln beginnt, zu welcher es den beziehungslosen Sassoon hinzieht, aber er weiß doch, daß Sassoon zuletzt, in einer verborgenen Todessehnsucht, an die Front zurückkehren wird. Die Frage bleibt offen, ob dieser englische Patient namens Siegfried (seine noble Mutter war eine Wagner-Verehrerin) nicht in seiner Seele das triste Feldgrau der deutschen Spätromantik trägt.
Nichts wäre allerdings abwegiger, als diesen Roman historischer Dimensionen als einen theoretischen Text über die Geschichte der englischen Psychoanalyse oder des Pazifismus zu lesen. Es geht nicht um die Kombination abstrakter Gedanken, sondern um die Menschen, die sie hegen, prüfend mit ihnen spielen, sie zögernd artikulieren. Die heute vierundfünfzigjährige Pat Barker, die mit naturalistischen Romanen aus dem Milieu nordenglischer Kleinbürger begann, hat durch die wissenschaftlichen Arbeiten ihres Gatten, eines Professors der Universität Durham, die Publikationen Rivers' kennen- und schätzengelernt, aber ihre neuen Interessen haben ihre älteren und intimen Themen nicht verdrängt, weder ihre Suche nach der alles erlösenden Vaterfigur (ihren eigenen Vater verlor sie nicht weniger abrupt als Siegfried Sassoon den seinen) noch den ungetrübten Blick auf Frauen und Männer ("In unserer Gesellschaft lieben die Frauen die Männer wie den Bandwurm im Darm", sagt Sarahs Mutter).
Ich bewundere Pat Barkers unbeirrbare Professionalität des Erzählens, immer der Sache genau angemessen, nie zu Effekten aufgepufft, ohne weinerliches Zerreden, und auf der Hut vor lyrischen Stellen oder poetischen Vergleichen (wenn sie sich dazu entschließt, dann mit entdeckender Präzision, so das nächtliche Meer: "ein zahnloser Mund, der im Dunkel Kieselsteine kaut"). Im "Niemandsland" tut sie endlich ganz, was sie so lange tun wollte - als Feministin, so sagt sie, zu schreiben, aber nicht nur für Frauen oder über Frauen allein. In seiner deutschen Übersetzung hat Matthias Flenbork die sparsame Emotionalität und ihre Sachlichkeit loyal aufbewahrt, und der Verlag sollte uns die anderen Bände der Rivers-Trilogie nicht lange vorenthalten. Es ist ja der dritte Band, den eine englische Jury vor einiger Zeit mit dem berühmten Booker-Preis auszeichnete.
Pat Barker: "Niemandsland". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Matthias Flenbork. Hanser Verlag, München 1997. 328 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main