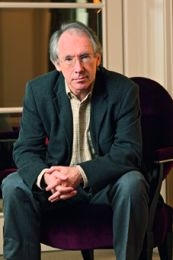Eine Geschichte über List und Leidenschaft, Verrat und Mord. Eine klassische Konstellation: der Vater, die Mutter und der Liebhaber. Und das Kind, vor dessen Augen sich das Drama entfaltet. Aber so, wie Ian McEwan sie erzählt, haben Sie diese elementare Geschichte noch nie gehört. Verblüffend, verstörend, fesselnd, philosophisch - eine literarische Tour de force von einem der größten Erzähler englischer Sprache.

Ian McEwans Roman "Nussschale" ist ein seltsames Buch. Es hat nicht nur einen ungeborenen Erzähler; alles, was man ihm vorwerfen kann, kann man ihm auch zugutehalten
Ein Roman? Auch ein Roman. Aber nur insofern, als praktisch jede Geschichte, die zwischen zwei Buchdeckel geklemmt und mehr als hundert Seiten lang ist - in diesem Fall sind es mehr als zweihundertsiebzig -, heutzutage als Roman verkauft wird. Ansonsten fehlt diesem Buch so gut wie alles, was einen Roman üblicherweise ausmacht: die Vielzahl der Schauplätze, der Wechsel der Perspektiven, der Reichtum der Beschreibungen, die lange zeitliche Dauer. Und, vor allem, die gründliche Zeichnung der Figuren: der Prosa-Zauber, der sie zum Leben erweckt.
Und das ist kein Wunder. Denn "Nussschale", dieser erste McEwan-Roman mit drei S im Titel (einer von vielen Folgeschäden der Rechtschreibreform) ist vom ersten bis zum letzten Satz aus der Sicht eines noch ungeborenen, dann, auf den Schlussseiten (noch ein Sss-Wort!), hastig und unverhofft - wenn auch keineswegs unschuldig - ins Leben geworfenen Kindes erzählt. Es ist der Bericht eines Fötus: sein Monolog, sein Weltgesang, seine Anklageschrift. Und daraus folgt alles, was man diesem Buch vorwerfen oder zugutehalten kann: seine flachen, fernsehmäßigen Charaktere, seine Guckkasten-Optik, sein planspielhafter Ablauf. Und, andererseits, seine erzählerische Konsequenz und Konzentration, seine Eleganz, seine Unausweichlichkeit.
Denn natürlich kann der Fötus-Junge (denn um einen solchen handelt es sich, wie wir mit gehöriger Verzögerung erfahren) im Bauch seiner Mutter nichts anderes berichten als das, was er von seinem biologischen Panikraum aus zu hören und sich über die Welt da draußen zusammenzureimen vermag. Insofern enthält der erste Satz des von Bernhard Robben makellos ins Deutsche übertragenen Buches zugleich das Konzept, den Ton und das unvermeidliche Ende der Geschichte: "So, hier bin ich, kopfüber in einer Frau." Aber innerhalb dieser narrativen Zwangsjacke erlaubt sich McEwan die größtmögliche fiktionale Freiheit. Er erhebt seinen pränatalen Erzähler zum König im Reich der Ungeborenen. Er verleiht ihm das Wissen eines altklugen Schulkinds und die Weisheit eines Greises. Er schenkt ihm die reife Selbstironie eines Intellektuellen. Er macht ihn zum Weinkenner und Gourmet. Und er stattet ihn mit solcher Hellhörigkeit aus, dass ihm kaum ein Wort entgeht, das in seiner näheren Umgebung gesprochen wird, auch das entscheidende nicht, um das sich die Geschichte dreht und das nach gut sechzig Seiten fällt: "Gift."
Ein Thriller? Auch das. Es geht um Mord, um ein Familienverbrechen: Die Mutter des Erzählers und ihr Liebhaber, der zugleich ihr Schwager ist, wollen gemeinsam den Vater des Babys umbringen. Der Bruder den Bruder. Die Ehefrau den Ehemann. Wo haben wir das schon einmal gehört? Richtig, in "Hamlet", der größten aller Shakespeare-Tragödien, dem größten Theaterstück überhaupt. Dort ist die Tat schon begangen, als die Handlung beginnt. Hier wird sie gerade erst ausgeheckt, was der Geschichte eine ganz andere Richtung gibt. Im Mittelpunkt steht nicht mehr, wie in "Hamlet", die Frage, ob die Verbrecher davonkommen oder bestraft werden, sondern ob und wie sie ihr Verbrechen überhaupt begehen. Erst im letzten Drittel rastet dann der Mechanismus ein, von dem die große Masse der Fernsehkrimis und die schwächere Hälfte der Kinothriller lebt, und erst jetzt greift der kleine Hamlet-Avatar endlich ins Geschehen ein, indem er die Fruchtblase zerreißt, die ihn umhüllt. Vom Davonkommen ist da längst keine Rede mehr, auch nicht von Rache oder Strafe, eher von jenen fragilen Abwägungen, die ein Fötus, wenn er den Verstand eines Erwachsenen hätte, im Angesicht einer Zukunft hinter Gittern oder in der Obhut einer Adoptivfamilie treffen würde.
Bis dahin aber handhabt McEwan die Maschinerie eines klassischen Crime Plots mit einer Lässigkeit, die an Vernachlässigung grenzt. Man spürt, dass ihn das Kernpersonal seiner Story, die blonde, hübsche und launische Trudy und der zum Steinerweichen mediokre Claude (bei Shakespeare heißen sie Gertrude und Claudius) im Grunde nicht besonders interessiert, und auch für den ungeborenen Erzähler, der sich mal mit Hassphantasien, mal mit Selbstmordgedanken trägt oder darüber schwadroniert, "wie herrlich ein durch die Plazenta dekantierter Burgunder schmeckt", hat er kaum mehr als ein paar grobe Pinselstriche von Persönlichkeit übrig.
Um so liebevoller malt er das durch den plappernden Babymund gefilterte Porträt von Trudys Ehemann. Dieser John, ein erfolgloser Poet und Kleinverleger, erotischer Langweiler und Inhaber jener millionenschweren verlotterten Villa in bester Londoner Wohnlage, die Claude und Trudy nach seinem Ableben zu Geld machen wollen und in der die Geschichte spielt, ist der einzige wirkliche Mensch in diesem Buch. Um seine untreue Frau zurückzugewinnen, versucht er ihre Eifersucht anzustacheln, indem er ihr eine eigene Liebesaffäre mit einer Nachwuchslyrikerin vorspielt, Elodie, die sich auf Verse über Eulen spezialisiert hat - ein Plan, der beinahe so erfolgreich ist wie die Mordintrige der Gegenseite.
Vor allem aber zitiert John, wann immer sich eine Gelegenheit bietet, die Crème der englischen Poesie, angeblich kann er tausend Gedichte auswendig, und obwohl Trudy schon beim bloßen Gedanken daran in Gähnkrämpfe verfällt, hört man sie immer wieder gern: Marvells "An seine scheue Geliebte", Owens "Hymne für verlorene Jugend", Draytons Liebessonett, Audens Herbstgesang. In dieser Figur, scheint es, hat McEwan, der überaus Erfolgreiche, eine Angstvorstellung seiner Jugend begraben, den Albtraum des privaten wie beruflichen Scheiterns. "Kill your darlings", lautet eine Maxime aus der Börsenmaklerwelt. Ian McEwan macht daraus Literatur.
Ein Kunstwerk also, ein Geniestreich wie "Abbitte"? Eher ein Kunststück wie "Honig" oder "Am Strand", eine virtuose Fingerübung, ein Divertimento. McEwan weiß, dass er, wenn er sein Sprachgefühl von der Leine lässt, kein wirklich schlechtes Buch schreiben kann, aber er weiß auch, dass eine große Idee noch keinen großen Roman ergibt, auch dann nicht, wenn man sie mit Mord, Sex und Shakespeare anpfeffert. Deshalb gibt er sich alle Mühe, seinen intrauterinen Ich-Erzähler über den Status eines cleveren Autoreneinfalls hinaus zu einer Orakelfigur aufzubauen, einem Weisen vom Venusberg, der unserer Welt aus den Tiefen des Fruchtwassers die Leviten liest. Er lässt ihn Vorträge und Podcasts aus dem Nachtprogramm der BBC referieren, Sendungen über die Finanzkrise, die Klimakatastrophe, den Islamismus, das Pulverfass des Nahen Ostens, die kränkelnde Großmacht Amerika, die zerfallende Europäische Union, die unruhigen Mittelmächte Russland und China und "einen gewissen Monsieur Barthes", der die Langeweile als Gipfel der Seligkeit bezeichnet haben soll. Aber es hilft nichts: Der Leitartikelaufstrich haftet nicht. Die Hamletmaske erwacht nicht zum Leben. Der Junge kommt zur Welt, aber seine Geschichte sprengt nicht den Kokon des Konzepts, in den ihr Autor sie eingesponnen hat.
Man legt das Buch ohne Reue aus der Hand. Es schadet nie, sich drei, vier Stunden mit einem ausgebufften Erzähler zu unterhalten. Nur hat man diesmal das Gefühl, dass Ian McEwan nichts wirklich Wichtiges erzählen wollte. Er wollte nur etwas ausprobieren. Und siehe, es hat geklappt.
ANDREAS KILB
Ian McEwan: "Nussschale". Roman. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes, 288 Seiten, 22 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Ian McEwan gilt als einer der besten britischen Autoren der Gegenwart.«