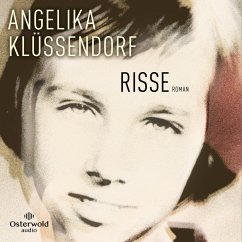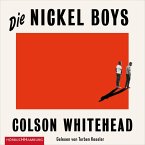Das Mädchen und wie es die Welt sah
Das Mädchen ist zurück: In zehn Geschichten entfaltet Angelika Klüssendorf ein Kinderleben in der DDR in den 60ern und 70ern, geprägt von Ungeborgenheit und Sehnsucht. Nach dem Tod der geliebten Großmutter muss das Mädchen Übergriffen und Teilnahmslosigkeit begegnen. Es ringt darum, seine Eltern auszuhalten und zu verstehen und die Schwester zu beschützen. Lichtblicke liefern Bücher, das Lesen bietet selbst im Kinderheim noch einen Ausweg.
Die Kaschnitz-Preisträgerin erzählt die Vorgeschichten zum Erfolgsroman »Das Mädchen« neu, die vor zwanzig Jahren erschienen und nicht mehr lieferbar sind. Und sie überprüft schonungslos, was nicht erzählt wurde und warum. Ist Wahrhaftigkeit im Erzählen von sich möglich?
Autofiktion, radikal und bewegend!
Das Mädchen ist zurück: In zehn Geschichten entfaltet Angelika Klüssendorf ein Kinderleben in der DDR in den 60ern und 70ern, geprägt von Ungeborgenheit und Sehnsucht. Nach dem Tod der geliebten Großmutter muss das Mädchen Übergriffen und Teilnahmslosigkeit begegnen. Es ringt darum, seine Eltern auszuhalten und zu verstehen und die Schwester zu beschützen. Lichtblicke liefern Bücher, das Lesen bietet selbst im Kinderheim noch einen Ausweg.
Die Kaschnitz-Preisträgerin erzählt die Vorgeschichten zum Erfolgsroman »Das Mädchen« neu, die vor zwanzig Jahren erschienen und nicht mehr lieferbar sind. Und sie überprüft schonungslos, was nicht erzählt wurde und warum. Ist Wahrhaftigkeit im Erzählen von sich möglich?
Autofiktion, radikal und bewegend!

Die poetische Wahrheit der Angelika Klüssendorf reicht tief: In ihren nun wiederaufgelegten und dafür umgearbeiteten frühen Erzählungen zeigt sich schon das ganze spätere Werk. "Risse" soll nun Roman sein.
Wie lässt sich der traumatisierende Schrecken einer Kindheit und Jugend mitteilen, gezeichnet von schauerlichen Sadismen aller Art, emotionaler Verwahrlosung und schwer erträglicher Brutalität, ohne uns, die Leser, zu verlieren? Vielleicht in dem man von den nicht abzuschüttelnden Dämonen erzählt - so lakonisch, präzise und unerschrocken wie nur möglich. "Kurz bevor ich die Schmerzen nicht mehr aushielt, versuchte ich, in ihnen zu leben", heißt es gegen Ende der Erzählung "Gespenster" - ein Satz, der in nuce enthält, was Angelika Klüssendorf treibt.
Um keine Zweifel aufkommen zu lassen: Die zehn kurzen Geschichten, die das erzählerische Rückgrat des Romans "Risse" bilden, gehören zweifellos zum Besten, was die Autorin geschrieben hat. Die Hauptprotagonistin dieser Familienaufstellung des Grauens wird selten beim Namen genannt, sie ist einfach "das Mädchen" oder "sie"; ein paar Mal wird aus der Ich-Perspektive erzählt, einmal spricht eine junge Heimerzieherin, nur wenig älter als ihre minderjährige Schutzbefohlene, ein anderes Mal ein junger Polizist, der in der ihm gegenübersitzenden Frau ein Mädchen aus dem Dorf der Kindheit zu erkennen glaubt. Es ist ein bedrückender Reigen, in dem nicht geurteilt oder gar analysiert wird - nur erzählt, kühl, klar und ohne Schnörkel. Von den Schrecken eines Kindergefängnisses, eines Heims. Von einem Vater, der sich jedes Jahr zu Ostern das Leben zu nehmen versucht, unter tätiger Mithilfe der um seine Liebe bettelnden Tochter. Von der Mutter, die an einem ebenso pervertierten Weihnachten ihr älteres Mädchen mit dem Einkaufszettel zum Ladendiebstahl schickt, während die jüngere Schwester mit Nadeln gequält wird. Auf dem Plattenteller dreht sich zu dieser Folterszene in Endlosschleife Elvis' "Love Me Tender" - man kann kaum anders, als in einer Art Echoraum Bobby Vintons "Blue Velvet" aus David Lynchs gleichnamigem Film zu hören.
"Risse", auf dem Vorsatzblatt, nicht aber auf dem Umschlag der Gattung Roman zugeschlagen, enthält - mit minimalen textlichen Bearbeitungen und in leicht modifizierter Anordnung - alle zehn Kurzgeschichten des 2004 bei S. Fischer erschienenen Erzählbandes "Aus allen Himmeln". Eigennamen wurden getilgt, aus "Maria" oder "Judith" wurden "das Mädchen" oder "meine Schwester". Die 2004 an zweiter Stelle stehende Erzählung ("Ficken") schließt nun, unter dem weniger expliziten Titel "Sommer", den Band ab. Zeigte das Cover des Fischer-Bandes noch einen menschenleeren Bootssteg, ein gefälliges Stock-Foto in Schwarz-Weiß, ist nun eine verfremdete Jugendfotografie der Autorin zu sehen - was die wesentlichste Abweichung auch visuell unterstreicht: kursiv gesetzte Zwischentexte, die den einzelnen Episoden einen autobiographischen Rahmen geben.
In einem Vorstück erklärt Klüssendorf die Begleitumstände ihres Neuansatzes: "Du hast schon immer gelogen" - so, mit Abscheu in der Stimme, hatte ihre Mutter vor fast zwanzig Jahren nach der Lektüre von "Aus allen Himmeln" am Telefon gefaucht. Tatsächlich hat Klüssendorf den Tod ihrer Mutter, in einem Anflug von tiefschwarzem Ätsch-Bätsch, jahrzehntelang als Blanko-Ausrede für alle Gelegenheiten benutzt, vom nicht wahrgenommenen Arzttermin bis zur Lesungsabsage: "Ich habe meine Mutter wieder und wieder sterben lassen." Als die Frau mit 84 Jahren dann wirklich ablebte, unterzog sich die Autorin einem schmerzhaften Selbstbefragungsprozess: Könnte der mütterliche Anwurf einen wahren Kern haben? Was wurde in der makellosen Prosa von einst ausgelassen, "falsch" beschrieben? "Es gibt keine Wunden, die nicht verheilt wären, doch es gibt Leerstellen, die ich bis heute nicht zu betreten wagte."
Die Schuldgefühle der Mutter kommen erst kurz vor ihrem Tod. Wie viele Angehörige der Nachkriegskinder-Generation ist sie nicht in der Lage, Unglück zu verbalisieren. "Sie musste es weitergeben." Gefragt, warum sie "so böse" war, reagiert die greise Mutter mit einem wütenden Weinkrampf: "Ich weiß es doch nicht, ich weiß es nicht."
Das Verfahren, die Short Storys mit autobiographischem Text zu klammern, ist interessanterweise schon in einer der alten Klüssendorf'schen Erzählungen angelegt: "Auch meine Geschichte war in Wirklichkeit eine ganz andere", heißt es da in "Alles hat seine Zeit" aus dem Jahr 2004. Kein Polizist, nirgends. Tatsächlich kann das Mädchen damals den Ring, den ihr der Vater mitgibt, im Konsumladen gegen zwei Flaschen Schnaps und Zigaretten eintauschen. Die kommentierenden Zwischentexte bilden die Scharniere zwischen den Erzählungen - etablieren aber auch so etwas wie die Vorgeschichte der drei seit 2011 erschienenen autobiographischen Romane "Das Mädchen", "April" und "Jahre später".
Diese Art autofiktionales Schreiben lediglich auf seinen therapeutischen Effekt für die Autorin zu reduzieren ist zu kurz gesprungen. Man sieht, im Gegenteil, wie bestimmte Motive im Werk variiert und weitergesponnen werden. Da stirbt auch der Alkoholiker-Vater ein ums andere Mal, zuletzt in der Figur des "Schlucki" im Dorfroman "Vierunddreißigster September" (2021). Im "wirklichen" Leben, so verrät Klüssendorf, sei ihr Vater - der schillernde, gut aussehende Hochstapler und Heiratsschwindler mit musischen Ambitionen, der auf einem Foto dem jungen Pier Paolo Pasolini ähnelt - als vierundsiebzigjähriger Kettenraucher an Lungenkrebs elend und einsam eingegangen. In "Hölle oder Himmel", einer der atemraubendsten "Aus allen Himmeln"-Geschichten, wird der Abgang als bizarres Oster-Ritual inszeniert. Das elfjährige Mädchen erlebt zum wiederholten Mal, wie der Vater mit Akkuratesse und Phantasie seinen Suizid vorbereitet. "Wir hatten nie über seine Selbstmordversuche gesprochen, die zu unserem Leben gehörten, wie für die anderen der alljährliche Osterbraten." Viele im Zwischentext gestellte schmerzhafte Fragen bleiben unbeantwortet - etwa die nach der Korrumpierbarkeit des Kindes für ein wenig Zuneigung. Oder die kaum abzutragende Schuld gegenüber der jüngeren Schwester: "Ich war eine Zeugin. Doch wo war mein Mitgefühl?"
Am Ende ist "Risse" nicht nur eine kommentierte Re-Lektüre, sondern eine große Selbstermächtigungs-Erzählung. Eine zentrale Rolle nehmen darin Bücher ein, so wie später auch das Schreiben. Eine Welt, aus der man nicht vertrieben werden kann. Ein Stück Heimat. Als Kind, so erfahren wir, wollte Klüssendorf Bibliothekarin oder Blumenbinderin werden, später Psychologin oder Kriminalkommissarin. Doch im Grunde gab es nichts mehr zu wählen: "Schreiben ist mir der einzig verlässliche Raum." Bei aller Ausweglosigkeit war da immer eine Sehnsucht: "Es sollten Abenteuergeschichten werden."
In deren Setting wird die DDR zwar vom pop-art-bunten Porträt des Staatsratsvorsitzenden in allen Amtsstuben bis zu Gerüchen und Markennamen ("Yvette Intim" wie "Goldbrand") detailreich ausgebreitet. Doch die poetische Wahrheit der Angelika Klüssendorf reicht tiefer als die exakte Ausstaffierung eines Unrechtsstaats: "Auf eine diffuse Weise hatte ich sogar an den Sozialismus geglaubt", lässt sie das Mädchen, inzwischen eine routinierte Ausreißerin, auf einer Polizeiwache monologisieren, "denn er schien alles auszumachen, was ich war. Die Straßen, Gehwege, Wälder, die Schule, die Sachen, die ich trug, der Geruch einer Zwiebel, alles war irgendwie sozialistisch." Eine Welt, die nicht in Schwarz und Weiß aufgeht. "Insofern war natürlich auch meine Mutter sozialistisch, und ihre Schläge und alle ihre Schweinereien, aber es gab eben auch Glatzköpfe, die mir halfen, halfen im Namen des Gesetzes." NILS KAHLEFENDT
Angelika Klüssendorf: "Risse". Roman.
Piper Verlag,
München 2023.
170 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Als "bedrückenden Reigen" empfindet Rezensent Nils Kahlefendt die Geschichten, die Angelika Klüssendorf jetzt als Roman herausbringt, nachdem sie 2004 zunächst als Erzählungsband erschienen sind: Von Trauma und Schmerz handeln die Geschichten um ein junges Mädchen, das kaum einmal beim Namen genannt wird, im Heim Schreckliches erlebt und Zuhause dem Vater bei seinen zahlreichen Suizidversuchen assistieren muss. Das ist so schmerzhaft wie autobiografisch fundiert, erfahren wir, und in der Neuausgabe nun leicht modifiziert, um der Roman-Gattung gerecht zu werden. Klüssendorf bekundet in einem Vorwort, sich einem "schmerzhaften Selbstbefragungprozess" unterzogen zu haben, der auch die Änderungen bedingte und es den LeserInnen zudem ermöglicht, noch einmal nachzuschlagen, woher einige Motive ihres weiteren Werks kommen, gibt Kahlefendt wieder, der hier eine "große Selbstermächtigungs-Erzählung" liest.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Am Ende ist 'Risse' nicht nur eine kommentierte Re-Lektüre, sondern eine große Selbstermächtigungs-Erzählung.« Frankfurter Allgemeine Zeitung 20231118