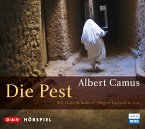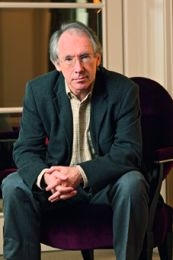Henry Perowne, 48, ist ein zufriedener Mann: erfolgreich als Neurochirurg, glücklich verheiratet, zwei begabte Kinder. Das einzige, was ihn leicht beunruhigt, ist der Zustand der Welt. Es ist Samstag, und er freut sich auf sein Squashspiel. Doch an diesem speziellen Samstag, dem 15. Februar 2003, ist nicht nur die größte Friedensdemonstration aller Zeiten in London. Perowne hat unversehens eine Begegnung, die ihm jeden Frieden raubt ...
| CD 1 | |||
| 1 | Saturday | 00:00:06 | |
| 2 | Teil Eins | 00:09:44 | |
| 3 | Teil Eins | 00:08:20 | |
| 4 | Teil Eins | 00:09:48 | |
| 5 | Teil Eins | 00:10:03 | |
| 6 | Teil Eins | 00:08:49 | |
| 7 | Teil Eins | 00:10:50 | |
| 8 | Teil Eins | 00:10:07 | |
| 9 | Teil Eins | 00:11:54 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Teil Zwei | 00:10:35 | |
| 2 | Teil Zwei | 00:10:13 | |
| 3 | Teil Zwei | 00:10:50 | |
| 4 | Teil Zwei | 00:09:59 | |
| 5 | Teil Zwei | 00:11:07 | |
| 6 | Teil Zwei | 00:13:55 | |
| 7 | Teil Zwei | 00:11:51 | |
| CD 3 | |||
| 1 | Teil Zwei | 00:12:12 | |
| 2 | Teil Zwei | 00:09:52 | |
| 3 | Teil Drei | 00:10:56 | |
| 4 | Teil Drei | 00:08:14 | |
| 5 | Teil Drei | 00:05:30 | |
| 6 | Teil Drei | 00:03:07 | |
| 7 | Teil Drei | 00:10:10 | |
| 8 | Teil Drei | 00:07:06 | |
| 9 | Teil Drei | 00:06:27 | |
| CD 4 | |||
| 1 | Teil Drei | 00:12:28 | |
| 2 | Teil Drei | 00:07:11 | |
| 3 | Teil Vier | 00:09:27 | |
| 4 | Teil Vier | 00:09:43 | |
| 5 | Teil Vier | 00:10:13 | |
| 6 | Teil Vier | 00:08:13 | |
| 7 | Teil Vier | 00:09:29 | |
| 8 | Teil Vier | 00:07:34 | |
| CD 5 | |||
| 1 | Teil Vier | 00:09:19 | |
| 2 | Teil Vier | 00:09:20 | |
| 3 | Teil Vier | 00:08:52 | |
| 4 | Teil Vier | 00:06:42 | |
| 5 | Teil Vier | 00:06:21 | |
| 6 | Teil Fünf | 00:06:34 | |
| CD 6 | |||
| 1 | Teil Fünf | 00:08:26 | |
| 2 | Teil Fünf | 00:11:19 | |
| 3 | Teil Fünf | 00:12:21 | |
| 4 | Teil Fünf | 00:08:25 | |
| 5 | Teil Fünf | 00:08:52 | |

Die Stadt, die Angst und der Trost: Ian McEwans "Saturday"
London, sein kleiner, offen vor ihm liegender, unmöglich zu verteidigender Ausschnitt wartet auf seine Bombe. Die Rush-hour böte eine passende Gelegenheit." Das ist ganz am Ende des Romans, als Henry Perowne nach eines langen Tages Reise in die Nacht am Schlafzimmerfenster steht und auf den Fitzroy Square schaut. An gleicher Stelle hat er schon vor gut vierundzwanzig Stunden gestanden, nachdem er mitten in der Nacht wach geworden ist, für ihn etwas sehr Ungewöhnliches. Da war der Blick aufs nächtliche London noch anders gefärbt, begleitet fast von einem Grandiositätsgefühl: "Wie er dasteht - gegen die Kälte so immun wie eine Marmorstatue - und zur Charlotte Street hinüberschaut, auf den perspektivisch verkürzten Wirrwarr der Fassaden, die Baugerüste und Pultdächer, findet Henry, daß Städte ein Erfolg sind, ein organisches Meisterwerk - wie um Korallenriffe drängen sich Millionen um die angehäuften, vielschichtigen Errungenschaften der Jahrhunderte, schlafen, arbeiten, vergnügen sich, einträchtig zumeist, und wollen fast alle, daß es funktioniert."
Man muß bei dieser Feier der großen Stadt unwillkürlich an eine ähnliche Szene aus einem anderen Roman denken, der exakt achtzig Jahre vor diesem erschienen ist. Da geht Peter Walsh durch London, sieht in der Nähe des Regent's Park ein junges Mädchen in Seidenstrümpfen und mit einem Federhut einem Auto entsteigen und in einem prächtigen Haus verschwinden. Er sieht: "Bewundernswerte Kammerdiener, gelbbraune Chows, eine in schwarz-weißem Rautenmuster ausgelegte Halle, wehende weiße Gardinen. Peter sah es alles durch die geöffnete Haustür und billigte es. Alles in allem doch eine herrliche Leistung in ihrer Art, dieses London; die Season; die Zivilisation." Dem würde übrigens auch seine alte Freundin Mrs. Dalloway zustimmen, bei der er heute abend eingeladen ist.
London im
Belagerungszustand
Die Parallele zu Virginia Woolfs 1925 erschienenem Roman beschränkt sich nicht auf diese stille und zugleich jubelnde Feier der Zivilisation (in die in beiden Fällen der kritische Blick auf sie eingeschlossen ist). Wie in "Mrs. Dalloway" umspannt die erzählte Zeit einen Tag, und wie bei Virginia Woolf gibt es neben den menschlichen Akteuren einen gleichrangigen Protagonisten: die Stadt London.
Die befindet sich an diesem 15. Februar 2003 gleichsam im Belagerungszustand, denn im Lauf des Tages wird die größte Demonstration stattfinden, die es in dieser Stadt je gegeben hat: wider den bevorstehenden Krieg der Amerikaner gegen den Irak und die Unterstützung dieses Krieges durch die britische Regierung. Henry Perowne ist ein erfolgreicher Neurochirurg, glücklich verheiratet mit einer ebenso erfolgreichen Juristin. Er steht mit seinen achtundvierzig Jahren wahrhaft auf der Sonnenseite des Lebens und ist alles in allem der typische aufgeklärte Metropolentyp, ein Liberaler eben. Es sollte ihm eigentlich leichtfallen, den Protest gegen den geplanten Krieg wenigstens innerlich zu unterstützen, auch wenn er an diesem Samstag wie an jedem anderen gegen seinen amerikanischen Kollegen Jay Strauss Squash spielen wird. Aber vor einiger Zeit hatte er einen Patienten aus dem Irak, Professor für Alte Geschichte, der ihm seine Folter- und Leidensgeschichte erzählt hat. Ohne diese Berichte aus dem Innenleben des Terrors hätte er vielleicht eine weniger ambivalente Einstellung zum bevorstehenden Krieg. Und morgens, nach dem ungewohnt frühen Aufwachen, hat Perowne im übrigen im Dunkeln ein brennendes Flugzeug auf Heathrow zufliegen sehen. Der Vorfall klärt sich im Laufe des Tages auf und ist harmloser Natur, doch anderthalb Jahre nach dem September 2001 werden beim Bewohner einer großen westlichen Metropole bei einem solchen Anblick zwangsläufig schlimme Assoziationen geweckt.
Es hätte des unwillkommenen Aktualisierungsschubs durch die Ereignisse des 7. Juli nicht bedurft, um Ian McEwans Roman "Saturday" zu einem der wichtigsten Bücher dieses Jahres zu machen. Im Gegenteil: Die zeitliche Koinzidenz verführt dazu, den Blick auf den Roman zum Tunnelblick zu verengen und ihn zynischerweise als "Buch zum Event" zu lesen. Damit würde man ihm selbstverständlich nicht gerecht. Sosehr McEwan in seinem gesamten Werk von Anfang an Zeitgenosse war, so wenig schrumpft bei ihm diese Zeitgenossenschaft auf vordergründige Aktualität ein. Dazu ist er ein viel zu guter und zu reflektierter Autor. "Saturday" ist bei genauerem Hinsehen vor allem ein Roman über die Liebe und über die Angst.
Henry Perownes Liebe, so könnte man sagen, gilt der Welt, in der er lebt. Sie gilt seiner Frau (Perowne ist absolut monogam); seiner Arbeit, die ihn reich gemacht hat; dem schönen Haus, das er bewohnt, und seinen Kindern. Dieser Neurochirurg wäre ein Paradebeispiel für jede politische Partei, die zeigen möchte, wie ein Bewußtsein auf der Höhe der Zeit und traditionelle Werte Hand in Hand gehen können. "Was er braucht", heißt es am Ende des ersten Teils, "das sind: Besitz, ein Gefühl der Zugehörigkeit und Wiederholung."
Perownes Liebe erstreckt sich auf die westliche Zivilisation insgesamt, wobei die materiellen Möglichkeiten und technischen Annehmlichkeiten, die sie zur Verfügung stellt, ebenso gemeint sind wie der freiheitliche Diskurs, den sie ermöglicht. Zu den schönsten Passagen dieses Buches gehören eine kleine Hommage an die Weiterentwicklung des elektrischen Wasserkochers und eine Hymne auf die Dusche. Und Perowne unterschreibt auch das Credo, daß es besser sei, die wirkliche Welt zu nehmen, wie sie ist, als die Menschheit in eine bessere morden, bomben und beten zu wollen. Dieses Credo schließt auch das Bekenntnis zum Konsum ein: "Nicht der Rationalismus besiegt die religiösen Fanatiker, sondern der gewöhnliche Einkauf mit allem, was dazugehört - Jobs unter anderem, aber auch Frieden und erfüllbare Wünsche, Verheißungen, die in dieser Welt wahr werden und nicht erst in der nächsten. Lieber Einkaufen als Beten." Im Original klingt der letzte Satz in seiner Lakonie wahrhaft wie ein Glaubensartikel: Rather shop than pray.
In der Auseinandersetzung mit seiner Tochter Daisy, einer aufstrebenden Lyrikerin, die die literarische Erziehung ihres Vaters übernimmt und ihm Hausaufgaben in Form von Leselisten gibt, wird er natürlich auch mit dem Magischen Realismus konfrontiert. Der ist Henry Perowne ein Greuel. Menschen, die mit Flügeln geboren werden oder einen übermenschlichen Geruchssinn haben, interessieren ihn nicht. "Das Wirkliche, nicht das Magische sollte die Herausforderung sein", findet er. Man darf das durchaus als Kern von McEwans Poetik lesen, angesichts solcher hinterlistigen Romane wie "Der Trost von Fremden" oder "Der Zementgarten" wohl wissend, daß es sich dabei nicht um einen kruden Realismus handelt.
Da Perowne aber ein durchaus bewußter Zeitgenosse und kein Fachidiot ist, weiß er zugleich, daß diese Wirklichkeit, die er liebt, permanent und zunehmend bedroht ist. Das trifft nicht nur auf die weltpolitische Ebene zu, sondern auch auf die private, wie er und seine ganze Familie im Laufe dieses Samstags feststellen müssen. Die Gewalt bricht am Nachmittag in sein Haus ein, als Folge eines dummen kleinen Autounfalls, den er am Morgen hatte, und in Gestalt von Baxter, der nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht und unter Chorea-Huntington leidet. Es ist das Wissen um diese Krankheit, das den Neurochirurgen Perowne und seine Familie schließlich vor Schlimmerem rettet: Herrschaftswissen, hätte man vor einigen Jahrzehnten mit erhobenem Zeigefinger gesagt. Das stimmt sogar, denn der ganze vierte Akt dieses Dramas in fünf Akten zeigt auch ein Stück Klassenkampf. Dessen ist Perowne sich durchaus bewußt. Seine neurochirurgische Weltsicht sagt ihm zwar, daß ein Großteil dessen, was aus uns wird, von unseren Genen vorgegeben ist. Zugleich würde er aber nicht bestreiten, daß auch die Verhältnisse uns formen. Und in beiden Fällen hat er mehr Glück gehabt als Baxter.
Ein glühender Verteidiger
des Zufalls
Dieses Glück möchte er naturgemäß schützen und erhalten. In der Auseinandersetzung mit Baxter hilft ihm sein Intellekt, nachdem er erkennen muß, daß seine Gewaltphantasien gegenüber dem Eindringling lächerlich sind: "Noch nie in seinem Leben hat er jemandem ins Gesicht geschlagen, nicht mal als Kind. Und ein Messer hat er bislang immer nur in kontrollierter Bewegung und steriler Umgebung an betäubte Haut angesetzt. Er weiß schlichtweg nicht, wie man sich rücksichtslos benimmt." Auf der allgemeineren Ebene tut Henry Perowne, was wir alle zunehmend tun: "Er ist ein fügsamer Bürger, der zusieht, wie der Leviathan mächtiger wird, während er selbst in seinem Schatten Schutz sucht." Daß dabei Liberalität verlorengeht, ist ihm wohl bewußt. Aber die Angst um die Welt, die er liebt, und der unbedingte Wille, sie zu erhalten, lassen ihm keine andere Wahl.
Der Typus, den Henry Perowne verkörpert, ist von Richard Rorty schon vor mehr als anderthalb Jahrzehnten als "liberaler Ironiker" beschrieben worden, dem es weniger um Wahrheit als um die Vermeidung von Grausamkeit geht. Zum Rortyschen Ansatz paßt auch, daß Perowne ein glühender Verteidiger des Zufalls ist, der für ihn auch Freiheit bedeutet. Henry Perowne, dessen Bewußtseinsstrom in diesem Buch vorgeführt wird, ist dennoch alles andere als die Illustration einer philosophischen These. Daß Ian McEwan dieser, sein zehnter Roman nicht zum Thesenpapier geraten ist - nicht einmal in der langen Auseinandersetzung Perownes mit seiner Tochter Daisy um das Für und Wider eines Angriffs auf den Irak -, liegt daran, daß dieser Autor sich wie immer mehr um die Einzelheiten als ums ganz(e) Große kümmert und mehr um die Leute als um die Menschheit. Dem verdanken wir nicht nur die schon genannten Elogen auf den Wasserkocher und die Dusche, sondern auch ein schönes Bild vom Leviathan: "Ohne hinzusehen, findet er die Taste, um den Wagen zu sichern. In rascher Folge schließen die Türen mit einem kleinen, nachhallenden Klacken, vier Sechzehntelnoten, die ihn sanft einlullen. Ein uraltes Evolutionsdilemma: die Notwendigkeit zu schlafen, die Angst, gefressen zu werden - endlich durch Zentralverriegelung gelöst."
Daß die Zentralverriegelung diejenigen aussperrt, die sich dem Leviathan nicht unterwerfen, verschweigt Ian McEwan nicht. Mehrschichtigkeit ist überhaupt die Essenz dieses Romans, und ambivalent bleibt auch der Schluß, den man nicht als vorschnelle Versöhnung mißverstehen sollte. Nach dem Einbruch der Gewalt ist der Friede keineswegs bruchlos wiederhergestellt, auch wenn der Roman mit einer Geste der Liebe endet, bevor sich Perowne dem Schlaf und dem Vergessen überläßt. Die Erinnerung an alles, was seine Welt bedroht, wird nach dem Erwachen gewiß zurückkehren.
Ian McEwan: "Saturday". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. Diogenes Verlag, Zürich 2005. 387 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Ian McEwan gilt als einer der besten britischen Autoren der Gegenwart.« Thomas David / Stern Stern
»Ein so hochliterarischer wie engagierter Zeitdiagnostiker.«