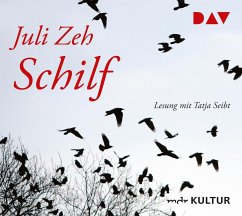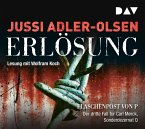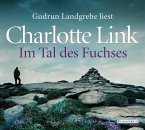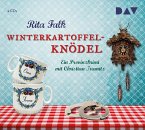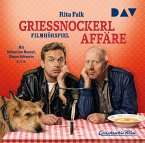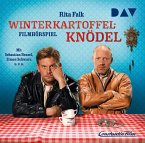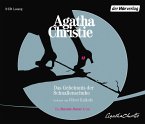Ein Kind verschwindet und weiß nichts davon. Ein Arzt wird getötet, zwei Physiker streiten, und ein Kommissar mit tödlichem Kopfweh glaubt nicht an das Prinzip Zufall. Juli Zeh, eine der aufregendsten Autorinnen ihrer Generation, entwirft in ihrem dritten Roman das Szenario eines Mordes, wie wir es uns bisher nicht vorstellen konnten. Virtuos, rasant und scharfsinnig treibt sie ihre Geschichte bis zum grotesken Finale und erklärt ganz nebenbei das physikalische Phänomen der Zeit.

Vom Adler zum Papagei: Juli Zeh spannt auf die Krimi-Folter / Von Tilmann Lahme
Zuerst das Gute: Der neue Roman von Juli Zeh ist weniger lang als seine Vorgänger. Mit knapp vierhundert Seiten kommt sie in "Schilf" aus.
Und nun zum anderen.
Juli Zeh, 33 Jahre alt, beladen mit Preisen und Stipendien, Lob ("ein Roman von Juli Zeh ist immer ein Abenteuer" - "Brigitte") und Ablehnung ("annähernd apokalyptisch altkluge Angeberin und Schwallmadame" - "Titanic"), hat noch in jedem ihrer drei Romane aufs Große geschielt. Bedeutungsschwer, tiefschürfend und theoriebefrachtet sollen sie sein, und so geht es nach Rechtsphilosophischem ("Adler und Engel"), Spieltheoretischem ("Spieltrieb") jetzt um Zeit und Raum.
Oskar und Sebastian sind physikalische Genies, arrogant und um sich selbst kreisend, vor denen schon im Studium alle ehrerbietig auf die Knie sanken. Jahre später haben sich ihre Wege getrennt, persönlich und wissenschaftlich. Sebastian ist verheiratet und Vater eines zehnjährigen Jungen, Liam, und vertritt als Professor in Freiburg die "Viele-Welten-Interpretation", nach der es parallele Welten neben der von uns wahrgenommenen gibt. "Alles, was möglich ist, geschieht", überschreibt er einen populärwissenschaftlichen Artikel hierzu. Oskar hingegen hält die Welt für ein "Feingespinst aus Kausalität" und strebt danach, die Quantenmechanik mit der Allgemeinen Relativitätstheorie zu vereinigen.
Juli Zeh zwingt ihre Leser in ein Proseminar über das Wesen der Zeit und lässt die beiden ihre Ansichten in hölzernen Dialogen vortragen. Dann kommt die Praxis. Sebastians Sohn wird entführt, er selbst muss, um Liams Leben zu retten, einen Mord begehen. Ein Kommissar namens Schilf, der an Columbo erinnert und todkrank ist, betritt die Bühne, beteiligt sich am Schwadronieren über Kausalität und Zeit und löst schließlich den Fall, der sich als großes Missverständnis herausstellt. Und nicht nur das, Schilf rettet auch den armen Mörder, indem er dessen "Nötigungsnotstand" nachweist. Warum er das tut? Weil die "Vielen Welten" ihm Trost im Angesicht des Todes spenden.
Das ist alles so fürchterlich, wie es klingt, und matt der Trost, dass das Geschehen gar nicht im Zentrum des Romans steht. Die Figuren, die allesamt blass und blutleer bleiben, sind lediglich Thesenträger. Und Juli Zeh führt vor, wie sie ihr angelesenes Wissen vorzutragen weiß. Der mühsam konstruierte Kriminalfall interessiert sie wenig. Ja, sie signalisiert laufend: Dies ist nicht leichte U-Kost, sondern schwere E-Speise. "Höchste Zeit für den Mord" heißt es in der Kapitelüberschrift vor der Tat, krampfhaft selbstironisch. Und Schilf, der erst nach hundertfünfzig Seiten auftaucht, wird so angekündigt: "Mit Verspätung kommt der Kommissar ins Spiel."
Dann verteilt Juli Zeh noch ein paar Hiebe aufs Krimigenre, etwa auf die "vom deutschen Realismus zu Tode bürokratisierten Fernsehkrimis". Wobei das mit dem Bürokratismus seltsam ist angesichts einer Autorin, die ihren Protagonisten, die Nase in den Waldboden gedrückt, darüber sinnieren lässt, ob er "einen Aufnahmeantrag bei den Ameisen" stellen solle. Oder der die Wirklichkeit als "Vertrag zwischen sechs Milliarden Menschen" definiert, den er einseitig habe kündigen müssen, so dass sein Tag nun kein "Echtheitszertifikat" mehr aufweise.
Hinzu kommt Juli Zehs unerwiderte Liebe zur Metapher. Laternen tragen "weite Röcke aus Licht", Strommasten stehen "neben ihren langgezogenen Schatten stramm", der Wind "jongliert am Himmel mit Schwalben" und immer so weiter. Zudem wimmelt es von literarischen Kratzfüßen und von Tieren - es ist ein bemühtes Spiel mit allerlei, der Erzählperspektive etwa. Überall Vögel, aber von Hitchcock keine Spur.
Die "Viele Welten"-Debatte verkommt schließlich, nach so viel spickzettelraschelnder Mühe und marternder Geschwätzigkeit, zum Anlass für eine Beziehungstat. Kurios, wie genretypisch das ist. Während Sebastian sich nicht für eine seiner Welten entscheiden kann, die der Familie oder die seiner Homo-Beziehung zu Oskar, bleibt von all den physikalisch-philosophischen Debatten nur ein lauer Hauch von Eskapismus übrig.
Juli Zeh will sich nun, hört man, ihrer juristischen Doktorarbeit zuwenden. Da kann sie weiter Thesenklappriges stapeln. Und das Beste: Lesen muss es nur einer.
Juli Zeh: "Schilf". Roman. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2007. 383 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Man hält das Buch in den Händen wie ein kostbares Kleinod, so prall gefüllt ist es mit überraschenden Erkenntnissen, schönen Sätzen, poetischen Bildern und kunstvollen Dialogen. Kein Zweifel: Juli Zeh schreibt ganz wunderbar." Amelie Fried