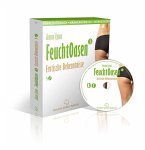Drei ganz normale Tage im Leben von Elizabeth Kiehl (Lavinia Wilson): Kindererziehung, Biokost und Therapie bei Frau Drescher (Juliane Köhler) gehören ebenso dazu wie gemeinsame Bordellbesuche mit ihrem Mann Georg (Jürgen Vogel). Doch Elizabeth, Anfang 30, ist hochneurotisch, ständig in Sorge und hat Angst vor allem - außer beim Sex ...
Schoßgebete erzählt von Ehe und Familie wie kein Filmzuvor. Radikal offen, selbstbewusst und voller grimmigem Humor ist es die Geschichte einer so unerschrockenen wie verletzlichen jungen Frau.
Schoßgebete erzählt von Ehe und Familie wie kein Filmzuvor. Radikal offen, selbstbewusst und voller grimmigem Humor ist es die Geschichte einer so unerschrockenen wie verletzlichen jungen Frau.
| CD | |||
| 1 | Schoßgebete - Track 1 | ||
| 2 | Schoßgebete - Track 2 | ||
| 3 | Schoßgebete - Track 3 | ||
| 4 | Schoßgebete - Track 4 | ||
| 5 | Schoßgebete - Track 5 | ||
| 6 | Schoßgebete - Track 6 | ||
| 7 | Schoßgebete - Track 7 | ||
| 8 | Schoßgebete - Track 8 | ||
| 9 | Schoßgebete - Track 9 | ||
| 10 | Schoßgebete - Track 10 | ||
| 11 | Schoßgebete - Track 11 | ||
| 12 | Schoßgebete - Track 12 | ||
| 13 | Schoßgebete - Track 13 | ||
| 14 | Schoßgebete - Track 14 | ||
| 15 | Schoßgebete - Track 15 | ||
| 16 | Schoßgebete - Track 16 | ||

Ein irre indiskretes Buch hat Charlotte Roche geschrieben, sagen die Kritiker. Die einen feiern, die anderen hassen sie dafür. Dabei ist der Kern des Werks die Stille
Das ist kein Buch über Sex - was man schon daran merken kann, dass es mit Oralsex beginnt, sechzehn Seiten lang, sehr kühl und genau beschrieben, und mit Analsex hört es auf; kurz zuvor war der Text knapp zehn Seiten lang im Bordell, wo die Erzählerin ein paar stimmungsvolle Stunden mit ihrem Mann und einer Prostituierten hatte; und wenn "Schoßgebete", dieser knapp dreihundertseitige Monolog, gerade kein anderes Thema hat, geht es immer wieder um die Frage, ob das Ich des Textes sich demnächst endlich mal trauen werde, den eigenen Mann zu betrügen, obwohl doch dessen Kraft und Kompetenz als Liebhaber dauernd beschworen werden. Wer aber ständig vom Sex spricht, hat eher keinen: Das lehrt das sogenannte Leben. Und wer so viel und so genau über Sex schreibt (und dabei nicht bloß die Lust der Leser stimulieren will), der will anscheinend auf etwas ganz anderes hinaus.
Das ist auch kein Buch über Charlotte Roche - obwohl die Autorin in fast jedem Interview ganz offen und ohne einen großen Unterschied zu machen, über all die Dinge spricht, welche sie, Charlotte Roche, mit ihrer Heldin und Erzählerin Elizabeth Kiehl gemeinsam hat. Und das sind nicht nur Alter, Körperbau, Haarfarbe und die englische Herkunft; das sind auch die furchtbaren Unglücksfälle in der Familie, die das eigentliche Thema der Erzählung sind; und es ist der starke Hass, den beide, Frau Roche und Frau Kiehl, seitdem gegen die "Bild"-Zeitung (die im Buch ein Pseudonym hat) und den Vorstandsvorsitzenden des Springer-Konzerns empfinden, was an der Art liegt, wie "Bild" über diesen Unfall berichtet hat.
Wer die "Schoßgebete" aber als einen Bericht über das Leben und die Meinungen der Charlotte Roche lesen will, wirft damit sofort die Frage auf, wer diese Charlotte Roche eigentlich sei und was diese Autorin ihn kümmern müsse, und die Antwort ginge ungefähr so: Charlotte Roche war früher mal beim Fernsehen, wurde aber viel berühmter durch ihr erstes Buch "Feuchtgebiete", einen Roman über die Meinungen, Gefühle und den Körper einer Achtzehnjährigen, den die meisten Leser anscheinend auch als die Selbstauskunft der Autorin gelesen haben. Man müsste Charlotte Roche über Charlotte Roche also vor allem deshalb lesen, weil Charlotte Roche über Charlotte Roche schreibt.
Wem das zu tautologisch ist, der kann ja mal versuchen, den Text seiner Autorin zu entreißen, was schon deshalb ein grausamer Akt ist, weil Charlotte Roche anscheinend das Gegenteil will; sie krallt sich fest an diesem Buch, und in jedem Interview kämpft sie darum, die Deutungshoheit über ihren eigenen Text zu retten. Es hilft aber alles nichts, wenn die Werke sprechen, müssen deren Schöpfer die Klappe halten. Und der Text wird umso interessanter, je weniger man auf das Interviewgeplapper seiner Autorin hört. "Schoßgebete" ist nämlich ein Buch über den Tod - was man anfangs auch deshalb nicht merkt, weil man dauernd fürchtet, dass hier als allererstes die Sprache krepiert, so egal scheinen Charlotte Roche die eigenen Begriffe zu sein. Über die Therapeutin der Erzählerin heißt es einmal: "Sie hat mir psychisch ganz oft das Leben gerettet." Aha, möchte man da sagen: Wer rettet aber die deutsche Sprache vor solchen Labersätzen.
Und, kleine Stichprobe auf der gegenüberliegenden Seite: "Bei uns wird vor dem Kind aus Vorbildfunktion kein Alkohol getrunken, und alle Getränke aus Zucker sind bei uns verboten, zum einen aus ganz normaler Amerikafeindlichkeit und weil sie auch sehr ungesund sind." Ein paar Seiten vorher hat Elizabeth Kiehl davon erzählt, dass sie gern koche, aber niemals mit Glutamat, weil das Kind und der Mann sich nicht an geschmacksverstärktes Essen gewöhnen dürfen. Charlotte Roches Sprach-Glutamat ist aber das Wörtchen "ganz", das sie in jeden dritten oder vierten Satz hineinschreibt - wo immer eine Menge oder eine Intensität beschworen werden soll und die Autorin aber gerade keine Zeit oder keine Lust hatte, sich ein bisschen Mühe zu geben mit der Suche nach einem einigermaßen präzisen Begriff dafür.
Klar, das ist Rollenprosa, und die Rolle, welche das Ich hier spielt, ist die der Nervensäge, der Dauerüberforderten und, wenn man dann tiefer hineinhört in den Text, die Rolle einer Verzweifelten, die schon deshalb immerfort mit sich selber sprechen muss, weil, wenn es einen Moment lang still wäre in diesem Kopf, sofort die fürchterlichsten Bilder kämen, die Erinnerungen, mit denen Elizabeth Kiehl nicht fertig wird.
Was aber auch nichts daran ändert, dass dieser Text, gerade auf den ersten vierzig, fünfzig Seiten, dort, wo Charlotte Roche sich gewissermaßen warm zu schreiben und in Schwung zu bringen versucht, so häufig läppisch, unkonzentriert, geschwätzig klingt. Und damit dieser Befund nicht mit dem Genörgel der notorischen Abendlandsverteidiger verwechselt wird, mit dem Hohn jener Kritiker, die Charlotte Roche nicht hereinlassen wollen in die deutsche Literatur und die dauernd den hohen Ton fordern, ohne ihn selbst je zu treffen: Damit solche Missverständnisse gar nicht erst entstehen, muss hier auf den wunderbaren Autor Wolfgang Herrndorf verwiesen werden, auf den (im vergangenen Herbst erschienenen) Roman "Tschick", dessen ganze Schönheit und poetische Kraft daher rührte, dass Herrndorf den beschränkten Wortschatz und den pubertären Jargon eines 14-Jährigen zum Rohstoff nahm und daraus seine präzise Prosa formte. Selbst Helene Hegemann rang, in den besseren Passagen von "Axolotl Roadkill", den mauligen und redundanten Dialogen des Berliner Nachtlebens etwas ab, das man wohl ihren Stil nennen muss.
Nein, einen Stil hat Charlotte Roches Prosa nicht, es ist mehr so, wie man halt plappert, wenn einem keiner widerspricht - und womöglich ist ja genau das, diese Formlosigkeit und Ungeschliffenheit der Sprache, vielleicht ist das die wichtigste Ursache des Erfolgs. Es sind barrierefreie Sätze, man kommt da ohne Schwierigkeiten hinein, weiß sofort, was gemeint ist, hat hundert Referenzen aus dem eigenen Alltag, man kann, wo der Text endet, problemlos im gleichen Tonfall weitersprechen, weiterschreiben - und vermutlich ist das auch der Grund dafür, dass in den vielen Interviews von Sprache, Stil, von Literatur eigentlich nie die Rede ist. Und umso mehr von Sex und Nicht-Sex, von Männern, Kindern und natürlich von Charlotte Roche. Es ist, als würden die "Schoßgebete" auf Magazinseiten und vor Fernsehkameras immer weitergeschrieben. Der Kritiker der "Zeit" bekannte, er habe den Anfang des Buchs wie eine Gebrauchsanleitung gelesen (und seine Sätze kicherten dabei). Der Kritiker der "Süddeutschen Zeitung" gab zu, dass er sich von so viel Sex belästigt fühle, einmal im Monat sei doch genug; und im Übrigen solle man mehr Aufhebens vom Essen und dem Wohnen und weniger von der körperlichen Liebe machen. Oje, möchte man da stöhnen, so genau wollte ich es aber gar nicht wissen, mir reichen schon Ihre Geschmacksurteile. Und zugleich spricht es eher für als gegen Charlotte Roche, dass selbst die Verrisse gewissermaßen Fortschreibungen ihrer Prosa sind, Indiskretionen von Leuten, die ihr einen Mangel an Diskretion und Delikatesse vorwerfen.
Es scheint da eine Kraft zu wirken, es findet sich, wenn man an der Oberfläche der Floskeln kratzt, eine Substanz: Es ist, wenn man ein wenig Distanz zu all den Beschreibungen und Behauptungen gewinnt, als schaute man dem Text dabei zu, wie er langsam zu sich selber kommt - und den Anfangsverdacht, dass dieses Buch nur einen selbstbewussteren Lektor hätte brauchen können, einen, der den Anfang verknappt und manchen Absatz der Autorin zum Nochmalschreiben zurückgegeben hätte, diesen Anfangsverdacht möchte man auch nicht aufrechterhalten, wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, schon weil zum Schluss hin der Verdacht aufkommt, dass der Text womöglich klüger als seine Autorin sei. Es ist evident, dass da viel Geschwätz ist. Und es ist extrem schwer zu unterscheiden, wo das Geschwätz nur Geschwätz bleibt - und wo es die poetische Strategie bedeutet.
Man darf dieser Erzählerin kaum ein Wort glauben, nicht, dass sie ihren Mann so sehr liebt, dass sie immer weiter an der Vervollkommnung ihrer Oralsextechnik arbeite; nicht dass sie sich um ihr Kind sorge, noch nicht einmal dass sie, wenn sie Lust empfinde, den Schmerz, der ihr Leben ist, vergessen könne. Jeder dieser Sätze wird ein paar Seiten später relativiert, vergessen, aufgehoben durch sein Gegenteil, und die einzige Behauptung, die man diesem Ich tatsächlich glauben möchte, ist das immer wiederkehrende Motiv, dass Elizabeth nachts, wenn sie im Bett liegt und nach oben schaut, einen Riss in der Decke sieht, und nur sie kann ihn sehen, und die Furcht, dass die Decke einstürzen und alles begraben könnte, die bleibt die ganze Nacht.
Elizabeth, das ist die Erinnerung, die nicht verblassen will, Elizabeth war gerade gelandet in England, wo sie heiraten wollte, und dann rief der Vater an und erzählte von dem Verkehrsunfall, den die Mutter, schwer verletzt, überlebt hatte, die Schwägerin auch, und die drei Brüder hatten nicht überlebt, und das Schlimmste daran, erzählt Elizabeth, ist, dass sie nicht weiß, ob sie sich beim Aufprall das Genick gebrochen haben. Oder ob sie erst verbrannt sind, als das Auto explodierte. Von so einem Unglück kann man nicht in Floskeln erzählen, das ist so knapp beschrieben, dass nur schweigen knapper wäre.
Und später, wenn Elizabeth von ihrem immer wiederkehrenden Wunschtraum erzählt, wonach die Brüder vor der Explosion entkommen sind; dass sie sich in den Wald geflüchtet haben, wo sie jetzt leben, wie glückliche, unbewusste Tiere, da ist dieser Text so zart und diskret, wie man es seiner Autorin bis dahin nicht zugetraut hätte.
Vielleicht mussten ja nur diese beiden Dinge geschrieben werden, und alles andere ist bloß sprachliches Verpackungsmaterial, was irgendwie verständlich wäre - auch wenn es trivial und ein bisschen dämlich klingt, wie Charlotte Roche fröhlich grinsend in Interviews erzählt, dass sie jetzt, da sie es hingeschrieben habe, von diesen Dingen befreit sei. Jetzt sollen die Leser weinen, und sie könne wieder lachen.
Vielleicht ist es ja so, dass, neben dieser Erinnerung und der wunderbaren Rettungsvision, alles andere, was Elizabeth so tut und zu fühlen und meinen und denken behauptet, so ungeheuer unwichtig und banal ist, dass es nur in der Form des Geschwätzes beschrieben werden kann.
Und vielleicht sind die "Schoßgebete" tatsächlich ein Werk der allerschwärzesten Ironie, in welchem man kein Wort beim Nennwert nehmen kann. Und alles nur der Lärm ist, der die Stille vertreiben, die Lüge, welche die Wahrheit erträglich machen, der Text, der das Gefühl betäuben soll.
Ein schreckliches Buch. Man muss es lesen.
CLAUDIUS SEIDL
Charlotte Roche: "Schoßgebete". Piper-Verlag, 283 Seiten, 16,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Eher nach Sport als nach Sex hören sich für Sabine Vogel Charlotte Roches "Schoßgebete"an, deren erwartungsgemäß detailreichen Sexschilderungen sie allerdings nicht vom Hocker rissen. Laut Vogels Schilderungen kann man sie zwischen neuer sexueller Sachlichkeit und Ratgeberliteratur verorten. So therapeutisch wie neurotisch ist nach Vogel aber nicht nur das Verhältnis zwischen Sex und Text; zwischen Bekenntnis und Beratung schwankt auch die Haltung des schreibenden Selbst. Anstelle von Handlung gibt es deshalb Lebenssituation - diesmal im kratzigen Nervenkostüm der Hauptfigur Elisabeth, die an ihrer Rolle als erfolgreiche Supermutter natürlich glanzvoll zu Grunde gehen muss. Für Sabine Vogel sind die "Schoßgebete" alles in allem eher Beschwörungsformeln, überspannt wie immer, aber ein wenig humorlos.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»... ein verstörend schonungsloses Buch. (...) Das Buch der erst 33- Jährigen ist überraschend lebensweise. Bittere Wahrheiten und saftige Stellen im Wechsel. Manchmal könnte man das Buch sogar für den Beginn einer neuen sexuellen Revolution halten.« Stern 20110818